Книга: Tage der Toten
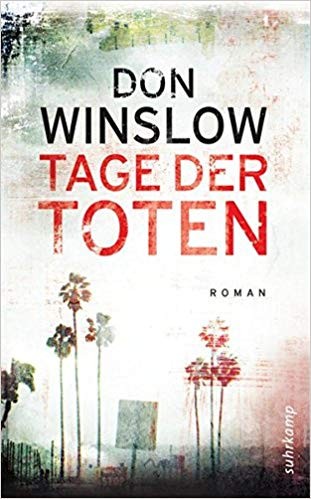
Don Winslow
Tage der Toten
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen Chris Hirte
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel
The Power of the Dog
Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden!
22. Psalm 20
Prolog
El Sauzal, Provinz Baja, California
Mexiko
1997
Sie hält ihr totes Baby in den Armen.
Aus der Position der Leichen schließt Art Keller, dass die Mutter ihr Kind schützen wollte. Es muss ein Instinkt gewesen sein, denkt Keller, sie muss gewusst haben, dass sie die Kugeln einer Kalaschnikow nicht mit ihrem Körper aufhalten kann. Nicht aus dieser Entfernung. Trotzdem hat sie sich weggedreht, als sie erschossen wurde, und fiel auf ihren kleinen Sohn.
Hat sie wirklich geglaubt, ihr Kind retten zu können? Vielleicht wollte sie ihm den Blick ins Mündungsfeuer ersparen, denkt Keller. Vielleicht sollte ihre mütterliche Brust sein letzter Eindruck von dieser Welt bleiben. Geborgen in Liebe.
Keller ist Katholik. Mit seinen siebenundvierzig Jahren hat er eine Menge Madonnen erlebt. Aber keine wie diese.
»Cuernos de chivo«, hört er einen Polizisten sagen.
Ganz leise, fast flüsternd, wie in der Kirche.
Cuernos de chivo - Ziegenhörner. So nennen sie die Kalaschnikows.
Keller hat es schon an den Patronenhülsen vom Kaliber 7,62 gemerkt. Hunderte davon liegen auf dem Beton des Innenhofs verstreut, auch ein paar 12er Schrothülsen und 5,56er von der AR15, wie es aussieht. Aber die meisten Hülsen stammen vom Ziegenhorn, der bevorzugten Waffe der mexikanischen Drogenmafia.
Neunzehn Tote.
Neunzehn weitere Opfer im Drogenkrieg, denkt Keller. In den vierzehn Jahren seiner Fehde mit Adán Barrera hat er so manches gesehen, hat er sich an den Anblick von Toten gewohnt. Aber nicht neunzehn auf einmal. Frauen, Kinder, Säuglinge. Das nicht.
Zehn Männer, drei Frauen, sechs Kinder.
An der Hofmauer aufgereiht und erschossen.
Zerfetzt ist zutreffender, denkt Keller. In Stücke gerissen in einer hemmungslosen Schießorgie. Und jetzt in einem Bluttümpel liegend, in einer dicken Schicht aus schwarzem, getrocknetem Blut. Blut klebt an den Wänden, Blut durchtränkt den gepflegten Rasen, dessen Halme schwarzrot glitzern. Wie winzige blutige Schwerter, denkt Keller.
Offenbar haben sie sich gewehrt, als sie merkten, was ihnen bevorstand. Mitten in der Nacht aus den Betten gerissen, auf den Hof gezerrt, an der Wand aufgereiht - es hat ein Kampf stattgefunden, Möbel sind umgeworfen, klobige, schmiedeeiserne Gartenmöbel. Überall liegen Glasscherben verstreut.
Keller schaut sich weiter um - eine Puppe mitten in der Blutlache. Braune Glasaugen starren ihn an. Gleich daneben ein kleines Stofftier und ein niedliches Pinto-Pferdchen aus Plastik.
Kinder, aus dem Schlaf gerissen, klammern sich an ihre Kuscheltiere. Auch dann, wenn Gewehre knallen. Besonders dann.
Er muss an den Stoffelefanten seiner Kindheit denken. Den Stoffelefanten, ohne den er nicht ins Bett ging. Der hatte nur noch ein Auge, war fleckig von Erbrochenem und anderen Absonderungen und roch auch so. Bis ihn seine Mutter heimlich eines Nachts durch einen neuen ersetzte, mit zwei Augen und reinlichem Geruch. Am Morgen bedankte er sich für den neuen Elefanten und holte den alten aus der Mülltonne zurück.
Arthur Keller spürt, wie etwas in ihm zerbricht.
Die erwachsenen Opfer tragen teure Seidenpyjamas und Negligés, manche auch T-Shirts. Zwei, ein Mann und eine Frau, sind nackt - aus dem Liebesakt gerissen, denkt Keller, und in einer obszönen Blutorgie geopfert.
Einer liegt allein da, an der Wand gegenüber. Ein alter Mann, das Familienoberhaupt. Wahrscheinlich als Letzter ermordet, denkt Keller. Gezwungen, der Auslöschung seiner Familie beizuwohnen, und dann ebenfalls erschossen. Aus Gnade? Aus einem pervertierten Gefühl der Barmherzigkeit? Dann sieht er die verstümmelten Hände des alten Mannes. Erst wurden ihm die Fingernägel ausgerissen, dann die Finger abgehackt. Sein Gesicht ist im Schrei erstarrt, die Finger stecken in seinem Mund.
Das bedeutet, dass die Mörder in seiner Familie einen dedo vermuteten, einen Finger, einen Zuträger.
Und ich habe sie zu dieser Annahme verführt.
Gott vergib mir.
Er schreitet die Reihe der Toten ab, bis er den findet, den er gesucht hat.
Als er vor ihm steht, krempelt sich sein Magen um, er muss sich zusammenreißen, um nicht zu erbrechen. Das Gesicht des noch jungen Mannes ist heruntergepellt wie eine Bananenschale. Die Hautlappen hängen an seinem Hals herab. Keller kann nur hoffen, dass sie ihn vorher getötet haben, aber er weiß es besser.
Die untere Hälfte seines Hinterkopfs ist weggesprengt. Sie haben ihm in den Mund geschossen. Verräter kriegen die Kugel in den Hinterkopf, Zuträger kriegen sie in den Mund.
Sie hielten ihn für den Zuträger.
So wie es geplant war, sagt sich Keller.
Aber das hier hätte er sich nie träumen lassen. Nie hätte er geglaubt, dass sie so etwas tun würden.
»Es muss doch hier Hauspersonal gegeben haben«, sagt er. »Angestellte.«
Die Polizei hat die Unterkünfte schon durchsucht.
»Alle weg«, sagt einer.
Verschwunden. Haben sich in Luft aufgelöst.
Er zwingt sich, die Leichen noch einmal in Augenschein zu nehmen.
Ich bin schuld, denkt Keller.
Das haben diese Leute mir zu verdanken.
Es tut mir leid, denkt er, es tut mir irrsinnig leid. Er beugt sich über die tote Mutter mit dem Kind und macht das Zeichen des Kreuzes. »In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.«
»El poder del perro«, hört er einen mexikanischen Polizisten flüstern.
Das ist das Werk des Bluthunds.
ERSTER TEIL
Erbsünden
1 Die Männer von Sinaloa
Siehst du die furchtbar öde Heide dort,
Die Wohnung der Verzweiflung, ohne Licht,
Bis auf den Schimmer dieser fahlen Flammen,
Die blass und schrecklich flimmern?
John Milton, Das verlorene Paradies
Distrikt Badiraguato Provinz Sinaloa Mexiko
1975
Der Mohn brennt.
Rote Blüten, rote Flammen.
Nur in der Hölle, denkt Keller, gibt es flammende Blüten.
Er blickt in das brennende Tal wie in eine dampfende Suppenschüssel - was sich dort zwischen den Rauchschleiern abspielt, ist eine Höllenszene.
Hieronymus Bosch malt den Drogenkrieg.
Campesinos - mexikanische Bauern - fliehen vor dem Flammenmeer, beladen mit den Habseligkeiten, die sie retten konnten, bevor die Soldaten kamen und ihr Dorf anzündeten. Ihre Kinder vor sich her schiebend, schleppen sie Säcke mit Essensvorräten, Decken und Kleidern und ihren kostbarsten Familienandenken. Mit ihren weißen Hemden und ihren Strohhüten sehen sie aus wie Gespenster, wenn sie durch die Rauchschwaden ziehen.
Nur etwas andere Menschen, denkt Keller, und das könnte Vietnam sein.
Aber was hier abläuft, ist nicht Operation Phoenix, sondern Operation Condor, er hockt hier nicht als CIA-Mann im Bambusdickicht an der Grenze zu Nordvietnam, sondern als Drogenfahnder in einem Gebirgstal der Provinz Sinaloa.
Und was hier geerntet wurde, war nicht Reis, sondern Opium.
Keller hört das dumpfe wopp-wopp-wopp von Hubschrauberrotoren und blickt auf. Ein Geräusch, das bei Vietnam-Veteranen Erinnerungen weckt. Erinnerungen woran?, fragt er sich. Manche Erinnerungen sollten besser begraben bleiben.
Hubschrauber und Flugzeuge kreisen wie Geier über dem Tal. Die Flugzeuge sprühen das Pflanzengift, die Hubschrauber bieten ihnen Feuerschutz, denn einige gomeros - so heißen die Opiumbauern - verteidigen ihren Besitz. Mit einem gut gezielten Feuerstoß aus der Kalaschnikow kann man einen Hubschrauber ohne weiteres vom Himmel holen. Das weiß Keller nur zu gut. Wird der Heckrotor getroffen, trudelt das Ding zu Boden wie ein Spielzeugflieger auf einer Kindergeburtstagsparty. Und trifft man den Piloten, dann prost Mahlzeit ... Bis jetzt hatten sie aber Glück. Entweder sind die Gomeros schlechte Schützen, oder sie haben keine Erfahrung mit Hubschraubern.
Formell handelt es sich um mexikanisches Fluggerät - Operation Condor ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Neunten mexikanischen Armeekorps und der Provinz Sinaloa -, aber die Flugzeuge werden von der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA finanziert, und die Piloten rekrutieren sich zumeist aus ehemaligen CIA-Angehörigen der alten Vietnamtruppe. Wenn das kein Witz ist, denkt Keller - die Jungs von Air America, die früher Heroin für thailändische Warlords geflogen haben, rücken nun dem mexikanischen Opium mit Entlaubungsgiften zu Leibe.
Die DEA wollte Agent Orange einsetzen, aber dagegen hatten sich die Mexikaner gesträubt. Also kam das neue Mittel 2,4-D zum Einsatz, mit dem die Mexikaner vor allem deshalb einverstanden waren, weil die Gomeros dieses Zeug sowieso als Unkrautvertilgungsmittel benutzen.
Es gibt also genug davon.
Klar, denkt Keller, die Mexikaner entscheiden, was hier passiert. Wir Amerikaner sind nur die »Berater«. Wie in Vietnam.
Nur die Basecaps haben sich geändert.
Der amerikanische Drogenkrieg hat eine neue Front in Mexiko eröffnet. Gegenwärtig stoßen zehntausend mexikanische Soldaten in dieses Tal nahe der Stadt Badiraguato vor - zur Unterstützung der mexikanischen Bundespolizei und der DEA-Berater, zu denen auch Keller gehört. Die meisten kommen zu Fuß, andere sind beritten, treiben Rinder vor sich her, als wären sie vaqueros, mexikanische Cowboys. Ihr Befehl lautet ganz simpel: Vergiftet die Mohnfelder und verbrennt alles, was übrig ist, fahrt unter die Gomeros wie der Hurrikan unters trockene Laub, zerstört die Heroin-Rohstoffbasis hier in den Bergen von Westmexiko.
Die Sierra Occidental bietet die ideale Kombination aus Höhenlage, Regenmenge und Bodensäuregehalt für das Gedeihen von papaver somniferum, der Mohnsorte, aus der »Mexican Mud« gewonnen wird, ein starkes, billiges, braunes Heroin, das den amerikanischen Markt überschwemmt.
Wieso eigentlich Operation Condor?, denkt Keller.
Seit sechzig Jahren hat man am mexikanischen Himmel keinen Kondor gesehen, und aus den Staaten ist er schon viel früher verschwunden. Aber jede Operation braucht einen Namen, sonst glauben wir nicht an sie - also Condor. Warum nicht?
Keller hat sich ein bisschen schlaugemacht, was diesen Vogel betrifft. Es ist (war) der größte aller Raubvögel, obwohl dieser Begriff ein wenig irreführend ist, denn statt zu jagen, betätigt sich der Kondor lieber als Aasfresser. Ein ausgewachsener Kondor, hat Keller gelesen, könnte ohne weiteres einen kleinen Hirsch reißen, aber er wartet lieber, bis ein Tier auf andere Weise zu Tode kommt und er nur von oben einzuschweben braucht, um es sich zu schnappen.
Genau wie wir, denkt Keller.
Operation Condor.
Und wieder ein Vietnam-Flashback.
Der Tod von oben.
Da hocke ich nun im Gestrüpp, zitternd vor Kälte an diesem feuchten Gebirgsmorgen, und liege auf der Lauer. Wie damals.
Nur dass ich diesmal keinen Vietcong-Kader im Visier habe, sondern den alten Don Pedro Aviles, den Drogenboss von Sinaloa, el patrón persönlich. Seit einem halben Jahrhundert schon versorgt Don Pedro den Markt mit dem hier erzeugten Opium, lange bevor Bugsy Siegel kam, mit Virginia Hill im Schlepptau, um der kalifornischen Mafia eine stetig sprudelnde Heroinquelle zu sichern.
Siegel schloss einen Deal mit dem jungen Don Pedro Aviles, der seine neue Machtposition dazu nutzte, sich zum patrón zu erheben, zum Boss, und diesen Posten bekleidet er bis heute. Doch neuerdings gerät seine Macht ins Wanken - seit ihm ein paar junge Kerle den Respekt verweigern. Ein Naturgesetz, denkt Keller, die jungen Löwen bringen die alten irgendwann zu Fall. Ganze Nächte hat er in seinem Hotelzimmer in Culiacán wachgelegen - die Schießereien in den Straßen sind inzwischen so alltäglich, dass sich die Stadt den Spottnamen Little Chicago redlich verdient hat.
Nun, vielleicht ist ab heute Ruhe.
Wenn du Don Pedro verhaftest, machst du diesen Fehden ein Ende. Und kannst dich als Held feiern lassen, denkt er ein wenig schuldbewusst.
Keller ist ein überzeugter Befürworter des Drogenkriegs. Aufgewachsen im Barrio Logan von San Diego, hat er mit eigenen Augen gesehen, was das Heroin in solch einem Viertel anrichten kann, besonders wenn es ein armes Viertel ist. Hier geht es darum, die Drogen von der Straße wegzukriegen, ermahnt er sich, nicht um deine Karriere.
Andererseits braucht er sich, wenn er den alten Aviles zur Strecke bringt, um seine Karriere nicht zu sorgen. Und die könnte, wenn er ganz ehrlich ist, einen kleinen Schub gebrauchen.
Die DEA ist eine junge Behörde, kaum zwei Jahre alt. Als Präsident Nixon den Drogenkrieg ausrief, brauchte er Soldaten. Die meisten wurden aus der Vorgängerbehörde übernommen, etliche wurden in den Polizeieinrichtungen des Landes rekrutiert, aber in der Startmannschaft waren nicht wenige vertreten, die direkt von der Firma kamen.
Keller war einer von ihnen. Ein Company Cowboy.
So nennen die Cops diejenigen, die von der CIA kommen - um ihnen dann mit Ablehnung und Misstrauen zu begegnen.
Eigentlich zu Unrecht, denkt Keller. Im Grunde machen sie bei der DEA dasselbe - Informationen sammeln. Du suchst dir deine Zuträger, baust sie auf, steuerst sie und verwertest die Informationen, die sie dir liefern. Der große Unterschied zum alten Job: Früher haben sie die Zielpersonen noch verhaftet, jetzt bringt man sie einfach um.
Nach dem Vorbild von Operation Phoenix, der programmierten Vernichtung des Vietcong.
Mit den Killerkommandos hatte Keller in Vietnam nicht allzu viel zu tun. Er musste die Rohdaten sammeln und auswerten. Die Dreckarbeit machten dann die anderen, meist Spezialeinheiten im Sold der Firma.
Sie rückten immer nachts aus, erinnert sich Keller. Blieben manchmal tagelang weg, trudelten im Morgengrauen wieder ein, völlig überdreht vom Dexedrin. Dann verzogen sie sich in ihre Kojen und schliefen tagelang durch, bis sie wieder rausmussten, zum nächsten Einsatz.
Ein paarmal, wenn es Hinweise auf eine größere Feindkonzentration gab, war Keller mit den Jungs von den Special Forces rausgefahren, hatte beim Legen eines nächtlichen Hinterhalts geholfen.
Aber begeistert hatte ihn das nicht. Meistens hatte er einfach nur Angst, aber er machte seinen Job, sparte nicht mit Munition, gab seinen Kumpels Feuerschutz und kam lebend wieder raus. Aber er hat Dinge gesehen, die er am liebsten vergessen möchte.
Ich muss mit der Tatsache leben, denkt Keller, dass ich Namen von Menschen auf ein Stück Papier geschrieben habe und damit ihr Todesurteil gefällt habe. Wer das hinter sich hat, kann nur noch zusehen, dass er möglichst sauber durch diese dreckige Welt kommt.
Aber dieser verdammte Krieg.
Dieser verdammte, beschissene Krieg.
Wie viele andere hat auch er den Abflug der letzten Hubschrauber aus Saigon im Fernsehen verfolgt, wie viele andere Kriegsveteranen hat auch er sich an dem Abend, als das Angebot kam, zur neu gegründeten DEA zu wechseln, sinnlos besoffen, und er war von Anfang an dabei.
Aber erst hat er mit Althie drüber gesprochen.
»Vielleicht ist das mal ein sinnvoller Krieg«, hat er zu seiner Frau gesagt. »Vielleicht können wir den sogar gewinnen.«
Und jetzt, denkt Keller, während er hier hockt und auf Don Pedro lauert, stehen wir vielleicht kurz davor.
Seine Beine tun weh vom Stillsitzen, aber er rührt sich nicht vom Fleck. Das hat er in Vietnam gelernt. Die Mexikaner, die um ihn herum im Gestrüpp postiert sind, sind genauso diszipliniert - zwanzig Special Agents vom mexikanischen Geheimdienst DFS in Tarnkleidung, ausgerüstet mit Uzis.
Nur Tío Barrera ist im Anzug erschienen.
Selbst hier oben im wilden Hochland trägt der Sonderbeauftragte des Gouverneurs einen schwarzen Markenanzug mit blütenweißem Hemd und schwarzer Seidenkrawatte. Er wirkt entspannt und heiter, ein Musterbild lateinamerikanischer Männlichkeit.
Ganz wie die Filmstars der vierziger Jahre, denkt Keller. Glatt zurückgekämmtes schwarzes Haar, Menjoubärtchen, ein schmales, markantes Gesicht mit Wangenknochen wie aus Granit gemeißelt.
Und Augen, schwarz wie eine Neumondnacht.
Offiziell ist Miguel Angel Barrera Polizeioffizier im Dienst der Provinz Sinaloa und Leibwächter des Gouverneurs von Sinaloa, Manuel Sánchez Cerro. Inoffiziell ist er der Mann fürs Grobe, die rechte Hand des Gouverneurs. Und da Operation Condor, rein technisch gesprochen, eine Aktion der Provinz Sinaloa ist, ist Barrera hier der Boss.
Und was bin ich?, fragt sich Keller. Wenn ich's recht bedenke, ist Barrera auch mein Boss.
Die zwölf Wochen DEA-Ausbildung waren nicht übermäßig hart. Die Dreimeilenstrecke ließ ihn kalt, Basketball konnte ihn nicht schrecken, und das Selbstverteidigungstraining war verglichen mit Langley ein Klacks. Die Ausbilder trainierten sie nur im Boxen und Ringen, und Keller hatte sich bei den Box-Jugendmeisterschaften in San Diego eine Bronzemedaille geholt.
Er war ein mäßiger Mittelgewichtler - gute Technik, aber zu langsam. Irgendwann fand er sich mit der bitteren Tatsache ab, dass man Schnelligkeit nicht lernen kann. Er war gerade mal gut genug, um in die höheren Ränge vorzurücken und dann nach Strich und Faden verdroschen zu werden. Aber er bewies, dass er einstecken konnte, und das verschaffte ihm, dem Halblatino, Ansehen im Barrio. Ein Boxer, der einstecken kann, zählt bei den mexikanischen Fans mehr als einer, der austeilt.
Und Keller konnte einstecken.
Als er boxen gelernt hatte, ließen ihn die mexikanischen Kids meistens in Ruhe. Sogar die Gangs wichen ihm aus.
Beim DEA-Training allerdings achtete er darauf, seine Gegner im Ring nicht allzu hart anzufassen. Es war sinnlos, nur aus Prahlerei zuzuschlagen und sich Feinde zu machen. Die kriminalistische Ausbildung fiel ihm schon schwerer, aber er bestand die Prüfung mit Würde, und die Suchtmittelkunde war ein Kinderspiel: Woran erkennt man Marihuana? Woran erkennt man Heroin? Er verkniff sich die Bemerkung, dass ihm das noch nie Schwierigkeiten bereitet hatte.
Auch der Versuchung, Klassenbester zu werden, widerstand er. Es wäre ihm leichtgefallen, und er wusste es, aber er zog es vor, unter dem Radar durchzutauchen. Die von der Polizei kamen, glaubten immer, dass ihnen die Jungs von der Firma ins Handwerk pfuschten, also war es besser, sich bedeckt zu halten.
Mit anderen Worten, er ging das körperliche Training locker an, hielt sich im Unterricht zurück und verpatzte den einen oder anderen Test. So kam er durch, ohne zu glänzen. Ein bisschen schwerer fiel es ihm, bei der Kampfausbildung im Hintergrund zu bleiben. Überwachungstechnik? Ein alter Hut. Wanzen, versteckte Kameras? Die installierte er im Schlaf. Konspirative Treffen und Übergaben, tote Briefkästen, Quellenführung, Verhörtechnik, Beschaffung und Auswertung von Informationen? Diesen Kurs hätte er selbst unterrichten können.
Doch er hielt den Mund, wurde befördert und zum Special Agent der DEA ernannt. Er kriegte zwei Wochen Urlaub, und ab ging's - nach Mexiko.
Nach Culiacán, der Drehscheibe des amerikanischen Drogenhandels.
Der Hochburg des Opiums.
Dem Bauch der Bestie.
Sein neuer Chef bereitete ihm einen freundlichen Empfang. Tim Taylor hatte sich Kellers Akte schon bringen lassen und war bestens im Bilde. Er blickte nicht mal von seiner Lektüre auf. Keller saß ihm am Schreibtisch gegenüber, und Taylor fragte: »Vietnam?«
»Ja.«
»Beim beschleunigten Befriedungsprogramm.«
»Ja.« Beschleunigtes Befriedungsprogramm alias Operation Phoenix, verbunden mit dem alten Witz, dass da eine Menge Jungs sehr schnell sehr befriedet wurden - für immer.
»CIA«, sagte Taylor. Es war eine Feststellung, keine Frage.
Feststellung oder Frage, Keller reagierte nicht darauf. Taylor kam aus der alten Drogenbehörde BNDD und hatte lange unter ihrer chronischen Unterfinanzierung leiden müssen. Jetzt, wo Drogen wieder höchste Priorität hatten, wollte er seinen sauer verdienten Status nicht an irgendwelche Neulinge abtreten.
»Wissen Sie, was ich nicht mag an euch Company Cowboys?«, fragte Taylor.
»Nein, was?«
»Ihr seid keine Cops«, sagte Taylor, »ihr seid Killer.«
Fick dich, dachte Keller. Aber er hielt den Mund. Er kniff ihn fest zu, während ihn Taylor darüber belehrte, dass er keinen Cowboy-Scheiß wolle, sondern dass sie ein »Team« seien und Keller gut daran täte, als »Teamplayer« aufzutreten und sich immer schön an die Regeln zu halten.
Keller wäre mit Kusshand ein Teamplayer geworden, wenn ihn das Team gelassen hätte. Nicht dass ihn das allzu sehr juckte. Wer im Barrio groß wird, als Sohn eines amerikanischen Vaters und einer mexikanischen Mutter, für den gibt es kein Team.
Kellers Vater, ein Geschäftsmann aus San Diego, hatte beim Urlaub in Mazatlán ein mexikanisches Mädchen geschwängert. (Wenn schon nicht geboren, so bin ich wenigstens in Sinaloa entstanden, sagt sich Keller gelegentlich.) Keller senior besaß immerhin den Anstand, das Mädchen zu heiraten, was ihm kein allzu großes Opfer abverlangte, denn sie war von aufreizender Schönheit - und sein gutes Aussehen hat Keller von ihr geerbt. Sein Vater nahm sie also mit in die USA - um festzustellen, dass es sich mit ihr genauso verhielt wie mit vielen anderen Souvenirs, die man aus Mexiko mitbringt: Im Mondschein von Mazatlán war sie ihm bedeutend verlockender vorgekommen als im kalten Licht des amerikanischen Alltags.
Die Trennung kam, als der kleine Arthur ein Jahr alt war. Da sie den großen Vorteil, den ihr Sohn genoss, die amerikanische Staatsbürgerschaft, nicht preisgeben wollte, zog sie zu entfernten Verwandten ins Barrio Logan. Art Keller wusste, wer sein Vater war. Manchmal setzte er sich in den kleinen Park an der Crosby Street, blickte zu den gläsernen Hochhäusern hinüber und stellte sich vor, einmal dorthin zu gehen und seinen Vater zu besuchen.
Aber er tat es nicht.
Keller senior schickte Schecks - erst regelmäßig, dann nur noch sporadisch -, gelegentlich wurde er auch von Vatergefühlen und Gewissensbissen heimgesucht und ging mit Art ins Restaurant oder zum Baseball. Doch die Treffen verliefen in einer gezwungenen, beklommenen Atmosphäre, und als Art in die Mittelschule kam, hörten sie ganz auf.
Auch das Geld blieb aus.
Daher war es keine leichte Sache für den Siebzehnjährigen, als er schließlich doch nach Downtown fuhr, einen der Glastürme betrat und zum Büro seines Vaters vordrang, ihm sein glänzendes Eignungszeugnis und die Zulassung zum Studium an der UCLA auf den Schreibtisch legte und sagte: »Fall nicht vom Hocker. Ich will nichts weiter als einen Scheck.«
Er bekam ihn.
Vier Jahre lang, jedes Jahr einen.
Und eine Lektion mit auf den Weg. Die YOYO-Regel. You are on your own. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner.
Was eine gute Lektion war, wie sich jetzt wieder zeigte, nachdem ihn die DEA nach Culiacán abgeschoben und dort seinem Schicksal überlassen hatte. »Schauen Sie sich um im Lande«, riet ihm Taylor und ließ einen ganzen Haufen ähnlicher Klischees folgen: »Sammeln Sie Eindrücke«, »Gehen Sie's ruhig an«, und, ob man's glaubt oder nicht: »Ohne Fleiß kein Preis.«
Er hätte genauso gut »Fick dich ins Knie«, sagen können, denn darauf lief es hinaus. Taylor und seine Polizeifreunde isolierten ihn, schnitten ihn von Quellen und Informationen ab, schlossen ihn von den Lagebesprechungen mit der mexikanischen Polizei aus, ließen ihn weder an den morgendlichen Schwatzrunden bei Kaffee und Doughnuts teilnehmen noch an den abendlichen Trinkgelagen, wo es die wirklich wichtigen Informationen gab.
Mit anderen Worten, er wurde rundum gemobbt.
Die Mexikaner redeten nicht mit ihm, weil er ein Yankee war, und die Yankees in Culiacán waren entweder Dealer oder Drogenfahnder. Ein Dealer konnte er nicht sein, weil er nicht kaufte (Taylor gab keine Mittel für ihn frei, damit er seinen Leuten nicht ins Handwerk pfuschte), also musste er Drogenfahnder sein.
Die Polizei von Culiacán wollte nichts mit ihm zu tun haben, weil er ein Yankee-Drogenfahnder war, der lieber vor der eigenen Haustür kehren sollte, außerdem stand sie überwiegend im Sold von Don Pedro Aviles. Aus dem gleichen Grund zeigte ihm die Provinzpolizei von Sinaloa die kalte Schulter, und sie hatte noch ein zusätzliches Argument: Warum sollte sie mit Art Keller kooperieren, wenn er von den eigenen Leuten kaltgestellt war?
Und auch denen erging es nicht viel besser.
Seit zwei Jahren schon drängte die DEA die mexikanische Regierung zu einer härteren Gangart gegen die Gomeros. Die Amerikaner legten Beweise vor - Fotos, Tonbänder, Zeugenaussagen -, doch den Versprechungen der Federales folgten keine Taten, nur leere Ausflüchte. »Sie sind hier in Mexiko, Señores, solche Dinge brauchen ihre Zeit.«
Während die Beweise vergilbten, kriegten die Zeugen kalte Füße, und die Federales wechselten die Posten, so dass die Amerikaner immer wieder von vorn anfangen mussten, mit einem neuen Beamten der Federales, der von ihnen frische Beweise und unverbrauchte Zeugen verlangte - um ihnen, wenn alles geliefert war, mit größtmöglicher Herablassung zu erklären: »Sie sind hier in Mexiko, Señores, solche Dinge brauchen ihre Zeit.«
Und während das Heroin aus den Bergen nach Culiacán hereinströmte wie eine Schlammlawine im Frühling, lieferten sich die jungen Gomeros nächtliche Straßenkämpfe mit Don Pedros Leuten, so dass sich Art Keller schon nach Da Nang oder Saigon versetzt fühlte, nur wurde hier viel mehr geschossen.
Nacht für Nacht lag Keller auf dem Bett seines Hotelzimmers, trank billigen Scotch, sah Fußball oder Boxen, haderte mit seinem Schicksal.
Und hatte Sehnsucht nach Althie.
Im letzten Studienjahr hatte er Althea Patterson auf dem Campus getroffen und es mit einer ziemlich lahmen Anmache probiert: »Kennen wir uns nicht aus der Politikwissenschaft?«
Althea war groß, schlank und blond, mit eher eckigen als runden Konturen. Ihre Nase hatte einen Höcker, ihr Mund war ein bisschen zu breit, und ihre grünen Augen saßen ein bisschen zu tief in den Höhlen, so dass sie kaum als klassische Schönheit durchgehen konnte, aber schön war sie trotzdem.
Und klug. Sie studierte tatsächlich Politikwissenschaft, und er hatte sie schon diskutieren hören. Sie vertrat ihren Standpunkt (ein wenig links von Emma Goldmann) mit hitzigen Argumenten, und das reizte ihn zusätzlich.
Also trafen sie sich auf eine Pizza und fuhren danach in ihre Wohnung in Westwood. Sie machte Espresso, und beim Plaudern stellte sich heraus, dass sie aus dem alten kalifornischen Geldadel von Santa Barbara stammte und ihr Vater ein hohes Tier bei den kalifornischen Demokraten war.
Für sie war Art Keller ein irre gut aussehender Typ mit prächtiger schwarzer Mähne, einer leicht lädierten Nase, die ihm einen verwegenes Aussehen verlieh, und jener stillen Intelligenz, die dem Kind aus dem Barrio zu einem Studienplatz an der UCLA verholfen hatte. Und dann war da noch etwas - eine Aura der Einsamkeit, Verletzlichkeit, Reizbarkeit, die ihn unwiderstehlich machte.
Sie landeten ohne Umschweife im Bett, und in der postkoitalen Dunkelheit fragte er sie: »Kannst du das jetzt auf deiner linkslibertinären Wunschliste abhaken?«
»Was?«
»Das Schlafen mit einem Latino.«
Sie dachte kurz nach, dann antwortete sie. »Ich dachte immer, Latinos sind Puertoricaner. Was ich abhaken kann, ist das Schlafen mit einem Bohnenfresser.«
»Eigentlich«, sagte er, »bin ich nur ein halber Bohnenfresser.«
»Oje«, sagte sie. »Es kommt ja immer schlimmer.«
Althea bildete die Ausnahme von der YOYO-Regel; auf heimtückische Weise unterhöhlte sie seine Selbstgenügsamkeit, die ihm, als er sie kennenlernte, schon in Fleisch und Blut übergegangen war. Das Schweigen war ihm zur Gewohnheit geworden, zu einem Schutzwall, den er schon als Kind um sich errichtet hatte. Bei seiner Begegnung mit Althie genoss er auch schon den zusätzlichen Vorteil einer professionellen Ausbildung in der Disziplin der mentalen Abschottung.
Die Talent-Scouts der CIA hatten ihn im zweiten Studienjahr aufgespürt und gepflückt wie eine reife Frucht.
Sein Professor für Internationale Beziehungen, ein Exilkubaner, ging mit ihm Kaffee trinken und wurde zu seinem Berater. Professor Osuna sagte ihm, welche Fächer und welche Sprachkurse er belegen sollte. Er lud ihn auch zu sich nach Hause ein, zum Dinner, brachte ihm bei, welche Gabel wofür zu verwenden war, welchen Wein man zu wählen hatte, um welche Frauen man sich bemühen musste. (Von Althea war Professor Osuna begeistert. »Sie ist genau die Richtige«, sagte er. »Sie bringt dir Lebensart bei.«)
Es war eher eine Verführung als eine Rekrutierung.
Nicht dass Art Keller schwer zu verführen war.
Die haben einen Riecher für solche wie mich, dachte er später. Die Verlorenen, die Einsamen, die zwischen allen Stühlen sitzen und nirgends richtig dazugehören. Und ich war die perfekte Wahl - clever, straßenerprobt, ehrgeizig. Ich sah aus wie ein Weißer, aber konnte kämpfen wie ein Latino. Ich brauchte nur den gewissen Schliff, und den haben sie mir verpasst.
Dann kamen die kleinen Aufträge: »Arturo, wir haben einen Gastprofessor aus Bolivien. Könntest du den durch die Stadt begleiten?« Noch ein paar mehr Jobs dieser Art, und es hieß: »Arturo, was treibt eigentlich Dr. Echeverría in seiner Freizeit? Trinkt er? Steht er auf Mädchen? Nein? Vielleicht auf Jungs?« Als Nächstes kam: »Arturo, wenn Professor Méndez ein bisschen Marihuana will, könntest du ihm das besorgen?« - »Arturo, könntest du mir verraten, mit wem unser verehrter Dichterfreund so telefoniert?« - »Arturo, das ist eine Abhörvorrichtung. Wenn du die vielleicht in seinem Zimmer installieren könntest...«
Arturo machte alles, ohne mit der Wimper zu zucken, und er machte es gut.
Sein Ticket nach Langley bekam er praktisch zusammen mit dem Diplom ausgehändigt. Und es war eine interessante Übung, Althea diesen Umstand zu erklären. »Ich kann's dir nur andeutungsweise sagen«, orakelte er. Sie war nicht dumm, sie begriff sofort.
»Du bist ein Boxer«, sagte sie zu ihm. »Das ist die perfekte Metapher für dich.«
»Wie meinst du das?«
»Du beherrschst die Kunst, Dinge von dir fernzuhalten«, sagte sie. »Du lässt nichts an dich ran.«
Stimmt nicht, dachte Art. Dich lasse ich an mich ran.
Ein paar Wochen vor seinem Vietnam-Einsatz heirateten sie. Er schrieb ihr lange, leidenschaftliche Briefe, ohne mit einer Silbe auf seine Tätigkeit einzugehen. Als er zurückkam, war er verändert. Natürlich, dachte sie. Wie auch nicht? Aber die Verschlossenheit, die sie schon an ihm kannte, hatte sich verstärkt. Er konnte eine unendliche emotionale Distanz an den Tag legen und zugleich ableugnen, dass sie bestand. Dann wieder verwandelte er sich in den aufmerksamen, zärtlichen Mann, in den sie sich verliebt hatte.
Als er sagte, er denke über einen Berufswechsel nach, war sie erleichtert. Begeistert erzählte er ihr von der neuen Drogenbehörde, der DEA. Dort könne man gute und nützliche Arbeit leisten. Sie ermutigte ihn, den Job anzutreten, obwohl er wieder für drei Monate fort musste, nach der Rückkehr gerade mal lange genug zu Hause war, um sie zu schwängern, und dann erneut abberufen wurde, diesmal nach Mexiko.
Er schrieb ihr lange, leidenschaftliche Briefe aus Mexiko, ohne mit einer Silbe auf seine Tätigkeit einzugehen. Weil es hier nichts für mich zu tun gibt, schrieb er ihr.
Und es stimmte. Es gab nicht das Geringste für ihn zu tun, außer mit seinem Schicksal zu hadern.
Dann beweg deinen Arsch und mach irgendwas, schrieb sie zurück. Oder kündige und komm nach Hause. Daddy kann dir sofort einen Job beim Senat besorgen, du musst nur ein Wort sagen.
Keller sagte das Wort nicht.
Wohl aber bewegte er seinen Arsch und ging zu einem Heiligen.
In Sinaloa kennt jeder die Legende von Santo Jesús Malverde. Er war ein Bandit, ein verwegener Räuber, der den Reichen nahm und den Armen gab, ein mexikanischer Robin Hood. 1909 ging er den Federales in die Falle und wurde gehängt - gegenüber der Stelle, wo heute sein Schrein steht.
Der Schrein entstand wie von selbst. Erst ein paar Blumen, dann ein Bild, dann ein kleiner Bretterschuppen, den die Armen über Nacht errichteten. Sogar die Polizei hatte Angst, ihn abzureißen, weil es hieß, dass seine Seele in diesem Schuppen lebte, dass Jesús Malverde, wenn man bei ihm betete, eine Kerze anzündete, ein manda oder Sühneopfer niederlegte, seine wohltätigen Wirkungen entfalten konnte.
Dass er für eine gute Ernte sorgen, vor Feinden schützen, Kranke gesund machen konnte.
Auf den Dankzetteln, die in den Ritzen steckten, konnte man nachlesen, was Jesús Malverde an Gutem bewirkt hatte: Er hatte ein krankes Kind geheilt, das Geld für die Miete herbeigezaubert, vor Verhaftung und Strafe gerettet, für eine wohlbehaltene Rückkehr aus dem Norden gesorgt, einen Mord verhindert, einen Mord gerächt.
Keller besuchte den Schrein. Vielleicht der richtige Ort für einen Neuanfang, dachte er. Er lief von seinem Hotel zu Fuß dorthin, wartete geduldig in der Schlange der Pilger und trat schließlich ein.
An Heilige war er gewöhnt. Seine Mutter hatte ihn brav in die Kirche mitgeschleppt, zu Our Lady of Guadelupe im Barrio Logan, wo man ihm den Katechismus beigebracht, die Erstkommunion und die Firmung verpasst hatte. Er hatte zu den Heiligen gebetet, an ihren Statuen Kerzen angezündet, andächtig die Heiligenbilder betrachtet.
Auch am College war er ein gläubiger Katholik geblieben. In Vietnam war er regelmäßig zur Kommunion gegangen, zumindest am Anfang, dann erlahmte sein Eifer, und er hörte auf zu beichten. Es lief nach diesem Muster: Vater vergib mir, denn ich habe gesündigt, Vater vergib mir, denn ich habe gesündigt, Vater vergib mir, denn ich habe - verdammt, was soll der Blödsinn? Jeden Tag liefere ich Menschen dem Tod aus, jede zweite Woche töte ich mit eigenen Händen. Ich komme doch nicht hierher und erzähle euch, dass ich es nie wieder tun werde, wenn ich nach Dienstplan morde, genauso regelmäßig, wie ich zur Messe gehe.
Sal Scachi, einer von den Special Forces, besuchte jeden Sonntag die Messe, wenn er nicht gerade als Killer im Einsatz war. Art Keller nahm ihm nicht ab, dass er kein Problem mit dieser Heuchelei hatte. Eines Nachts im Suff diskutierten sie sogar darüber, Keller und der sehr italienisch wirkende Sal Scachi aus New York.
»Das juckt mich nicht«, sagte Scachi. »Dich etwa? Die Vietcongs glauben nicht an Gott, also scheiß drauf.«
Sie fingen eine wüste Diskussion an, und zu Kellers Entsetzen versteifte sich Scachi allen Ernstes auf die Behauptung, es sei »Gottes Wille«, dass sie Vietcongs massakrierten. Kommunisten sind Atheisten, beharrte Scachi, die wollen die Kirche zerstören. Und was wir hier machen, ist die Verteidigung der Kirche, das ist keine Sünde, sondern unsere Pflicht.
Er griff in sein Hemd und zeigte Keller das Medaillon des heiligen Antonius.
»Der heilige Antonius beschützt mich«, erklärte er. »Besorg dir auch so einen.«
Was Keller nicht tat.
Jetzt, in Culiacán, starrte er in die Obsidian-Augen von Santo Jesús Malverde. Die Gipshaut des Heiligen war weiß wie eine Wand, sein Schnurrbart lackschwarz, und um den Hals hatte man ihm einen blutigroten Streifen gemalt, um den Pilgern klarzumachen, dass Santo Jesús - wie jeder ordentliche Heilige - ein Märtyrer war.
Santo Jesús starb für unsere Sünden.
»Hm«, sagte Keller nachdenklich zu der Statue. »Was du anpackst, das klappt. Was ich anpacke, klappt nicht. Also ...«
Keller legte ein manda ab. Kniete nieder, zündete eine Kerze an und hinterließ einen Zwanzigdollarschein. Sei's drum.
»Hilf mir, Santo Jesus«, flüsterte er auf Spanisch. »Und wo das herkommt, gibt's noch mehr. Ich werde den Armen Geld geben.«
Auf dem Rückweg ins Hotel traf er Adán Barrera.
Keller war schon Dutzende Male an der Turnhalle vorbeigelaufen und öfter versucht gewesen, hineinzuschauen, aber an diesem Abend war drinnen besonders viel los, also trat er kurzerhand ein und stellte sich an den Rand.
Adán war da knapp zwanzig Jahre alt. Klein und fast zierlich gebaut. Langes, schwarzes, glatt zurückgekämmtes Haar, Designer-Jeans, Turnschuhe von Nike, dunkelrotes Polohemd. Teure Klamotten für dieses Barrio. Adán Barrera legte Wert auf Eleganz, das war nicht zu übersehen, und sein Blick verriet, dass ihm nichts entging.
Keller schätzte ihn auf 1,68 bis 1,70, aber der Kerl, der neben ihm stand, war mindestens 1,90 groß. Und kräftig. Massiger Brustkorb, muskulöser Hals, lange, kräftige Glieder. Man hätte sie nicht für Brüder gehalten, dazu musste man ihnen ins Gesicht sehen. Zwei verschiedene Körper, doch das gleiche Gesicht - dunkelbraune Augen, milchkaffeefarbene Haut, eher spanisch als indianisch.
Beide standen am Ring und beäugten einen Boxer, der gerade zu Boden gegangen war. Sein Gegner stand über ihm im Ring, ein Kind eigentlich noch, mit einem Körper, der aussah wie aus lebendem Stein gemeißelt. Dann der Blick - Keller hatte den im Ring schon öfter erlebt -, dieser Boxer hatte den Blick des geborenen Killers. Nur dass er jetzt ein wenig betreten dreinschaute.
Keller sah gleich, was ihm passiert war. Er hatte soeben seinen Sparring-Partner k. o. geschlagen und nun niemanden mehr, mit dem er trainieren konnte. Und die beiden Brüder waren seine Manager. In einem mexikanischen Barrio gehörten solche Szenen zum Alltag. Denn für die Kids gab es nur zwei Möglichkeiten, dem sozialen Getto zu entkommen: Drogen oder Boxen. Der Boxer im Ring war ein junger, aufstrebender Champion, daher der Andrang.
Jetzt hielt der kleinere der beiden Brüder Ausschau nach einem Boxer, der für ein paar Runden in den Ring steigen würde. Und viele junge Kerle unter den Zuschauern hatten plötzlich etwas Interessantes an ihren Schuhspitzen zu entdecken.
Aber nicht Keller.
Er fing den Blick des Kleinen auf.
»Wer bist du?«, fragte der.
Der Bruder musterte ihn kurz und sagte: »Ein Yankee-Bulle.« Dann reckte er sich und rief über die Köpfe der Zuschauer hinweg: »Vete al demonio, picaflor!«
Mit anderen Worten: Verpiss dich, du Schwuchtel!
Wie aus der Pistole geschossen erwiderte Keller: »Pela las nalgas, perra.«
Schieb's dir in den Arsch, Pissnelke.
Aus dem Mund eines Gringos klang das schon ein bisschen merkwürdig. Der große Bruder wollte sich durch die Menge schieben und auf Keller losgehen, doch der kleine hielt ihn fest und flüsterte ihm etwas zu. Der Große lächelte, dann sagte der Kleine auf Englisch zu Keller: »Du hast etwa die richtige Größe. Willst du ein paar Runden boxen?«
»Der ist doch noch ein Kind«, sagte Keller.
»Der kommt schon zurecht«, sagte der Kleine. »Und mit dir allemal.«
Keller lachte.
»Du boxt doch, oder?«, lockte der Jungchampion. »Früher mal«, sagte Keller. »Ein bisschen.«
»Na, komm schon, Yankee, wir besorgen dir ein Paar Handschuhe.«
Keller hätte ohne weiteres abwinken können. Aber der Boxsport ist heilig in Mexiko, und wenn einen Leute, an die man seit Monaten herankommen will, in ihre Kirche einladen, dann geht man hin.
»Gegen wen trete ich an?«, fragte er die Umstehenden, während ihm die Hände verbunden und in die Handschuhe geschoben wurden.
»El leoncito de Culiacan«, kam die stolze Antwort. »Der kleine Löwe von Culiacán. Der wird mal Weltmeister.« Keller stieg in den Ring.
»Nimm mich nicht zu hart ran«, sagte er. »Ich bin ein alter Mann.«
Sie hielten die Handschuhe aneinander.
Box nicht auf Sieg, sagte sich Keller. Nimm ihn nicht zu hart ran. Du willst hier Freunde gewinnen.
Zehn Sekunden später schon musste er über seinen Hochmut lachen - sofern er zwischen dem Prasseln der Hiebe dazu kam. Genauso gut hätte er gefesselt in den Ring steigen können. Wegen des Siegs muss ich mir keine Sorgen machen, sagte er sich. Und kurze Zeit später: Sieh zu, dass du hier lebend rauskommst.
Das Tempo, das dieser Junge vorlegte, war atemberaubend. Keller sah die Schläge nicht kommen, an ordentliche Deckung war nicht zu denken, an eine angemessene Gegenoffensive erst recht nicht.
Aber du musst es wenigstens versuchen. Es geht um den Respekt.
Also ließ er einem linken Haken eine gerade Rechte folgen und handelte sich dafür eine bösartige Dreierkombination ein. Bumm-bumm-bumm. Ich bin doch keine Kesselpauke, dachte Keller und wich aus.
Eine schlechte Idee.
Sein Gegner setzte ihm nach, mit zwei blitzschnellen Haken, gefolgt von einer Geraden direkt ins Gesicht, und wenn Kellers Nase nicht gebrochen war, sah sie einer gebrochenen Nasse verdammt ähnlich. Er wischte sich Blut ab, hob die Deckung und blockte das nachfolgende Trommelfeuer mit den Handschuhen, worauf der Boxer seine Rippen mit rechten und linken Haken bearbeitete.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis ihn endlich der Gong erlöste und er auf seinen Hocker plumpste.
Der große Bruder war schon da. »Hast du genug, picaßor!«
Aber es klang schon nicht mehr ganz so verächtlich.
»Ich komme langsam wieder in Form, perra«, antwortete Keller.
Aber schon nach fünf Sekunden war alles, was er an Form zu bieten hatte, aus ihm herausgedroschen. Ein heimtückischer Leberhaken schickte ihn zu Boden. Mit gesenktem Kopf schnappte er nach Luft, Blut und Schweiß tropften ihm von der Nase, aus den Augenwinkeln sah er, wie sich Zuschauer Geldscheine zuschoben, außerdem hörte er den kleinen Bruder bis zehn zählen, als wäre Kellers Niederlage schon besiegelt.
Fickt euch alle, dachte Keller.
Und stand auf.
Jubel mischte sich mit Flüchen.
Komm schon, Keller, sagte er sich. Dich einfach nur verdreschen lassen, das bringt nichts. Du musst kämpfen. Du musst sein Tempo bremsen, sonst hat er leichtes Spiel.
Keller ging zum Angriff über.
Fing sich drei schwere Treffer ein, aber arbeitete sich vor und trieb den Champ in die Seile. Er blieb dicht am Mann, traktierte ihn mit kurzen, harten Schlägen, so dass er blocken musste. Dann duckte er sich weg, versetzte ihm zwei Schwinger in die Rippen, beugte sich vor und klammerte.
Ein kleine Verschnaufpause, dachte er sich. Immer schön klammern, das macht ihn mürbe. Aber schon bevor der kleine Bruder da war, um sie zu trennen, schlüpfte der Champ unter Kellers Arm durch und versetzte ihm zwei seitliche Schläge an den Kopf.
Keller griff weiter an.
Er musste Hiebe einstecken, doch er war der Aggressor, und darauf kam es an. Der Champ wich ihm aus, tänzelte, nutzte Deckungslücken, aber er war auf dem Rückzug. Als er die Hände sinken ließ, landete Keller eine harte Linke, die ihn rückwärts taumeln ließ. Er war so verdutzt, dass Keller noch eine weitere hinterherschickte.
In den Pausen ließen ihn die beiden Brüder jetzt in Ruhe, sie mussten sich um ihren Jungstar kümmern. Keller war es recht. Noch eine Runde, dachte er. Eine Runde muss ich noch durchstehen.
Während sich Keller vom Hocker erhob, wanderten eine Menge Scheine von Hand zu Hand.
Er kreuzte mit seinem Gegner die Handschuhe zur letzten Runde, sah ihm in die Augen und wusste, dass er seinen Stolz verletzt hatte. Scheiße, dachte er. Das wollte ich nicht. Zügle dein Ego, du Arschloch, und wag es nicht, diesen Fight zu gewinnen.
Eine unnötige Sorge.
Was immer ihm die Brüder in der Pause erzählt hatten - der Champ hatte seine Lektion gelernt, bewegte sich ständig nach links, in der Richtung seiner eigenen Schläge, hielt die Hände hoch, landete beliebig viele Hiebe und wich dann aus.
Keller griff an und schlug ins Leere.
Er hörte auf.
Stand mitten im Ring, schüttelte den Kopf, lachte und winkte den Champ heran.
Die Menge war begeistert. Der Champ auch.
Er kehrte zurück in die Ringmitte und ließ seine Schläge auf Keller niederprasseln, der nur in Deckung gehen und blocken konnte. Alle paar Sekunden konnte er einen Gegenschlag landen, aber der Champ hämmerte einfach weiter auf ihn ein und nagelte ihn fest.
Jetzt war der Champ nicht mehr auf ein K. o. aus. Seine Wut war verflogen. Jetzt machte er echtes Sparring, ging in seinen Workout-Stil über und zeigte, dass er Keller jederzeit schlagen konnte, wenn er nur wollte, lieferte den Zuschauern die Show, die sie verlangten. Am Ende kniete Keller, die Handschuhe am Kopf, die Ellenbogen dicht an die Brust gepresst, so dass er die meisten Schläge abblocken konnte.
Dann der Schlussgong.
Der Champ zog Keller hoch, und sie umarmten sich. »Eines Tages bist du Weltmeister«, sagte Keller zu ihm. »Du warst in Ordnung«, sagte der Champ. »Danke für das Match.«
»Ihr habt da einen guten Mann«, sagte Keller, als ihm der kleine Bruder die Handschuhe auszog.
»Den machen wir groß«, sagte der kleine Bruder. Er streckte Keller die Hand entgegen. »Ich heiße Adán. Das ist mein Bruder Raul.«
Raúl nickte. »Du hast durchgehalten, Yankee. Das hätte ich nicht gedacht.«
Keine »Schwuchtel« diesmal, registrierte Keller. »Ich bin ja auch von allen guten Geistern verlassen.«
»Nein, nein. Du kämpfst wie ein Mexikaner«, sagte Raúl. Das höchste Lob.
Eher wie ein halber Mexikaner, dachte er, aber er behielt es für sich. Und er wusste, was Raúl meinte. Hier galt dasselbe wie im Barrio Logan: Einstecken zählt mehr als Austeilen.
Und heute hab ich reichlich eingesteckt, dachte Keller. Jetzt will ich nur eins: Zurück ins Hotel, heiß und lange duschen und die Nacht mit einem Eisbeutel verbringen.
Okay, mit mehreren Eisbeuteln.
»Wir gehen noch auf ein Bier«, sagte Adán. »Kommst du mit?«
Und ob, dachte Keller. Klar, mach ich gern. Also verbrachte er die Nacht im cafetín und trank Bier mit Adán.
Jahre später hätte er alles drum gegeben, Adán Barrera auf der Stelle zu erschießen.
Am nächsten Morgen rief ihn Tim Taylor ins Büro.
Keller sah beschissen aus, und genauso fühlte er sich. Sein Kopf dröhnte vom Bier und dem Kraut, das er irgendwann geraucht hatte, nachdem er mit Adán in einer Art Nachtclub gelandet war. Seine Augen hatten schwarze Schatten, unter seiner Nase klebte noch getrocknetes Blut. Geduscht hatte er zwar, aber das Rasieren war ausgefallen - erstens aus Zeitmangel, zweitens, weil sein geschwollenes Kinn jeden Gedanken daran zunichte machte. Und obwohl er sich äußerst behutsam auf dem Stuhl niederließ, reagierten seine zerschlagenen Rippen auf diese Zumutung mit brüllendem Schmerz.
Taylor musterte ihn mit unverhohlenem Abscheu. »Das muss ja eine tolle Nacht gewesen sein.«
Keller lächelte einfältig. Selbst das tat weh. »Sie wissen wohl schon Bescheid.«
»Wollen Sie wissen, woher?«, sagte Taylor. »Ich hatte heute Morgen eine Besprechung mit Miguel Barrera. Wissen Sie, wer das ist, Keller? Der ist hier bei der Polizei, die rechte Hand des Gouverneurs, einfach der Mann in dieser Gegend. Wir versuchen seit zwei Jahren, ihn zur Mitarbeit zu bewegen. Und nun muss ich von ihm hören, dass sich einer meiner Leute mit Einheimischen prügelt -«
»Das war ein Sparring-Match.«
»Was immer«, sagte Taylor. »Schauen Sie: Diese Leute sind nicht unsere Freunde oder unsere Saufbrüder. Die sind für uns Zielpersonen, und -«
»Vielleicht liegt da das Problem«, hörte sich Keller sagen. Mit einer irgendwie von ferne kommenden Stimme, über die er keine Macht hatte. Er hatte sich vorgenommen, die Klappe zu halten, aber dafür war er einfach zu fertig.
»Von welchem Problem reden Sie?«
Scheiß drauf, dachte Keller. Jetzt ist es zu spät. Also ließ er es raus. »Dass wir >diese Leute< als >Zielpersonen< betrachten.«
Überhaupt machte ihn das wütend. Menschen als Zielscheiben? Das kennen wir, das hatten wir schon. Außerdem habe ich in der letzten Nacht mehr gelernt als in den letzten drei Monaten.
»Hören Sie, Sie sind hier nicht als Geheimagent eingesetzt«, sagte Taylor. »Arbeiten Sie gefälligst mit den örtlichen Justizbehörden zusammen!«
»Geht leider nicht, Tim. Bis jetzt haben Sie alles getan, um mich von denen fernzuhalten.«
»Ich lasse Sie versetzen«, sagte Taylor. »Ich will Sie nicht mehr in meinem Team.«
»Dann machen Sie sich schon mal an den Papierkram«, sagte Keller. Er hatte die ganze Scheiße satt.
»Keine Sorge, das werde ich«, sagte Taylor. »Und in der Zwischenzeit, Keller, verhalten Sie sich professionell. Geben Sie sich wenigstens Mühe.«
Keller nickte und stand auf.
Ganz vorsichtig.
Statt vorm Damoklesschwert der Bürokratie zu zittern, kann ich ebenso gut weitermachen, dachte sich Keller.
Wie ging die Redensart gleich? Sie können dich umbringen, aber sie können dich nicht fressen. Was nicht stimmt, sie können beides. Doch das heißt nicht, dass du's ihnen leichtmachen musst. Der Gedanke, im Tross eines Senators arbeiten zu müssen, machte ihn krank. Nicht so sehr wegen der Arbeit, sondern wegen des Umstands, dass er diesen Job dann Althies Vater zu verdanken hatte. Und mit Vaterfiguren hatte er seine Probleme.
Was ihn antrieb, war der Gedanke des Scheiterns.
Man lässt sich nicht k. o. schlagen, man zwingt sie dazu, einen k. o. zu schlagen. Sie sollen sich die Pfoten dabei brechen, und immer, wenn sie ihre Visage im Spiegel sehen, sollen sie an dich denken.
Er ging geradewegs zur Turnhalle.
»Das war ja eine wüste Nacht!«, begrüßte er Adán. »Mir brummt der Kopf.«
»Wir haben uns prächtig amüsiert.«
Wohl wahr, dachte Keller. »Wie geht's dem kleinen Löwen?«
»Cesar? Besser als dir«, sagte Adán. »Und mir.«
»Wo ist Raul?«
»Wahrscheinlich vögelt er gerade, der alte Bock«, sagte Adán. »Willst du ein Bier?«
»Unbedingt.«
Und wie das die Kehle runterging! Keller nahm einen langen, köstlichen Schluck und drückte die eiskalte Flasche an die geschwollene Wange.
»Du siehst aus wie Scheiße«, sagte Adán.
»So gut?«
»Fast so gut.«
Adán winkte dem Kellner und bestellte eine Bratenplatte. Sie saßen draußen und ließen die Welt an sich vorüberziehen. »Du bist also Drogenbulle«, sagte Adán. »Könnte man sagen.«
»Mein Onkel ist auch Bulle.«
»Und du steckst nicht drin in dem Familienunternehmen?«
»Ich bin Schmuggler«, sagte Adán.
Keller hob die rechte Augenbraue. Selbst das tat weh.
»Jeans«, sagte Adán und lachte. »Mein Bruder und ich, wir fahren nach San Diego, kaufen Jeans und schmuggeln sie über die Grenze. Verkaufen sie zollfrei von der Ladefläche runter. Du würdest staunen, wie viel das bringt.«
»Ich dachte, du studierst am College. Was war das gleich? Rechnungswesen?«
»Man braucht auch Geld zum Rechnen«, sagte Adán.
»Weiß dein Onkel, womit du dir dein Bier verdienst?«
»Tio weiß alles«, sagte Adán. »Er findet, das ist unter meiner Würde. Ich soll was >Ernstes< machen. Aber das Jeansgeschäft läuft gut. So kriegen wir Geld rein, bis das mit dem Boxen richtig losgeht. Wenn Cesar groß rauskommt, machen wir Millionen.«
»Hast du's auch schon mal mit Boxen versucht?« Adán schüttelte den Kopf. »Ich bin klein, aber zu langsam. Raúl ist der Kämpfer in unserer Familie.«
»Na, ich glaube, gestern war mein letztes Match.«
»Da bist du gut beraten.« Beide lachten.
Komisch, wie Freundschaften entstehen.
Noch Jahre später dachte Keller daran. Ein Sparring-Match, eine durchzechte Nacht, ein Nachmittag im Straßencafe. Geplänkel über Träume und Wünsche, bei Tapas und Bier. Blödeleien, Gelächter.
Er dachte auch an die Erkenntnis, die ihm dabei gekommen war: Vor Adán hatte er nie einen richtigen Freund gehabt.
Er hatte Althie. Aber das war etwas anderes.
Man kann seine Frau zwar als besten Freund bezeichnen, aber das ist nicht dieses Männerding, der Bruder-den-man-nie-hatte, der Typ-mit-dem-man-rumhängt.
Schwer zu verstehen, wie das kommt.
Vielleicht sah Adán in Art Keller etwas, was er an seinem eigenen Bruder vermisste - eine Intelligenz, eine Ernsthaftigkeit, eine Reife, die er selbst nicht besaß, aber anstrebte. Und vielleicht sah Keller in Adán ... also, er hat dann später Jahre gebraucht, das zu erklären, auch sich selbst. Es lief einfach, wie es lief, in jenen Tagen. Adán Barrera war ein guter Kerl. Ganz sicher. Zumindest sah es so aus. Egal, was alles in ihm geschlummert haben mochte...
Vielleicht schlummert so etwas in uns allen, dachte Keller später.
In mir auf jeden Fall.
Das Gespür des Bluthunds.
Und natürlich war es Adán, der ihn mit Tío zusammenbrachte.
Sechs Wochen später lag Keller auf seinem Hotelbett, sah Fußball und fühlte sich beschissen, weil Tim Taylor gerade das Okay bekommen hatte, ihn zu versetzen. Vermutlich nach Iowa, dachte Keller. Damit ich kontrolliere, ob sich die Drugstores beim Verkauf von Hustentropfen an die gesetzlichen Bestimmungen halten.
Aus und vorbei mit der Karriere.
Während er diesen trüben Gedanken nachhing, klopfte jemand an die Tür.
Ein Mann mit schwarzem Anzug, weißem Hemd und schwarzer Krawatte. Das Haar auf altmodische Art zurückgekämmt, Lippenbärtchen, Augen schwarz wie die Nacht.
Vielleicht vierzigjährig, mit der Würde eines Gentleman.
»Verzeihen Sie die Störung, Señor Keller«, sagte er. »Mein Name ist Miguel Ángel Barrera. Polizei des Bundesstaats Sinaloa. Darf ich Sie einen Moment sprechen?«
Und ob du darfst, dachte Keller und bat ihn herein. Zum Glück hatte er noch einen Rest Scotch, so dass er dem Mann wenigstens einen Drink anbieten konnte. Barrera nahm das Glas entgegen und bot ihm eine dünne schwarze kubanische Zigarre an.
»Ich habe aufgehört«, sagte Keller.
»Macht es Ihnen was aus?«
»Ich freue mich, wenn's Ihnen schmeckt«, antwortete Keller. Er kramte nach einem Aschenbecher, dann setzten sich die beiden Männer an den kleinen Tisch, der am Fenster stand. Barrera musterte Keller ein paar Sekunden, als würde er nachdenken, dann sagte er: »Mein Neffe hat mich gebeten, Sie zu besuchen.«
»Ihr Neffe?«
»Adán Barrera.«
»Ich verstehe.«
Mein Onkel ist Bulle, hatte er gesagt. Das ist also »Tio«.
»Adán hat mich zu einem Match mit einem erstklassigen Boxer verführt.«
»Adán hält sich für einen Manager«, sagte Tío. »Und Raúl glaubt, er sei ein Trainer.«
»Sie machen ihre Sache gut«, sagte Keller. »Mit Cesar können sie es weit bringen.«
»Cesar gehört mir«, sagte Barrera. »Aber ich bin geduldig. Ich lasse meine Neffen spielen. Bald muss ich einen richtigen Manager und einen richtigen Trainer für Cesar anheuern. Für Cesar nur das Allerbeste. Er wird Champion.«
»Da wird Adán aber enttäuscht sein.«
»Wer ein Mann werden will, muss lernen, mit Enttäuschungen zu leben«, sagte Barrera. Kein schlechter Spruch.
»Adán erwähnte, dass Sie in beruflichen Schwierigkeiten stecken.«
Was soll ich dazu sagen?, fragte sich Keller. Wenn Taylor das hört, kommt er mir mit dem Spruch, dass man seine schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit wäscht, und recht hat er. Aber beißt sich vor Wut in den Arsch, weil Barrera nicht mit ihm spricht, sondern mit seinem Untergebenen.
»Mein Chef und ich sind nicht immer einer Meinung.«
Barrera nickte. »Die Optik von Señor Taylor ist manchmal etwas beschränkt. Er hat immer nur Pedro Aviles im Auge. Das ist das Problem mit Ihrer DEA, wenn Sie mir verzeihen. Sie denken zu amerikanisch. Ihre Kollegen verstehen nichts von unserer Kultur. Sie verstehen nicht, wie die Dinge ineinandergreifen. Wie sie ineinandergreifen müssen.«
Da hat der Mann nicht unrecht, dachte Keller. Unser Vorgehen hier unten ist plump und schwerfällig, um das Mindeste zu sagen. Die typische amerikanische Ignoranz: »Wir wissen schon, wie man das regelt - Achtung, jetzt kommen wir!« Klar. Hat ja auch wunderbar funktioniert in Vietnam.
Keller antwortete auf Spanisch: »Was uns an Sachverstand fehlt, kompensieren wir durch unseren Mangel an Sachverstand.«
»Sind Sie Mexikaner, Señor Keller?«, fragte Barrera.
»Halb«, erwiderte Keller. »Meine Mutter ist Mexikanerin, übrigens aus Sinaloa, aus Mazatlan.«
Kein Problem, dachte Keller, ich bin mir nicht zu fein, diese Karte auszuspielen.
»Aber Sie sind im Barrio aufgewachsen«, sagte Barrera. »In San Diego?«
Das ist keine Unterhaltung, dachte Keller, das ist ein Einstellungsgespräch.
»Kennen Sie San Diego?«, fragte er. »Ich komme aus der 30th Street.«
»Aber Sie haben sich von den Gangs ferngehalten.«
»Ich habe geboxt.«
Barrera nickte und redete auf Spanisch weiter. »Sie wollen die Gomeros bekämpfen«, sagte Barrera. »Wir auch.«
»Keine Frage.«
»Aber als Boxer«, sagte Barrera, »wissen Sie, dass man nicht geradewegs auf den Knockout zusteuern darf. Man muss seinen Gegner stellen, man muss ihn zermürben, ihn in die Enge treiben. Den Knockout geht man erst an, wenn die Zeit dafür gekommen ist.«
Nun, so viele Knockouts hatte ich nicht, dachte Keller, aber die Theorie stimmt. Wir Yankees wollen den Knockout sofort, und dieser Mann hier erklärt mir, dass der Gegner noch gar nicht gestellt ist.
Was nur vernünftig ist.
»Was Sie sagen, überzeugt mich«, sagte Keller. »Leider ist Geduld nicht gerade die größte Tugend der Amerikaner. Aber wenn meine Vorgesetzten irgendwelche Fortschritte sehen würden, wenn Sie sähen, dass etwas in Bewegung kommt -«
»Mit Ihren Vorgesetzten ist es schwierig«, sagte Barrera. »Sie haben keine...«
Er sucht nach dem rechten Wort.
Keller hilft nach: »Falta gracia.«
»Genau. Keine Manieren«, stimmt ihm Barrera zu. »Wenn wir mit jemandem arbeiten könnten, der simpático ist, un compañero wie Sie...«
So also, denkt Keller. Adán hat seinen Onkel gebeten, meinen Arsch zu retten, und jetzt hat der Onkel gemerkt, dass es sich lohnt. Er ist ein geduldiger Onkel, lässt seine Neffen spielen, aber er ist auch ein ernsthafter Mensch mit klaren Zielen, und ich könnte ihm dabei behilflich sein, diese Ziele zu erreichen.
Auch das ist nur vernünftig. Aber ein schlüpfriger Pfad. Ungemeldete Kontakte? Streng verboten. Kooperation mit einem der wichtigsten Männer in Sinaloa, und das auf eigene Faust? Eine Zeitbombe. Dafür können sie mich auf der Stelle feuern.
Andererseits: Was habe ich zu verlieren?
Keller füllte die Gläser nach. »Ich würde ja gern mit Ihnen arbeiten«, sagte er. »Aber es gibt da gewisse Probleme.«
Barrera zog die Schultern hoch. »Als da wären?«
»Ich gehe weg von hier. Ich soll versetzt werden.«
Barrera schlürfte seinen Whiskey und tat höflicherweise so, als würde er ihn genießen, obwohl sie beide wussten, dass es billiger Dreck war. »Kennen Sie den wichtigsten Unterschied zwischen Amerika und Mexiko?«, fragte er.
Keller schüttelte den Kopf.
»In Amerika hängt alles am System«, sagte Barrera. »In Mexiko hängt alles an den persönlichen Beziehungen.«
Und er bietet sie mir an, dachte Keller. Persönliche Beziehungen. Eine Art Symbiose.
»Señor Barrera -«
»Ich heiße Miguel Angel«, sagte Barrera. »Aber meine Freunde nennen mich Tio.« Tío wie Onkel.
In Mexiko, dachte Keller, ist das nicht nur der leibliche Onkel, sondern auch eine Vaterfigur, ein großer Bruder, der einen unter seine Fittiche nimmt.
Eine Art Pate.
»Tio ...«, versuchte sich Keller zaghaft.
Barrera lächelte und nahm den Tribut mit einer leichten Neigung des Kopfes entgegen.
Dann sagte er: »Arturo, mi sobrino ...«
Arthur, mein Neffe...
Du wirst nirgendwohin versetzt.
Außer nach oben.
Kellers Versetzung wurde am nächsten Nachmittag widerrufen. Wieder musste er zu Taylor ins Büro. »Wer zum Teufel protegiert Sie?« Keller zuckte die Schultern.
»Ich hab mir gewaltigen Ärger eingehandelt, direkt aus Washington«, sagte Taylor. »Ist das irgendeine CIA-Machenschaft? Stehen Sie bei denen immer noch auf der Gehaltsliste? Für wen arbeiten Sie, Keller? Für die oder für uns?«
Für mich, dachte Keller. Aber er hielt den Mund und schluckte den Rüffel. Dann sagte er: »Ich arbeite für Sie, Tim. Ich lasse mir DEA auf den Arsch tätowieren. Wenn Sie wollen, auch ein Herzchen mit Ihrem Namen drin.«
Taylor starrte ihn an, quer über den Schreibtisch, und fragte sich offenbar, ob Keller ihn auf den Arm nahm und wie er darauf reagieren sollte. »Ich habe Anweisung, Ihnen in allem freie Hand zu lassen«, sagte er im Ton bürokratischer Neutralität. »Wollen Sie wissen, wie ich die Sache sehe?«
»Dass ich mir den eigenen Strick drehe.«
»Genau.«
War auch nicht schwer zu erraten.
»Ich werde Ihnen zuarbeiten, Tim«, sagte Keller und stand auf. »Ich werde dem Team zuarbeiten.«
Aber beim Hinausgehen, konnte er sich nicht verkneifen, zu singen, wenn auch nur leise: »I'm an old cowhand, from the Rio Grande. But I can't poke a cow, becouse I don't know how.«
Eine Ehe, in der Hölle geschlossen.
So hat Keller die Sache gesehen, als es zu spät war. Art Keller und Tío Barrera.
Sie trafen sich selten und nur insgeheim. Tío suchte seine Ziele sorgfältig aus. Keller konnte verfolgen, wie da etwas entstand oder - genauer - auseinanderbrach, während Barrera unter Mithilfe von Keller und der DEA daranging, eine Bresche nach der anderen in das Imperium von Don Pedro zu schlagen. Erst ein einträgliches Mohnfeld, eine Opiumküche, ein Labor, dann zwei junge Gomeros, drei kriminelle Provinzpolizisten, ein Bundespolizist, der von Don Pedro mordida nahm - Bestechungsgeld.
Barrera hielt sich von alldem fern, war nie direkt beteiligt, reklamierte nichts für sich, benutzte Keller nur als Keule, doch trotzdem sah sich Keller nicht als Marionette in seinen Händen. Er benutzte die Quellen, die Barrera ihm preisgab, um andere Quellen anzuzapfen, seinen Einfluss auszubauen, ein krebsartig wucherndes Netzwerk von Zuträgern zu schaffen. Aus einer Quelle wurden zwei, aus zwei wurden fünf, aus fünf wurden ...
Nun, neben allem Guten gab es auch die endlosen Reibereien mit den DEA-Leuten. Tim Taylor bestellte Keller mindestens ein halbes Dutzend Mal zum Rapport. Woher haben Sie Ihre Informationen, Keller? Wer ist Ihre Quelle? Haben Sie Zuträger? Wir sind ein Team, Keller. Da gibt es keine Alleingänge.
Doch, wenn es um den Sieg geht, dachte Keller. Und darum geht es jetzt. Wir können siegen. Wir durchdringen die Strukturen, spielen die Gomeros gegeneinander aus, zeigen den Campesinos von Sinaloa, dass die Herrschaft der Drogenbarone zu Ende geht. Also erzählte er Taylor gar nichts.
Er musste zugeben, es war auch ein bisschen Häme dabei. Fick dich, Tim. Dich und dein Team.
Während sich Tío Barrera wie ein Champion durch den Ring bewegte. Immer als Angreifer, ohne sich Blößen zu geben. Während er seine Treffer anbahnte, aber erst landete, wenn er nichts riskierte. Während er Don Pedro bis zur Erschöpfung vor sich her trieb, in die Knie zwang, in die Ecke drängte, dann -
Der K.-o.-Schlag.
Operation Condor.
Der Militärschlag mit Luftunterstützung, mit Bomben und Entlaubungsgiften. Aber es war Art Keller, der den Einsatz dirigierte, ganz so, als hätte er eine Landkarte mit allen Mohnfeldern, Opiumküchen und Labors vor sich, was beinahe auch stimmte.
Jetzt hockt Keller im Gebüsch und wartet auf den Hauptgewinn.
Trotz aller Erfolge, die Condor schon erbracht hat, ist die DEA auf ein einziges Ziel fixiert: Don Pedro. Wo ist Don Pedro? Bring uns Don Pedro. Wir müssen el patrón erwischen. Mehr kriegt Keller nicht von ihnen zu hören.
Als wäre die ganze Operation für die Katz, wenn wir uns seinen Kopf nicht als Trophäe an die Wand hängen können. Tausende Hektar Mohn zerstört, die ganze Infrastruktur der Gomeros verwüstet, aber was wir wollen, ist dieser alte Mann - als Symbol unseres Erfolgs.
Da rennen sie nun umher wie aufgescheuchte Hühner, laufen jedem Gerücht, jedem noch so kleinen Hinweis nach, und kommen doch immer, wie Taylor das ausdrücken würde, die entscheidende Sekunde zu spät. Dabei ist sich Keller gar nicht mal sicher, ob Taylor wirklich will, dass ihnen Don Pedro in die Falle geht, oder ob er Keller diesen Triumph missgönnt.
Keller war im Jeep unterwegs, die verkohlten Reste eines großen Heroinlabors besichtigen, als Tío Barrera mit einem kleinen Konvoi von DFS-Soldaten aus dem Rauchvorhang herausgerollt kam.
Was wollen die denn hier? wunderte sich Keller. Die Dirección Federal de Seguridad ist wie eine Kombination aus CIA und FBI, nur mächtiger. Die Jungs von der DFS haben in Mexiko praktisch freie Hand bei allem, was sie tun. Doch Tío Barrera ist eigentlich nur ein Offizier der Provinzpolizei. Was zum Teufel hat er mit dieser Elitetruppe der DFS zu tun, die er offenbar auch noch befehligt? Als sich ihre Jeeps begegneten, beugte sich Tío zu Keller hinüber und sagte: »Ich glaube, jetzt sollten wir uns Don Pedro schnappen.«
Mit anderen Worten: Er bot Keller die größte Trophäe des Drogenkriegs an, als handelte es sich um einen Billigartikel.
»Sie wissen, wo er ist?«, fragte Keller.
»Noch besser«, sagte Tío. »Ich weiß, wo er bald ist.«
Deshalb hockt Keller jetzt im Gebüsch und wartet, dass ihm der Alte in die Falle geht. Er spürt Tíos Blicke auf sich, schaut zu ihm hinüber und sieht, dass Tío demonstrativ auf die Uhr schaut.
Keller versteht die Botschaft. Es kann jeden Moment losgehen.
Der Mercedes-Cabrio von Don Pedro Aviles rumpelt langsam über den ungepflasterten Schleichweg. Sie kommen aus dem brennenden Tal und wollen den Berg hinauf. Wenn sie es zur anderen Seite schaffen, sind sie in Sicherheit.
»Pass bloß auf«, sagt Don Pedro zu dem jungen Gúero, der neben ihm am Steuer sitzt. »Achte gefälligst auf die Schlaglöcher. Das ist ein teures Auto.«
»Wir müssen hier weg, patron«, erwidert Gúero.
»Das weiß ich selbst«, schnauzt Don Pedro zurück. »Aber warum auf dieser Straße? Du ruinierst mein Auto.«
»Weil hier kein Militär ist«, erklärt ihm Gúero. »Keine Bundespolizei, keine Provinzpolizei.«
»Woher weißt du das so genau?«, fragt er misstrauisch.
»Von Barrera persönlich«, sagt Gúero. »Er hat diese Route freigemacht.«
»Das ist ja wohl das Mindeste für die Unsummen, die ich zahle.«
An Gouverneur Cerro, an General Hernández. Barrera kommt regelmäßig wie eine Monatsblutung, um das Geld zu kassieren. Geld für die Politiker, Geld für die Generäle. So ist es immer gewesen, seit Don Pedros Kindheit, seit er das Geschäft bei seinem Vater gelernt hat.
Und es wird auch immer diesen periodischen Kehraus geben, die rituellen Säuberungen, die Mexico City auf Geheiß der Yankees veranstaltet. Diesmal gegen das Versprechen höherer 01-preise, und Gouverneur Cerro hat Barrera losgeschickt, um Don Pedro folgende Botschaft zukommen zu lassen: Investiere in Öl, Don Pedro. Trenn dich vom Opiumgeschäft und steck das Geld ins Öl. Bald steigen die Ölpreise. Und das Opium ...
Also hab ich den jungen Dummköpfen die Mohnfelder verkauft und das Geld ins Ölgeschäft gesteckt. Und Cerro schickt die Yankees los, damit sie die Mohnfelder anzünden. Eine Arbeit, die ihnen die Sonne sonst abgenommen hätte. Denn das ist der große Witz: Die starten ihre Operation Condor just in dem Moment, wo die Jahre der großen Dürre einsetzen.
Er hat es am Himmel beobachtet in den vergangenen zwei Jahren. An den Bäumen gesehen, am Gras, an den Vögeln. Die große Dürre steht bevor. Fünf Jahre Missernten, bis der Regen wiederkommt.
»Wenn es die Yankees nicht gemacht hätten, hätte ich die Felder angezündet«, sagt Don Pedro zu Gúero. »Um den Boden zu verjüngen.«
Sie ist also eine Farce, diese Operation Condor. Ein Witz, ein Mummenschanz.
Aber trotzdem muss er raus aus Sinaloa.
Aviles ist nicht dreiundsiebzig Jahre alt geworden, weil er sorglos in den Tag hinein gelebt hat. Also lässt er Gúero den Cabrio steuern, und fünf seiner besten Sicarios - oder Wachmänner - im Auto folgen. Männer, deren Familien in Culiacán wohnen, auf Don Pedros Anwesen, und sämtlich sterben müssen, wenn Don Pedro irgendwas passiert.
Und Gúero, sein Eleve, sein Vertrauter. Ein Waisenkind aus den Straßen von Culiacán, das er zu sich nahm - als manda für Santo Jesús Malverde, den Schutzheiligen aller Gomeros von Sinaloa. Gúero, den er ins Geschäft einführte, dem er alles beibrachte. Ein junger Mann inzwischen, der ihm immer zur Seite steht, katzenschlau, mit der Fähigkeit, gewaltige Zahlen im Kopf zu multiplizieren, aber leider den Mercedes viel zu schnell über diese schlechte Straße jagt.
»Langsamer!«, ruft Aviles.
Gúero - so heißt er wegen seiner blonden Haare - muss lachen. Der Alte sitzt auf seinen Millionen und gackert wie eine Henne, wenn er eine Werkstattrechnung bezahlen soll. Er kann auf diesen Mercedes jederzeit verzichten, ohne dass es ihm wehtut, trotzdem regt er sich auf wegen der paar Pesos, die es kostet, den Wagen zu waschen.
Gúero stört sich nicht daran, er ist es gewöhnt.
Und fährt langsamer.
»Wir sollten Malverde ein manda bringen, wenn wir nach Culiacán kommen«, sagt Don Pedro.
»In Culiacán können wir nicht bleiben«, sagt Gúero. »Dort sind die Yankees.«
»Zur Hölle mit den Yankees.«
»Barrera hat uns geraten, nach Guadalajara auszuweichen.«
»Ich hasse Guadalajara«, sagt Don Pedro. »Ist doch nur vorübergehend.«
Sie kommen zu einer Kreuzung, und Gúero biegt links ein.
»Du musst nach rechts«, sagt Don Pedro.
»Nein, nach links, patron«, sagt Gúero.
Da muss Don Pedro aber lachen. »Ich schmuggle Opium aus diesen Bergen, seit dein Großvater deine Großmutter an der Hose gezupft hat. Du fährst nach rechts!«
Gúero zuckt die Schultern, wendet den Mercedes und fährt nach rechts.
Die Straße wird schmal und schlammig.
»Langsam«, sagt Don Pedro. »Ganz langsam, aber nicht anhalten.«
In einer scharfen Rechtskurve, die durch dichtes Gebüsch führt, nimmt Gúero den Fuß vom Gas.
»Was denn jetzt, zum Teufel?«, ruft Don Pedro. Gewehrläufe ragen aus dem Gebüsch. Acht, neun, zehn und mehr. Dahinter noch zehn weitere.
Dann sieht Don Pedro jemanden auf der Straße stehen, es ist Barrera in seinem schwarzen Anzug, und er weiß, dass alles in Ordnung ist. Die »Festnahme« ist nur eine Show für die Amerikaner. Wenn er überhaupt ins Gefängnis kommt, ist er morgen wieder draußen.
Langsam steht er auf und hebt die Hände.
Befiehlt seinen Männern, das Gleiche zu tun.
Gúero Méndez rutscht unauffällig vom Sitz, auf den Boden des Wagens.
Keller kommt aus seinem Versteck.
Er nimmt Don Pedro in Augenschein, der in seinem Auto steht, die Hände erhoben und zitternd vor Kälte.
Er sieht gebrechlich aus, denkt Keller. Ein Windstoß könnte ihn umwerfen. Weiße Bartstoppeln, tief liegende, übermüdete Augen. Ein schwacher alter Mann am Ende seines Wegs.
Es scheint fast grausam, ihn zu verhaften, aber ...
Tío nickt.
Seine Leute eröffnen das Feuer.
Die Kugeln schütteln Don Pedro wie ein dünnes Bäumchen. »Was soll das?«, brüllt Keller. »Er will sich doch -« Seine Stimme geht im Lärm der Schüsse unter.
Gúero duckt sich tief unters Lenkrad und presst die Hände an die Ohren, dieser Lärm ist unglaublich. Das Blut des Alten tropft wie weicher Regen auf seine Hände, auf den Kopf, in den Nacken. Aber trotz des Lärms hört er Don Pedros Gezeter.
Wie ein altes Weib, das einen Hund aus dem Hühnerstall verjagt-
Dann endlich Stille.
Gúero wartet zehn lange Sekunden, bevor er wagt, den Kopf zu heben.
Er sieht Polizisten aus dem Dickicht hervorbrechen. Hinter ihm das Auto mit den fünf toten Sicarios, aus der zerschossenen Tür läuft Blut wie Wasser aus der Regenrinne.
Und neben ihm liegt Don Pedro.
Sein Mund und ein Auge stehen offen.
Das andere Auge fehlt.
Sein Körper sieht aus wie diese billigen Geduldsspiele, bei denen man kleine Kugeln in Löcher rollen muss, nur dass es sehr, sehr viel mehr Löcher sind. Und er ist übersät mit den Splittern der Frontscheibe, so dass er aussieht wie der überzuckerte Bräutigam auf einer teuren Hochzeitstorte.
Gúero stellt sich vor, wie wütend Don Pedro wäre, wenn er seinen Mercedes sähe.
Der Mercedes ist ruiniert.
Als Keller die Wagentür öffnet, fällt Don Pedro heraus.
Mit Staunen sieht er, dass der alte Mann noch atmet. Wenn wir jetzt einen Hubschrauber kriegen, denkt er, besteht vielleicht die Chance, dass er -
Tío tritt hinter ihn, schaut sich den Alten an und ruft: »Halt, oder ich schieße!«
Er zieht eine 45er, richtet sie auf den Hinterkopf des patrón und drückt ab.
Don Pedro zuckt hoch und sinkt zurück.
»Er hat nach seiner Waffe gegriffen«, sagt Tío zu Keller.
Keller antwortet nicht.
»Er hat nach seiner Waffe gegriffen«, wiederholt Tío. »Alle haben sie nach ihren Waffen gegriffen.«
Keller sieht sich die Leichen an, die jetzt auf dem Boden verstreut liegen. Die DFS-Leute sammeln die Waffen der Toten ein und feuern in die Luft. Rote Blitze schießen aus den Gewehrmündungen.
Das war keine Festnahme, sagt sich Keller. Das war eine Hinrichtung.
Der schmächtige blonde Fahrer kriecht aus dem Auto, kniet sich auf den blutgetränkten Boden und hebt die Hände. Er zittert - ob es die Angst ist oder die Kälte oder beides, weiß man nicht. Du würdest genauso zittern, sagt sich Keller, wenn du wüsstest, dass du gleich erschossen wirst.
Aber genug ist genug.
Er stellt sich zwischen Tío und den knienden jungen. »Tio -« Da sagt Tío: »Levantate, Gúero.« Der Junge rappelt sich hoch. »Dios le bendiga, patron.« Gott segne dich. Patrón. Boss.
Jetzt erst versteht Keller. Das war weder eine Festnahme noch eine Hinrichtung.
Das ist ein Bandenkrieg.
Tío hat die Pistole weggesteckt und eine seiner dünnen schwarzen Zigarren anzündet. Als er sieht, dass Keller ihn anstarrt, zeigt er mit dem Kinn auf Don Pedros Leiche: »Sie haben bekommen, was Sie wollten.«
»Sie auch.«
Tío zuckt die Schulter. »Nehmen Sie Ihre Trophäe mit.«
Keller geht zu seinem Jeep und holt einen Regenponcho. Behutsam wickelt er Don Pedros Leiche hinein, fasst mit beiden Armen unter und hebt ihn hoch. Der alte Mann wiegt so gut wie nichts.
Keller trägt ihn zu seinem Jeep und legt ihn auf die Rückbank. Steigt ein und bringt die Trophäe zum Basiscamp. Condor oder Phoenix, wo ist der Unterschied? Hölle bleibt Hölle, egal, wie du sie nennst.
Ein Alptraum reißt Adán Barrera aus dem Schlaf. Ein rhythmisch dröhnender Bass.
Er rennt aus der Hütte und sieht riesige Libellen am Himmel, die sich beim zweiten Hinsehen in Hubschrauber verwandeln. Und niederstoßen wie die Geier.
Geschrei, aufheulende Motoren, Pferdegetrappel. Da laufen Soldaten und schießen. Adán greift sich einen Campesino und befiehlt ihm: »Versteck mich!« Der zieht ihn in eine Hütte. Adán versteckt sich unter dem Bett, bis das Strohdach in Flammen aufgeht. Er muss hinaus und wird empfangen von Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten.
Was zum Teufel ist hier los?
Und sein Onkel - sein Onkel wird toben. Tío hat ihnen eingeschärft, sich zu verdrücken, nach Tijuana oder San Diego, ganz egal, Hauptsache weg. Aber sein Bruder Raúl musste unbedingt nach Badiraguato, zu diesem Mädchen, es sollte eine Party steigen, und da durfte auch Adán nicht fehlen. Jetzt steckt Raúl wer weiß wo, und ich, denkt Adán, bin von Bajonetten umringt.
Tío hat die beiden nach dem Tod ihres Vaters praktisch großgezogen, da war Adán vier. Und Tío Ángel, selbst kaum erwachsen, übernahm die Verantwortung für sie, redete mit ihnen wie ein Vater, sorgte für sie und sah zu, dass etwas aus ihnen wurde.
Mit Tíos Aufstieg bei der Polizei stieg auch der Wohlstand der Familie, und als Adán den Kinderschuhen entwuchs, pflegte er schon einen soliden bürgerlichen Lebensstil. Im Unterschied zu den Gomeros waren die Barrera-Brüder Stadtkinder - sie wohnten in Culiacán, gingen dort zur Schule, fuhren zu den Poolpartys ihrer Freunde, zu den Strandpartys in Mazatlán. Die heißen Sommermonate verbrachten sie häufig auf Tíos Hazienda in der kühlen Gebirgsluft von Badiraguato, wo sie mit den Kindern der Campesinos spielten.
Wunderschöne Kindheitstage waren das. Sie fuhren mit dem Fahrrad zu den Bergseen, sprangen im Steinbruch von den Granitfelsen ins smaragdgrüne Wasser, faulenzten auf der großen Veranda des Hauses, während ein Dutzend Tanten sie verwöhnten, ihnen Tortillas brachten, Albóndigas und auch Adáns Lieblingsleckerei - frischen Pudding mit einer dicken Karamelkruste.
Adán liebte los campesinos.
Sie wurden zu einer großen, liebevollen Familie für ihn. Seine Mutter war ihm seit dem Tod des Vaters entfremdet, sein Onkel immer ernst und geschäftsmäßig. Aber die Campesinos schenkten ihm die Wärme der Sommersonne.
Es war so, wie der Pfarrer seiner Kindheit, Padre Juan, unablässig predigte: »Christus ist mit den Armen.«
Sie mussten so hart arbeiten, stellte der kleine Adán fest - auf den Feldern, in den Küchen, an den Waschtrögen, und hatten so viele Kinder, aber wenn sie von der Arbeit kamen, fanden sie immer noch Zeit, die Kinder in den Arm zu nehmen, mit ihnen zu spielen und zu scherzen.
Adán liebte die Sommerabende über alles, wenn die Familien zusammensaßen, die Frauen kochten, die Kinder in lärmenden, ausgelassenen Horden umherrannten, die Männer beim Bier ihre Witze machten, über die Ernte redeten, das Wetter, das Vieh. Sie aßen alle zusammen an großen Tischen unter alten Eichen, und es wurde still, wenn sie sich mit gebotenem Ernst ihrer Mahlzeit widmeten. War der erste Hunger gestillt, ging das Geschnatter wieder los - die Witze, die Sticheleien, das Gelächter. Und wenn dann der lange Sommerabend in die Nacht überging und die Luft kühl wurde, setzte sich Adán so nahe, wie es nur ging, zu den leeren Stühlen, die dann bald von den Männern mit ihren Gitarren besetzt wurden. Er saß dann buchstäblich zu ihren Füßen, wenn sie die tambora sangen, lauschte hingerissen ihren Liedern über die gomeros und bandidas und revolucionarios, die Helden von Sinaloa, die die Legenden seiner Kindheit bevölkerten.
Irgendwann erinnerten die Männer daran, dass die Sonne bald aufgehen würde, und die Tanten scheuchten Adán und Raúl zurück zur Hazienda, wo sie auf dem mit Fliegengittern geschützten Balkon schliefen, in Betttüchern, die die Tanten mit kaltem Wasser besprenkelt hatten.
Meistens kamen dann noch die abuelas - die alten Frauen, die Großmütter - und erzählten ihnen Geschichten von Hexen, Gespenstern und Geistern, die sich in Eulen, Falken, Adler, Schlangen, Echsen, Füchse und Wölfe verwandelten. Geschichten von einfältigen Burschen, die sich von der Hexenliebe bezaubern ließen, in ihrer blinden Verliebtheit gegen Pumas und Wölfe kämpften, gegen Riesen und Gespenster, um die Gunst ihrer Angebeteten zu gewinnen - und zu spät bemerkten, dass sie sich in eine böse alte Hexe verliebt hatten oder eine Eule oder eine Füchsin.
Adán schlummerte unter diesen Geschichten ein und schlief wie ein Stein, bis ihn die Morgensonne wachkitzelte und ein neuer wunderschöner Sommertag begann - mit dem Duft von frischen Tortillas, von machaca, chorizo und großen süßen Orangen.
Jetzt riecht der Morgen nach Brand und Gift.
Soldaten stürmen durchs Dorf, zünden Strohdächer an, zerstören die Lehmwände mit ihren Gewehrkolben.
Leutnant Navarres von den Federales hat eine Stinklaune. Die DEA-Agenten aus Amerika sind unzufrieden - sie haben keine Lust auf die kleinen Fische, sie wollen die Drahtzieher und gehen ihm damit auf die Nerven, weil sie glauben, dass er ihre Verstecke kennt, dass er sie in Sicherheit gebracht hat.
Sie haben eine Menge Leute verhaftet, aber nicht die wichtigen. Sie suchen nach García Ábrego, nach Chalino Guzmán alias el Verde, nach Jaime Herrera und nach Rafael Caro, und alle scheinen sie entwischt zu sein.
Vor allem aber suchen sie Don Pedro.
El patrón.
»Wir spielen doch hier nicht Ich sehe was, was du nicht siehst, oder?«, hat ihn ein DEA-Mann mit blauer Basecap gefragt. Genau das macht Navarres wütend, die ewige Unerstellung der Yankees, alle mexikanischen Polizisten würden la mordida kassieren, sich schmieren lassen oder, wie die Amerikaner sagen, »die Hand aufhalten«.
Navarres ist also wütend, er fühlt sich gedemütigt, und so etwas macht einen stolzen Mann zu einem gefährlichen Mann.
Da fällt sein Blick auf Adán.
Designer-Jeans, Nike-Schuhe, modischer Haarschnitt. Er sieht sofort, dass dieser Hänfling kein Campesino ist, sondern einer von den reichen Gomero-Kids aus Culiacán.
»Leutnant Navarres, Bundespolizei«, sagt er. »Wo ist Don Pedro Aviles?«
»Keine Ahnung, ich bin Student«, sagt Adán, bemüht, so harmlos wie möglich zu klingen.
Navarres grinst. »Und was studierst du?«
»Wirtschaft«, antwortet Adán. »Rechnungswesen.«
»Ein Buchhalter«, sagt Navarres. »Und wie rechnest du ab? In Kilos?«
»Nein«, sagt Adán.
»Du bist also rein zufällig hier.«
»Ich bin mit meinem Bruder zu einer Party hierhergekommen«, sagt Adán. »Hören Sie, das Ganze ist ein Missverständnis. Wenn Sie mit meinem Onkel reden, wird er -«
Navarres zieht die Pistole und schlägt Adán mit der Rückhand ins Gesicht. Die Federales stoßen den bewusstlosen Adán und die Campesinos, die ihn versteckt hatten, auf einen Lkw und fahren davon.
Als Adán diesmal aufwacht, ist es dunkel.
Es ist aber nicht Nacht, sondern sein Kopf steckt in einer schwarzen Kapuze. Er kriegt kaum Luft, gerät in Panik. Seine Hände sind hinterm Rücken gefesselt, er hört Motorengeräusch - Hubschrauber. Das muss eine Art Militärbasis sein, denkt Adán. Was er dann hört, ist schlimmer. Das Stöhnen eines Mannes, das harte Klatschen von Gummi und das scharfe Aufschlagen von Metall auf Fleisch und Knochen. Er riecht die Pisse, die Scheiße, das Blut des Mannes, er riecht den Gestank seiner eigenen Angst.
»Sag mir, wo Don Pedro ist«, sagt einer. Es ist die gepflegte, aristokratische Stimme von Leutnant Navarres.
Navarres blickt auf den Bauern hinab, ein schwitzendes, blutendes, zitterndes Bündel, das sich auf dem Zeltboden krümmt, zwischen den Stiefeln zweier hünenhafter Federales. Einer hält ein dickes Stück Gummischlauch in der Hand, der andere eine kurze Eisenstange. Die DEA-Leute sitzen draußen und warten auf Ergebnisse. Sie wollen nur die Informationen. Wie die zustande kommen, interessiert sie nicht.
Komische Leute, diese Amerikaner, denkt Navarres. Sie wollen ihren Braten, aber sie wollen nicht wissen, wie er zubereitet wird.
Er nickt dem einen Soldaten zu.
Adán hört das Zischen des Schlauchs und einen Schrei. »Hört auf!«, brüllt Adán.
»Ah, du bist wieder munter«, sagt Navarres zu Adán und beugt sich über ihn. Adán riecht seinen Pfefferminzatem. »Dann erzähl du mir, wo Don Pedro ist.«
»Sag's nicht!«, ruft der Campesino.
»Brecht ihm das Bein«, sagt Navarres.
Mit einem entsetzlich krachenden Geräusch zerschmettert die Eisenstange das Schienbein des Bauern. Wie eine Axt, die in ein Scheit fährt. Dann Schreie.
Adán hörte den Mann stöhnen, würgen, röcheln, beten, aber er sagt nichts.
»Jetzt glaube ich ihm, dass er nichts weiß«, sagt Navarres.
Adán spürt den Comandante näher kommen, riecht den Kaffee und den Tabak in seinem Atem, als er sagt: »Aber du weißt es.«
Die Kapuze wird ihm vom Kopf gerissen und, ehe er etwas erkennen kann, durch eine feste Augenbinde ersetzt. Dann wird sein Stuhl nach hinten gekippt, so dass er fast flach liegt, seine Füße im schrägen Winkel zur Decke zeigen.
»Wo ist Don Pedro?«
»Ich weiß es nicht.«
Er weiß es wirklich nicht. Das ist das Problem. Adán hat nicht die geringste Ahnung, wo Don Pedro steckt, obwohl er alles drum geben würde. Und er wird mit einer unschönen Wahrheit konfrontiert: Wenn er's wüsste, würde er's sagen. Ich bin nicht so stark wie dieser Campesino, denkt er, nicht so tapfer, nicht so loyal. Aber bevor ich mir die Beine brechen lasse, bevor ich das entsetzliche Knacken meiner eigenen Knochen höre, diese unvorstellbaren Schmerzen erleiden muss, sage ich ihnen alles, was sie wollen.
Aber er weiß es nicht, also sagt er: »Ehrlich, ich hab keine Ahnung ... ich bin kein Gomero.«
»Hm-hmmm«, macht Navarres.
Nur ein kleines Räuspern, das besagt: Ich glaub dir nicht.
Dann riecht Adán etwas.
Benzin.
Sie stopfen ihm einen Lappen in den Mund.
Adán wehrt sich, aber kräftige Hände drücken ihn nach unten, während ihm Benzin in die Nasenlöcher gegossen wird. Er hat das Gefühl zu ertrinken, was ja auch zutrifft. Er muss husten, spucken, würgen, doch der Lappen im Mund verhindert es. Erbrochenes staut sich in seiner Kehle, er glaubt, an der Mischung von Benzin und Erbrochenem zu ersticken, als ihn die Hände freigeben. Mit aller Gewalt wirft er den Kopf hin und her, bis sie den Lappen herausziehen und den Stuhl wieder aufrichten.
Als Adán mit Kotzen fertig ist, stellt Navarres die Frage noch einmal.
»Wo ist Don Pedro?«
»Ich weiß es nicht«, keucht Adán. Erneut befällt ihn die Panik. Daher sagt er etwas Dummes. »Ich habe Geld dabei.«
Der Stuhl wird wieder gekippt, der Lappen wieder hineingestopft. Die Benzinflut überschwemmt seine Nase, seine Nebenhöhlen, sein ganzes Gehirn, so wie es sich anfühlt. Er hofft, dass es ihn umbringt, denn das ist unerträglich. Gerade, als er denkt, jetzt ist es aus, stellen sie den Stuhl wieder auf, ziehen den Lappen heraus, und er bekotzt sich selbst.
»Was glaubst du, wer ich bin?«, brüllt Navarres. »Ein lumpiger Verkehrspolizist? Du wagst es, mir Schmiergeld anzubieten?«
»Tut mir leid«, röchelt Adán. »Lassen Sie mich gehen. Ich zahle, was Sie wollen.«
Wieder das Kippen nach hinten, der Lappen, das Benzin. Das grässliche Gefühl, dass die Benzindämpfe seine Nebenhöhlen durchdringen, sein Gehirn, seine Lunge. Er will sich aufbäumen, sein Kopf schlägt hin und her, seine Beine strampeln unkontrolliert. Als es endlich vorbei ist, nimmt Navarres sein Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger und hebt es an.
»Du kleines Dreckstück von Dealer«, sagt Navarres. »Du denkst wohl, man kann alles kaufen? Dann lass dir mal gesagt sein, du Stück Scheiße - mich kaufst du nicht. Hier wird nicht geschachert, hier gibt's keinen Deal. Du gibst mir, was ich will.«
An dem Punkt hört sich Adán etwas wahrhaft Dummes sagen.
»Comemierda.«
Navarres rastet aus. Er brüllt. »Ich soll Scheiße fressen? Ich soll Scheiße fressen? Raus mit ihm zur Latrine!«
Adán wird hochgerissen und aus dem Zelt geschleift, zu einem verdreckten Loch, das mit einem alten Toilettensitz bedeckt ist. Randvoll mit Scheiße, Klopapierfetzen, Pisse, umsummt von Fliegen.
Die Federales packen den strampelnden Adán und halten seinen Kopf über das Loch.
»Ich fresse Scheiße?«, brüllt Navarres. »Du frisst Scheiße!«
Sie stoßen Adáns Kopf bis zur Schulter in den Dreck.
Er windet sich verzweifelt, strampelt, hält die Luft an, bis es nicht mehr geht. Dann holen sie ihn heraus.
Adán spuckt Scheiße.
Und schnappt nach Luft, als sie ihn wieder hineinstoßen.
Presst Mund und Augen zu und schwört sich, eher zu sterben, als noch einmal Scheiße zu schlucken, aber bald ruckt sein ganzer Körper, seine Lunge giert nach Luft, sein Gehirn droht zu platzen, er öffnet den Mund noch einmal, er ersäuft im Dreck, dann ziehen sie ihn heraus und werfen ihn zu Boden.
»Na, wer frisst Scheiße?«
»Ich.«
»Spritzt ihn ab.«
Der Wasserstrahl schmerzt, aber Adán ist dankbar. Er kriecht auf allen vieren, würgend und kotzend, und das Wasser fühlt sich wunderbar an.
Navarres hat seinen Stolz befriedigt. Väterlich beugt er sich über Adán. »Also ... wo ist Don Pedro?«
Jetzt weint Adán. »Ich ... weiß ... es .. nicht.«
Navarres schüttelt den Kopf.
»Holt den anderen«, kommandiert er. Einen Augenblick später schleppen die Federales den Campesino aus dem Zelt. Seine weiße Hose ist zerrissen und blutig. Sein linkes Bein schleift er in einem schiefen Winkel nach, aus dem Unterschenkel ragt ein weißes Stück Knochen.
Adán sieht es und muss erneut kotzen.
Aber als sie ihn zu einem Hubschrauber zerren, wird ihm erst richtig schlecht.
Keller presst sich ein Taschentuch an die Nase.
Rauch und Asche setzen ihm zu. Seine Augen brennen, er hat einen widerlichen Geschmack auf der Zunge. Wer weiß, denkt er, was ich für Gifte einatme.
Vor ihm, in der Biegung der Landstraße, taucht ein Dorf auf. Campesinos stehen am Straßenrand und sehen zu, wie Soldaten die Strohdächer ihrer casitas in Brand zu setzen. Die Soldaten sind jung und nervös, sie drängen die Bauern zurück und hindern sie daran, ihre Habseligkeiten aus den brennenden Häusern zu retten.
Dann sieht Keller einen Verrückten.
Einen großen dicken Mann mit dichtem weißem Haar und weißen Bartstoppeln. Er trägt Tennisschuhe, Jeans, ein loses Hemd, und reckt ein hölzernes Kruzifix in die Höhe wie ein schlechter Schauspieler in einem Vampirfilm. So bahnt er sich einen Weg durch die Campesinos, dicht vorbei an den Soldaten.
Die müssen ihn ebenfalls für verrückt halten, weil sie zurückweichen und ihn vorbeilassen. Keller sieht, wie er die Straße überquert und zwei Soldaten, die mit Fackeln auf ein Haus zugehen, den Weg verstellt.
»Im Namen unseres Herrn Jesus Christus«, ruft der Mann. »Ich verbiete euch, das zu tun!«
Irgendein durchgeknallter Typ, denkt Keller, der normalerweise im Haus festgehalten wird und nun seine Jesus-Nummer durchzieht. Die zwei Soldaten starren ihn an und wissen nicht, was sie machen sollen.
Der Sergeant zeigt es ihnen. Er baut sich vor ihnen auf und brüllt sie an: Hört auf zu glotzen, zündet endlich das verdammte Haus an. Die Soldaten wollen dem Verrückten ausweichen, doch der ist schneller und verstellt ihnen erneut den Weg.
Ganz schön flink für so einen Dicken, denkt Keller.
Der Sergeant hebt drohend seinen Gewehrkolben, als wollte er dem Verrückten den Schädel zerschmettern.
Der rührt sich nicht von der Stelle. Bleibt einfach stehen und beschwört Gottes Hilfe.
Keller stoppt mit einem Seufzer den Jeep und steigt aus.
Er weiß, die Sache geht ihn nichts an, aber er kann nicht zusehen, wie ein kranker alter Mann eins auf den Schädel kriegt. Er ruft dem Sergeanten zu, er werde die Sache regeln, nimmt den Verrückten beim Ellbogen und will ihn wegführen.
»Komm, Alter, Jesus hat mir gesagt, er will dich sprechen. Drüben auf der anderen Straßenseite.«
»Wirklich?« sagt der Mann. »Mir hat er gesagt, du sollst dich ins Knie ficken.«
Der Mann sieht ihn an, mit erstaunlichen grauen Augen. Das ist kein Verrückter, begreift Keller. Manchmal schaust du einem Menschen in die Augen und du weißt auf Anhieb, dass mit ihm nicht zu scherzen ist.
Diese Augen haben Dinge gesehen - ohne ihnen auszuweichen, ohne vor ihnen zurückzuschrecken.
Jetzt sieht der Mann das DEA-Abzeichen auf Kellers Mütze.
»Bist wohl stolz auf dich«, sagt der Mann.
»Ich mache nur meinen Job.«
»Und ich mache meinen.« Er will zurück zu den Soldaten. »Hören Sie«, sagt Keller. »Ich kann nicht mit ansehen, dass Ihnen was passiert.«
»Dann machen Sie doch die Augen zu.« Er sieht Kellers besorgten Blick und fügt hinzu: »Keine Sorge, die tun mir nichts. Ich bin Geistlicher. Genauer gesagt Bischof.«
Ein Geistlicher, der »Fick dich ins Knie« sagt?, denkt Keller. Welche Art von Pfarrer - Entschuldigung, Bischof - benutzt denn solche -
Gewehrschüsse durchkreuzen seine Gedanken.
Keller hört das dumpfe tock-tock-tock von Kalaschnikows und wirft sich zu Boden, in den Dreck, so flach, wie er nur kann. Als er hochblickt, sieht er den Priester noch stehen - wie ein einsamer Präriebaum steht er da, während alle anderen flachliegen. Er hält sein Kreuz in die Höhe und brüllt den Schützen am Berghang zu, sie sollen aufhören mit der Ballerei.
So viel Tapferkeit hat Keller selten erlebt.
Oder Dummheit. Oder einfach Verrücktheit.
Scheiße, denkt Keller.
Er springt auf und drückt den Mann zu Boden.
»Den Kugeln ist es egal, ob Sie Pfarrer sind«, sagt er.
»Gott wird mich rufen, wenn er mich zu sich holen will«, erwidert der Priester.
Klar. Gott hatte schon die Hand am Telefon, denkt Keller. Er bleibt neben dem Mann liegen, bis die Gewehre verstummt sind, dann riskiert er wieder einen Blick und sieht Soldaten auf den Berg zulaufen, in Richtung der Schüsse.
»Haben Sie vielleicht eine Zigarette?«, fragt der Pfarrer.
»Ich rauche nicht.«
»Sie sind wohl Puritaner?«
»Rauchen kann Sie töten«, sagt Keller.
»Alles, was ich mag, kann mich töten«, antwortet der Pfarrer. »Ich rauche, ich trinke, ich esse zu viel. Eine Folge der Enthaltsamkeit, vermutlich. Ich bin Bischof Parada. Nennen Sie mich Padre Juan.«
»Sie sind verrückt, Padre Juan.«
»Christus braucht Verrückte«, sagt Parada, erhebt sich vom Boden und klopft sich den Staub ab. Strahlend blickt er in die Runde. »Und das Dorf steht noch!«
Klar, denkt Keller. Weil die Gomeros geschossen haben. »Haben Sie einen Namen?«, fragt Parada. »Art Keller.«
Keller reicht ihm die Hand, Parada nimmt sie. »Was machen Sie hier, warum fackeln Sie unser Land ab?«
»Wie ich schon sagte. Das ist -«
»Ihr Job«, sagt Parada. »Ein beschissener Job, Arturo.« Er sieht, dass Keller freundlich auf den »Arturo« reagiert. »Sie sind halber Mexikaner, oder?«, fragt er. »Stimmt. Mütterlicherseits.«
»Ich bin Halbamerikaner«, sagt Parada. »Geboren in Texas. Meine Eltern waren mojados, Wanderarbeiter, und sind zurück nach Mexiko, als ich noch klein war. Technisch gesehen besitze ich die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich bin Texaner.«
»Yee-haw!«
»Hook 'em horns!«
Eine Frau kommt angerannt und redet hastig auf Parada ein. Sie weint und spricht viel zu schnell, Keller versteht nur das eine oder andere Wort: Padre Juan, federales und tortura.
Parada wendet sich an Keller. »In einem Camp hier in der Nähe werden Gefangene gefoltert. Können Sie dem ein Ende setzen?«
Wahrscheinlich nicht, denkt Keller. Das ist die eiserne Regel bei Operation Condor. Die Federales bringen sie zum Singen, und wir hören uns das Lied an. »Padre, ich bin nicht befugt, mich in die inneren Angelegenheit der -«
»Hören Sie auf, ich bin kein Idiot«, sagt Parada. »Fahren wir.«
Er geht zu Kellers Jeep und steigt ein. »Kommen Sie, bewegen Sie Ihren Arsch.«
Keller steigt ein, startet den Motor und wirft den Gang ein.
Als sie im Basiscamp eintreffen, sieht Keller, dass Adán in einem offenen Hubschrauber sitzt, die Hände auf den Rücken gefesselt. Neben ihm liegt ein Campesino mit einer grässlichen Unterschenkelfraktur.
Der Hubschrauber will gerade starten. Keller springt aus dem Jeep, die Rotoren wehen ihm Staub und Sand ins Gesicht. Geduckt rennt er zum Piloten, Phil Hansen.
»Phil, was soll der Scheiß?«
Phil grinst ihn an. »Zwei Vögel.«
Keller weiß, was gemeint ist: Man nimmt zwei Vögel mit hoch. Der eine fliegt, der andere singt.
»Nein«, sagt Keller. Er zeigt mit dem Daumen über die Schulter. »Der Junge da hinten gehört mir.«
»Fick dich, Keller!«
Klar, ich ficke mich, denkt Keller. Er schaut in den Hubschrauber, wo sich Parada schon um den Campesino mit dem gebrochenen Bein kümmert, dann zu Keller aufblickt. Fragend und fordernd zugleich.
Keller schüttelt den Kopf. Er zieht seine 45er, entsichert und steckt sie in Hansens Gesicht. »Du startest nicht, Phil.«
Keller hört, wie die Federales nach den Gewehren greifen, die Magazine einklicken lassen.
DEA-Männer kommen aus dem Mess-Zelt gerannt.
Jetzt brüllt Taylor: »Keller, was zum Teufel machen Sie da?«
»Läuft das jetzt so bei uns?«, fragt Keller. »Werfen wir jetzt Leute aus dem Hubschrauber?«
»Sie sind auch keine Jungfrau, Keller«, sagt Taylor. »Haben es oft genug auf dem Rücksitz getrieben.«
Da kann ich nicht widersprechen, denkt Keller. Es stimmt.
»Jetzt sind Sie erledigt, Keller«, sagt Taylor. »Ihren Job können Sie vergessen. Ich bring Sie in den Knast.«
Er klingt richtig glücklich.
Keller zielt weiter auf Hansens Gesicht.
»Das ist eine mexikanische Angelegenheit«, sagt Navarres, der nun auch aufgetaucht ist. »Halten Sie sich da raus. Das ist nicht Ihr Land.«
»Das ist mein Land!« brüllt Parada. »Und ich exkommuniziere Ihren Arsch so schnell, dass -«
»Was für Ausdrücke, Padre!«, sagt Navarres.
»Sie kriegen gleich noch mehr zu hören.«
»Wir suchen Don Pedro Aviles«, sagt Navarres, an Keller gewandt. Dann zeigt er auf Adán. »Dieses kleine Stück Scheiße weiß, wo er steckt, und er wird es uns verraten.«
»Sie wollen Don Pedro?«, fragt Keller. Er dreht sich von Hansen weg, geht zu seinem Jeep, schlägt den Poncho auf. Don Pedros Leiche rutscht aus dem Jeep und fällt zu Boden. »Da haben Sie ihn.«
Taylor starrt hinab auf den von Kugeln durchsiebten Leichnam.
»Was ist passiert?«
»Wir wollten ihn festnehmen. Ihn und fünf seiner Leute«, sagte Keller. »Sie haben Widerstand geleistet. Sie sind alle tot.«
»Alle?«, fragt Taylor ungläubig. »Keine Verwundeten?«
»Keine.«
Taylor grinst, aber er ist sauer, und Keller weiß es. Keller hat ihnen gerade die große Trophäe überreicht, daher kann ihm Taylor nichts mehr anhaben. Nicht das kleinste Härchen kann er ihm krümmen. Trotzdem, ein Friedensangebot muss sein. Keller zeigt mit dem Kopf auf Adán, und der verletzte Campesino sagt leise: »Ich glaube, wir haben alle Grund genug, den Mund zu halten.«
»Okay«, sagt Taylor.
Keller steigt in den Hubschrauber und bindet Adán los. »Tut mir leid, die Sache.«
»Nicht so leid wie mir«, erwidert Adán und wendet sich an Parada: »Wie geht es seinem Bein, Padre Juan?«
»Ihr kennt euch?«, fragt Keller.
»Ich hab ihn getauft«, sagt Parada. »Und ihm die Erstkommunion erteilt. Aus dem wird mal was.« Aber sein Blick sagt etwas anderes.
Keller ruft nach vorn: »Phil, du kannst jetzt losfliegen. Zum Krankenhaus von Culiacán, aber mach Tempo!« Der Hubschrauber hebt ab. »Arturo«, sagt Parada. »Ja?«
Der Pfarrer strahlt ihn an.
»Mein Glückwunsch«, sagt Parada. »Du bist ein verrückter Hund.«
Keller blickt hinunter auf die zerstörten Felder, die abgebrannten Dörfer, die lange Schlange der Flüchtlinge auf der Straße.
Verbrannte Landschaft, so weit sein Auge reicht.
Felder mit verschmorten Blüten.
Ja, denkt Keller. Ich bin ein verrückter Hund.
Neunzig Minuten später liegt Adán zwischen den blütenweißen Laken des besten Krankenhauses von Culiacán. Die Gesichtswunde, die ihm Navarres' Pistolenlauf zugefügt hat, ist gereinigt und verarztet, er ist vollgepumpt mit Antibiotika, aber die Schmerzmittel hat er zurückgewiesen. Adán will den Schmerz spüren.
Er steigt aus dem Bett und läuft durch die Korridore, bis er das Zimmer gefunden hat, wo sie, auf sein Drängen, Manuel Sánchez untergebracht haben.
Der Campesino öffnet die Augen und sieht Adán.
»Mein Bein...«
»Ist noch dran.«
»Die sollen nicht -«
»Ich passe auf«, sagt Adán. »Schlaf dich erst mal aus.« Adán macht sich auf die Suche nach dem Arzt. »Können Sie sein Bein retten?«
»Ich glaube schon«, sagt der Arzt. »Aber das wird teuer.«
»Wissen Sie, wer ich bin?«
»Ich weiß, wer Sie sind.«
Adán registriert das feine Lächeln mit der noch feineren Andeutung: Ich weiß, wer dein Onkel ist.
»Retten Sie sein Bein, und Sie werden Chef der neuen Station. Wenn das Bein verloren ist, werden Sie Abtreibungsarzt in einem Puff von Tijuana. Wenn der Mann stirbt, landen Sie schneller auf dem Friedhof als er. Und das Ganze hat nichts mit meinem Onkel zu tun, sondern mit mir. Verstanden?«
Der Arzt hat verstanden.
Und Adán hat verstanden, dass etwas zu Ende gegangen ist. Seine Kinderjahre sind vorbei. Jetzt fängt der Ernst des Lebens an.
Tío saugt genüsslich an seiner kubanischen Zigarre und lässt Rauchringe durchs Zimmer schweben.
Operation Condor hätte nicht besser laufen können. Die Felder verbrannt, der Boden vergiftet, die Gomeros in alle Winde zerstreut und Aviles zur Strecke gebracht. Die Amerikaner glauben, sie hätten das Übel bei der Wurzel gepackt und werden sich, was Mexiko betrifft, auf die faule Haut legen.
Ich kann in aller Ruhe ein Kartell aufbauen, gegen das sie machtlos sind, wenn sie irgendwann wieder aufwachen.
Eine federación.
Es klopft leise an die Tür.
Ein schwarz uniformierter DFS-Mann mit umgehängter Uzi tritt ein. »Da will Sie jemand sprechen, Don Miguel. Er sagt, er ist Ihr Neffe.«
»Lass ihn rein.«
In der Tür steht Adán.
Miguel Angel Barrera weiß schon Bescheid. Über die Schläge, die Folter, seinen Auftritt im Krankenhaus. Über Nacht ist aus dem Jungen ein Mann geworden.
Und der Mann kommt gleich zur Sache.
»Du wusstest von dem Militäreinsatz«, sagt Adán.
»Klar. Ich hab ihn mit vorbereitet.«
Allerdings. Sie haben die Ziele sorgfältig ausgewählt, um ihre Feinde und Rivalen zu beseitigen, die alten Dinosaurier, die nicht mit der Zeit gehen. Sie hätten sowieso nicht überlebt, wären nur im Weg gewesen.
Jetzt sind sie beseitigt.
»Das war eine Riesensauerei«, sagt Adán.
»Aber sie war notwendig«, sagt Tío. »Das alles wäre sowieso passiert, also haben wir die Sache zu unserem Vorteil entschieden. So läuft das Geschäft, Adán.«
»Hm ...« Adán ist nachdenklich geworden.
Und jetzt, sagt sich Tío, wollen wir mal sehen, welche Sorte Mann aus dem jungen geworden ist. Er wartet auf Adáns Vorstoß.
»Ich will ins Geschäft einsteigen«, sagt Adán.
Tío Barrera, der am Kopf der Tafel sitzt, erhebt sich.
Im Restaurant ist heute geschlossene Gesellschaft. Und das hoch drei, denkt Adán. Der ganze Ort ist abgesichert von DFS-Leuten mit Uzis. Die Gäste wurden abgetastet und mussten die Waffen abliefern.
Die Gästeliste wäre ein gefundenes Fressen für die Yankees. Alle wichtigen Gomeros, die Tío aus der Operation Condor herausgehalten hat, sind vertreten, Adán sitzt neben Raúl und studiert die Gesichter.
García Ábrego, mit seinen fünfzig Jahren ein uralter Mann für dieses Gewerbe. Das silberne Haar und der silberne Schnauzbart lassen ihn aussehen wie einen alten, verschlagenen Kater. Was er auch ist. Er sitzt reglos da, die Augen auf Barrera gerichtet, und verrät mit keiner Miene, was in ihm vorgeht. Tío hat es Adán erklärt: »Er fragt sich, wie er es geschafft hat, in dieser Branche fünfzig Jahre alt zu werden. Von ihm kannst du was lernen.«
Neben Ábrego sitzt der Mann, den Adán als el Verde kennt. »Der Grüne« wird er genannt wegen der grünen Straußenlederstiefel, die er immer trägt. Neben diesem Beau wirkt Chalino Guzmán wie ein Bauer - Strohhut, Jeans, Arbeitshemd.
Nach Guzmán kommt Gúero Méndez.
Selbst hier in der Stadt trägt Gúero die Cowboykluft von Sinaloa: schwarzes Hemd mit Perlmuttknöpfen, enge schwarze Jeans mit riesiger Gürtelschnalle in Silber und Türkis, spitze Stiefel und einen weißen Cowboyhut - den er auch bei Tisch nicht abnimmt.
Und Gúero kann nicht die Klappe halten. Er redet über seine wundersame Rettung aus dem Feuergefecht, das sich die Federales mit Don Pedro, seinem Boss, geliefert haben. »Santo Jesús Malverde hat mich vor den Kugeln beschützt«, verkündet er.
»Ich sage euch, Brüder, ich bin mitten durch den Kugelhagel gelaufen. Vier Stunden später wusste ich immer noch nicht, ob ich lebe oder ob ich ein Gespenst bin.« Und so redete er endlos weiter - wie er seine Pistole auf die Federales abgeschossen hat, wie er dann aus dem Auto gesprungen und gerannt ist - »mitten durch den Kugelhagel, Brüder« - bis in ein Dickicht, aus dem er dann entkommen konnte. Und wie er sich zur Stadt durchgeschlagen hat - »jeden Moment dachte ich, das ist mein letzter, Brüder.«
Adán nimmt die anderen Gäste in Augenschein: Jaime Herrera, Rafael Caro, Chapo Montana - allesamt Gomeros aus Sinaloa, alles Leute auf der Flucht jetzt. Verloren geglaubte und vom Wind abgetriebene Schiffe, die Tío in seinen sicheren Hafen geleitet hat.
Schon dass Tío dieses Treffen einberufen hat, rechtfertigt seinen Führungsanspruch. Er hat sie alle um den Tisch versammelt, der sich unter Garnelenkübeln biegt, unter Platten mit dünn geschnittenem Fleisch und Kästen mit eiskaltem Bier, das man in Sinaloa dem Wein vorzieht.
Im Nachbarraum spielen sich schon die Musikanten warm, gleich werden sie in ihren bandas die Heldentaten berühmter Drogenschmuggler preisen, von denen einige am Tisch sitzen. Im Separee weiter hinten wartet ein Dutzend erstklassiger Callgirls, die eigens aus Haley Saxons Etablissement in San Diego herangekarrt wurden.
»Das Blut, das vergossen wurde, ist getrocknet«, beginnt Tío seinen Toast. »Nun ist es an der Zeit, allen Groll zu vergessen, den bitteren Geschmack der Vergeltung herunterzuspülen. All das ist Vergangenheit, wie das Wasser, das gestern den Fluss hinunterfloss.«
Er nimmt einen Schluck Bier, spuckt es auf den Fußboden und wartet, ob sich Widerspruch regt. Niemand widerspricht.
»Vorbei ist auch das Leben, das wir kannten. Untergegangen in Flammen und Gift. Das Leben, das wir kannten, ist zum flüchtigen Traum geworden, verweht wie der Rauch im Wind. Wir würden den Traum ja gern zurückrufen und weiterschlafen, aber dann leben wir nicht im Leben, sondern im Traum.
Die Amerikaner wollten uns Sinaloaner vertreiben, unsere Felder verbrennen und uns in alle Winde zerstreuen. Doch Feuer schafft auch Platz für neues Wachstum. Der Wind, der zerstört, trägt die Saat auf neuen Grund. Ich sage euch: Wenn sie uns in alle Winde zerstreuen wollen, dann sei es so. Wir werden uns ausbreiten wie die Samen der Bärentraube, die auf jedem Boden gedeiht. Ich sage euch: Wir werden uns ausbreiten wie die Finger einer Hand. Ich sage euch, wenn sie uns unser Sinaloa nehmen, dann nehmen wir das ganze Land.
Es gibt drei entscheidende Regionen für unsere Transportwege. Erstens das Gebiet von Sonora, das an Texas und Arizona grenzt, zweitens die Golfregion gegenüber Texas, Louisiana und Florida und drittens die Baja California mit ihrer direkten Anbindung an San Diego, Los Angeles, den ganzen Westen. Ábrego möchte ich bitten, die Golfregion als sein Gebiet zu übernehmen, mitsamt den Märkten von Houston, New Orleans, Tampa und Miami. El Verde, dich bitte ich, Sonora zu übernehmen, einschließlich der Märkte New Mexico, Arizona und dem westlichen Texas mit Juárez als Ausgangsbasis.«
Vergeblich versucht Adán, in den Gesichtern der Angesprochenen zu lesen. Die Golfregion ist vielversprechend, aber auch schwierig, weil die Amerikaner gegenwärtig ihre Kräfte aus Mexiko abziehen und auf die östliche Karibik konzentrieren. Doch Ábrego kann Millionen verdienen - nein, Milliarden -, wenn er nur genügend Nachschub bekommt.
Adán studiert el Verdes undurchdringliches Bauerngesicht. Die Region Sonora dürfte ebenfalls sehr lukrativ sein. El Verde müsste in der Lage sein, tonnenweise Drogen nach Phoenix, El Paso und Dallas zu befördern und von dort weiter nach Chicago, Minneapolis und insbesondere Detroit.
Aber alle warten auf den nächsten Paukenschlag, und Adán achtet genau auf ihre Gesichter, als ihnen dämmert, dass sich Tío das Sahnestück sichern wird.
Baja California.
Tijuana ist das Einfallstor für die riesigen Märkte von San Diego, Los Angeles, San Francisco, San Jose, über die auch die Nachschublinien zu den noch größeren Märkten im Nordosten der Vereinigten Staaten verlaufen - nach Philadelphia, Boston und dem absoluten Kronjuwel: New York City.
Der Golf ist also das eine Gebiet, Sonora ist das andere Gebiet, aber Baja ist das Gebiet schlechthin.
Niemand ist also besonders gespannt, als Barrera anhebt: »Und ich, ich schlage vor ... nach Guadalajara zu gehen.«
Jetzt sind sie alle baff.
Einschließlich Adán, der einfach nicht glauben kann, dass Tío auf die fetteste Pfründe der ganzen westlichen Welt verzichten will. Wenn dieses Gebiet nicht an die Familie geht, wer soll es dann -
»Und ich bitte Gúero Mendez«, fährt Barrera jetzt fort, »das Gebiet Baja California zu übernehmen.«
Adán sieht das Grinsen, das sich auf Gúeros Gesicht ausbreitet, und ihm geht ein Licht auf. Jetzt begreift er, warum Gúero bei dem Überfall auf Don Pedro auf wundersame Weise mit dem Leben davonkam. Dieses Gebiet ist kein Überraschungsgeschenk, sondern ein eingelöstes Versprechen.
Aber warum?, fragt sich Adán. Was führt Tío im Schilde?
Und wo bleibe ich?
Er ist schlau genug, den Mund zu halten. Tío wird es ihm schon verraten, wenn er mit seiner Rede fertig ist.
García Ábrego beugt sich lächelnd vor. Mit seinem kleinen Mündchen unter dem weißen Schnauzbart sieht er aus wie ein Kater, denkt Adán. Ábrego sagt: »Barrera teilt die Welt in drei Teile und nimmt sich selbst den vierten. Da frage ich mich doch, warum.«
»Abrego, was wächst in Guadalajara?«, fragt Barrera. »An welches Land grenzt der Bundesstaat Jalisco? An keins. Dort lässt es sich leben. Das ist schon alles. Ein sicherer Ort, um der federación zu dienen.«
Das ist das erste Mal, dass er das Kind beim Namen nennt, denkt Adán. La federación. Mit sich selbst an der Spitze. Nicht dem Titel, sondern der Stellung nach.
»Wenn ihr diese Aufteilung akzeptiert«, sagt Barrera, »teile ich mit euch, was mir gehört. Meine Freunde werden eure Freunde sein, mein Schutz wird auch euch zugute kommen.«
»Wie viel zahlen wir für diesen Schutz?«, fragt Ábrego.
»Einen bescheidenen Beitrag«, sagt Barrera. »Schutz hat seinen Preis.«
»Welchen?«
»Fünfzehn Prozent.«
»Barrera«, sagt Ábrego, »du teilst das Land in Hoheitsgebiete auf. Alles schön und gut. Ábrego ist einverstanden mit dem Golf. Doch du hast etwas vergessen - du verteilst den Kuchen, aber du hast nichts zu verteilen. Es ist nichts mehr da. Unsere Felder sind verbrannt und vergiftet. In unseren Bergen wimmelt es von Polizei und von Yankees. Du gibst uns die Märkte, aber wir haben kein Opium für diese Märkte.«
»Vergesst das Opium«, sagt Barrera.
»Und Marihuana -«, will Gúero einwerfen.
»Marihuana könnt ihr auch vergessen«, schneidet ihm Barrera das Wort ab. »Das ist alles Kinderkram.«
Ábrego breitet die Arme aus. »Ja, wie denn, Miguel Angel? Du sagst, wir sollen Opium und Marihuana vergessen. Was sollen wir denn sonst anbauen?«
»Du denkst wie ein Bauer.«
»Ich bin ein Bauer.«
»Die Landesgrenze zu den USA ist zweitausend Meilen lang«, sagt Barrera. »Dazu kommen tausend Meilen Seegrenze. Das ist alles, was wir brauchen.«
»Ich verstehe kein Wort.« Ábrego wird ungeduldig.
»Trittst du der Federación bei?«
»Ja doch«, mault Ábrego. »Ich akzeptiere diese Federación, auch wenn sie nichts zu verkaufen hat. Hab ich denn eine Wahl?«
Hast du nicht, denkt Adán. Tío ist der Polizeichef von Jalisco und arbeitet mit der DFS zusammen. Er hat die Operation Condor zu seinem Putsch benutzt und sich an die Spitze gesetzt. Aber - und da hat Ábrego mit seiner Frage recht - an die Spitze wovon?
»El Verde?«, fragt Barrera.
»Si.«
»Mendez?«
»Si, Don Miguel.«
»Alsdann, Brüder«, beendet Barrera seine Ansprache, »lasst euch zeigen, wie unsere Zukunft aussieht.«
Sie ziehen um ins Nachbarhaus, in einen schwer bewachten Raum des Hotels, das Barrera gehört.
Ramón Mette Ballasteros erwartet sie schon.
Mette ist Honduraner, wie Adán weiß, der eigentlich mit den Kolumbianern in Medellin zusammenarbeitet. Und über Mexiko lassen die Kolumbianer ihre Geschäfte eher selten laufen. Adán verfolgt aufmerksam, wie Mette Kokainpulver in einem Becherglas mit Wasser und Natron auflöst.
Schaut dabei zu, wie Mette das Becherglas über einem Bunsenbrenner fixiert und die Flamme aufdreht.
»Kokain«, sagt Ábrego. »Na und?«
»Wart's ab«, sagt Barrera.
Adán verfolgt, wie die Lösung zu brodeln anfängt und das Kokain merkwürdige knisternde Geräusche macht. Dann wird es zu einer zähen Masse. Mette holt sie vorsichtig heraus und lässt sie trocknen. Und während sie trocknet, formt sie sich zu einer Kugel, die aussieht wie ein Kieselstein.
»Senores«, sagt Barrera. »Willkommen in der Zukunft.«
Keller steht vor Santo Jesús Malverde.
»Ich bringe dir ein manda«, sagt Keller. »Du hast deinen Teil geleistet. Und ich leiste meinen.«
Er verlässt den Schrein und nimmt ein Taxi zum Stadtrand.
Die Hüttensiedlung ist schon im Werden.
Aus Pappkartons, Kisten und Decken basteln sich die Flüchtlinge aus Badiraguato ihre neuen Behausungen zusammen. Wer Glück hatte und rechtzeitig kam, konnte sich die Wellbleche sichern. Keller sieht eine alte Kinoreklame - Der Marschall -, die jetzt als Dachaufbau dient. Ein sonnengebleichter John Wayne wacht über Familien, die Wände aus Blechen, Sperrholzresten und zerbrochenen Schlackesteinen errichten. Parada hat alte Zelte aufgetrieben - indem er der Armee die Hölle heißgemacht hat, vermutet Keller -, auch ein provisorisches Lazarett eingerichtet und eine Suppenküche. Ein paar Bretter auf Sägeböcken dienen als Serviertisch, eine Propangasflasche liefert die Flamme unter dem dünnen Blech, auf das ein Priester und ein paar Nonnen die Töpfe stellen. Wenige Meter entfernt werden auf einem Rost über offenem Feuer Tortillas gebacken.
Keller betritt das große Sanitätszelt. Krankenschwestern waschen Kinder und tupfen ihnen die Oberarme für die Tetanusspritze ab. Aus einer Ecke kommt Kindergeschrei. Dort entdeckt er Padre Juan, der versucht, ein Mädchen mit Verbrennungen am Arm zu trösten.
»Das fruchtbarste Opiumland der westlichen Welt«, sagt er, »und wir haben nichts, um die Schmerzen der Kinder zu stillen.«
»Wenn ich könnte, würde ich mit ihr tauschen«, sagt Keller.
Parada mustert ihn mit einem Seitenblick. »Schade, dass es nicht geht.« Er küsst das Mädchen auf die Wange. »Jesus hat dich lieb.«
Das ist nun alles, was ich gegen ihre Schmerzen tun kann, denkt Parada. Und es gibt noch schlimmere Fälle. Manche Männer wurden so schwer misshandelt, dass ihnen Arme und Beine amputiert werden müssen. Und das nur, denkt Parada, weil die Amerikaner ihren Appetit auf Drogen nicht zügeln können. Sie verbrennen den Mohn, und sie verbrennen die Kinder. Lieber Jesus Christus, jetzt könnten wir dich hier gebrauchen.
Keller folgt ihm durchs Zelt.
»Von wegen >Jesus hat dich lieb<«, brummelt Parada. »An Tagen wie diesem frage ich mich öfter, ob das nicht alles Blödsinn ist. Was führt dich hierher? Das schlechte Gewissen?«
»Könnte man sagen.«
Keller holt Geld aus der Tasche, sein letztes Monatsgehalt, und bietet es Parada an.
»Für Medikamente«, sagt er.
»Gott segne dich.«
»Ich glaube nicht an Gott«, erwidert Keller. »Macht nichts«, sagt Parada. »Er glaubt an dich.« Dann, denkt Keller, ist er ein ganz schöner Trottel.
2 Die wilden Iren
Where e'er we go, we celebrate
The land that makes us refugees,
From fear of priests with empty plates
From guilt and weeping effigies.
Shane MacGowan, Thousands Are Sailing
Hell's Kitchen New York City
1977
Callan ist mit blutrünstigen Geschichten groß geworden.
Cuchulain, Edward Fitzgerald, Wolfe Tone, Roddy McCorley, Pádraic Pearse, James Connelly, Sean South, Sean Barry, John Kennedy, Bobby Kennedy, Bloody Sunday, Jesus Christus.
Der dicke rote Sud aus irischem Nationalismus und Katholizismus oder irisch-katholischem Nationalismus oder irischem Nationalkatholizismus. Ganz egal. Die Wände zu Hause und in der Schule sind mit grusligen Märtyrerbildern gespickt: Roddy McCorley, erhängt an der Brücke von Toome; James Connelly, an den Stuhl gefesselt und dem britischen Erschießungskommando ausgeliefert; der heilige Timotheus, gespickt mit Pfeilen, der arme Wolfe Tone, der sich mit dem Rasiermesser den Hals aufschnitt, aber statt der Halsschlagader die Luftröhre traf - jedenfalls starb, bevor sie ihn hängen konnten; John und Bobby Kennedy, die vom Himmel runtergucken - und Jesus am Kreuz.
Natürlich gibt es in der Schule auch die zwölf Kreuzwegstationen. Christus, ausgepeitscht, Christus mit Dornenkrone, Christus, das Kreuz schleppend, Christus mit durchbohrten Händen und Füßen. (Als Callan noch sehr klein war, hat er seine Schwester gefragt, ob Christus Ire war, worauf sie seufzend erwiderte: Nein, aber er hätte es sein können.)
Jetzt ist er siebzehn, sitzt mit seinem Buddy O-Bop im Liffey Pub in der 47th Street, Ecke Twelfth und trinkt Bier.
Außer ihnen und dem Barmann Billy Shields ist nur noch Little Mickey Haggerty vertreten, er hockt am anderen Ende der Bar und lässt sich ordentlich volllaufen, bevor er seinem Haftrichter gegenübertritt, der acht bis zwölf Jahre Knast zwischen dieses und das nächste Besäufnis schieben will. Little Mickey kam mit einer ganzen Rolle Quartermünzen rein, die er alle in die Jukebox schob, um dann immer auf denselben Knopf zu drücken. E-5. Also säuselt Andy Williams schon eine ganze Stunde lang »Moon River«, doch die beiden Jungs sagen nichts, weil sie wissen, dass Little Mickey wegen Geiselnahme in den Bau muss.
Es ist August in New York, einer dieser Es-ist-nicht-die-Hitze-es-ist-die-Feuchtigkeit-Nachmittage, wenn einem das Hemd am Rücken klebt wie die alten Geschichten, die man nicht loswird.
Weshalb O-Bop jetzt Callan mit seinen Geschichten belegt.
Sie sitzen an der Bar und trinken, und O-Bop kommt einfach nicht drüber weg.
Was sie mit Michael Murphy gemacht haben.
»Das war nicht fair, was sie mit ihm gemacht haben«, sagt O-Bop. »Das war übel.«
»Finde ich auch.« Callan nickt.
Passiert war, dass Michael Murphy seinen besten Freund erschossen hatte, Kenny Mäher. Wieder mal die übliche Geschichte, sie waren beide stoned gewesen zu der Zeit, einfach breit vom Mexican Mud, dem Heroin aus braunem Opium, das in der Gegend gerade kursierte, und so kam, was kommen musste. Der Streit zwischen den beiden eskaliert, Kenny gibt Michael eins auf die Birne, und Michael kann das nicht wegstecken, er geht los, holt seine 25er, läuft Kenny nach und schießt ihm eine Kugel in den Kopf.
Danach setzt er sich mitten auf die 49th Street und heult, weil er seinen besten Freund erschossen hat. So findet ihn O-Bop. Er holt ihn von der Straße weg, bevor die Bullen kommen, und da sich das Ganze in Hell's Kitchen abspielt, kriegen die Bullen nie raus, wer Kenny das Lebenslicht ausgeblasen hat.
Nur sind die Bullen in der Gegend die Einzigen, die das nicht wissen. Bei allen anderen spricht es sich rum, auch bei Eddie Friel, und das ist schlecht für Murphy. Denn Eddie »The Butcher« Friel kassiert Schutzgelder für Big Matt Sheehan.
Big Matt kontrolliert die ganze Gegend, er kontrolliert die örtlichen Gewerkschaftsbüros, er kontrolliert das Glücksspiel, den Kreditwucher, die Huren, was immer man will - aber er hat auch ein Auge darauf, dass keine Drogen ins Viertel kommen.
Das ist eine Frage der Ehre für Sheehan und ein Grund, weshalb er bei den älteren Leuten in Hell's Kitchen ein solches Ansehen genießt.
»Sagt, was ihr wollt über Matt«, sagen sie, »aber er hält unsere Jugend von den Drogen fern.«
Auf Michael Murphy, Kenny Mäher und noch ein paar Dutzend andere trifft das zwar nicht zu, doch das scheint dem Ruf von Matt Sheehan nicht zu schaden. Und einen Großteil dieses Rufs hat er Eddie the Butcher zu verdanken, denn vor dem haben alle eine höllische Angst. Wenn Eddie the Butcher kassieren kommt, dann wird gezahlt - und zwar möglichst in Scheinen. Wenn nicht, zahlt man mit Blut und Knochenbrüchen, und die Scheine sind trotzdem fällig.
Dazu muss gesagt werden: Etwa jeder Zweite in Hell's Kitchen schuldet Matt Sheehan Geld.
Auch das ein Grund, weshalb sie ihn angeblich so verehren.
Aber als O-Bop mitkriegt, was Eddie über Murphy sagt - jemand solle sich diesen verfluchten Junkie doch mal vorknöpfen -, geht er zu Murphy und rät ihm, für eine Weile abzutauchen. Auch Callan macht das. Auch er rät ihm zu verschwinden, nicht nur weil Eddie im Ruf steht, seine üblen Drohungen wahrzumachen, sondern auch, weil Matt Sheehan verkündet hat, Junkies, die sich gegenseitig umbringen, seien schlecht für die Gegend und schlecht für seinen guten Ruf.
Also raten ihm die beiden dringend zu, aber Murphy sagt nur »Scheiß drauf« und bleibt, wo er ist, und sie vermuten, dass er lebensmüde ist, wegen der Sache mit Kenny. Ein paar Wochen später fällt ihnen auf, dass er sich nicht mehr blicken lässt, daher vermuten sie, er hat sich endlich eines Besseren besonnen und ist abgehauen, und bei der Vermutung bleiben sie, bis eines Vormittags Eddie the Butcher im Shamrock Café auftaucht, ein fettes Grinsen im Gesicht und einen Milchkarton in der Hand.
Er zeigt den Karton überall herum und kommt auch rüber an den Tisch von Callan und O-Bop, die nichts weiter wollen, als in aller Ruhe ihren Kaffee trinken und ihren Kater aussitzen. Eddie zeigt O-Bop den Karton und sagt »Hey, guck mal da rein«.
O-Bop guckt in den Karton und muss sofort kotzen, direkt auf den Tisch, was Eddie nun wieder übertrieben findet. Er bezeichnet O-Bop als Memme und geht lachend weiter.
Jedenfalls ist es wochenlang allgemeines Gesprächsthema, wie Eddie und sein Kumpan Larry Moretti in Michael Murphys Wohnung eindrangen, ihn unter die Dusche schleiften, hundertsiebenundvierzig Mal auf ihn einstachen und ihn dann in Stücke schnitten.
Erzählt wird, dass Eddie the Butcher die Leiche von Michael Murphy zerlegt hat wie ein Schwein, die Einzelteile in Mülltüten rausgetragen und in der ganzen Stadt verteilt hat.
Nur Michaels Schwanz nicht. Den hat er in den Milchkarton gesteckt, um allen zu zeigen, was mit denen passiert, die es wagen, sich an einem von Eddies Leuten zu vergreifen.
Und niemand kann was machen, weil Eddie dick befreundet ist mit Matt Sheehan und Sheehan beste Beziehungen zur Cimino-Familie hat. Mit anderen Worten, Eddie ist unangreifbar.
Nur leider brütet O-Bop sechs Monate später immer noch über der Geschichte.
Sagt, es war übel, was sie mit Murphy gemacht haben.
»Okay, vielleicht mussten sie ihn umlegen«, sagt O-Bop jetzt. »Vielleicht. Aber auf diese Art? Und dann dieses Teil von ihm rumzeigen? Nein, das ist übel. Das ist so was von übel.«
Billy Shields, der Barmann, wischt die Theke ab - und das vielleicht zum ersten Mal überhaupt -, denn er wird richtig nervös, als er hört, wie dieser junge Spund schlecht über Eddie the Butcher redet. Er wischt und wischt, als hätte er vor, die Theke als OP-Tisch zu benutzen.
O-Bop merkt genau, dass ihn der Barmann belauscht, aber das kann ihn nicht bremsen. O-Bop und Callan sind schon den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt, sind am Hudson entlang, haben sich einen Joint reingezogen und Bier aus der braunen Tüte getrunken, sie sind nicht wirklich hinüber, aber auch nicht mehr ganz von dieser Welt.
Also quatscht O-Bop weiter.
Es war übrigens Kenny Mäher, der ihm den Namen O-Bop verpasst hat. Sie waren da alle im Park, spielten Street Hockey und machten gerade Pause, als Stevie O'Leary, wie er damals noch hieß, angelaufen kam und Kenny Mäher zu ihm sagte: »Ich glaube, wir nennen dich Bop.«
Stevie ist gar nicht mal sauer, im Gegenteil. Er ist erst fünfzehn, und von ein paar älteren Typen einen Spitznamen verpasst zu kriegen, ist ziemlich cool. Also freut er sich und fragt: »Bop? Wieso Bop?«
»Wegen deiner Art zu gehen«, sagt Kenny. »Du hüpfst bei jedem Schritt-bop! - wie ein Ball.«
»Bop«, sagt Callan. »Gefällt mir.«
»Wer hat dich denn gefragt«, sagt Kenny.
An dem Punkt mischt sich Murphy ein. »Wieso Bop? Das ist doch ein Scheißname für einen Iren! Guckt doch mal seine roten Haare an. Wenn der sich an die Kreuzung stellt, bleiben die Autos stehen. Dann noch bleich mit Sommersprossen. Den könnt ihr doch nicht Bop nennen! Bei einem Schwarzen, kein Problem. Aber das hier ist der weißeste Typ, den ich je gesehen hab.«
Kenny denkt drüber nach.
»Du meinst, es soll irisch klingen?«
»Ja, verdammt.«
»Okay«, sagt Kenny. »Wie wär's dann mit O'Bop?« Aber so, wie er das sagt, liegt die Betonung auf dem O, also wird O-Bop daraus.
Und der Name bleibt hängen.
Jedenfalls, O-Bop kriegt sich nicht mehr ein wegen Eddie the Butcher.
»Ich meine, scheiß auf den Typen!«, sagt er. »Denkt der, der kann machen, was er will, weil er für Matty Sheehan arbeitet? Wer ist denn schon Matt Sheehan? Irgendein versoffener Ire, der immer noch still in sein Bier weint wegen Jack Kennedy. Vor dem soll ich Angst haben? Der soll sich selber ficken. Alle beide sollen sich selber ficken.«
»Nur die Ruhe«, sagt Callan.
»Ruhe am Arsch!«, sagt O-Bop. »Was die mit Michael Murphy gemacht haben, das war übel.«
Er lässt den Kopf hängen, starrt in sein Bier, wird so trübsinnig wie der ganze Nachmittag.
Es dauert keine zehn Minuten, da kommt Eddie the Butcher rein.
Eddie Friel ist ein Hüne. Er kommt rein, sieht O-Bop und ruft ziemlich laut »Hey, Schamhaar!«
O-Bop reagiert nicht, dreht sich nicht um.
»Hey!«, brüllt Eddie. »Ich rede mit dir. Oder sind das keine Schamhaare auf deinem Kopf? Rot und gekräuselt?«
Callan sieht, wie O-Bop sich umdreht.
»Was willst du?«
Er versucht, cool zu wirken, aber Callan merkt, dass er Angst hat.
Ist doch klar. Auch Callan hat Angst. »Ich höre, du hast ein Problem mit mir«, sagt Eddy Friel. »Nein, ich hab kein Problem«, sagt O-Bop. Was im Moment, denkt Callan, das Klügste ist. Nur dass sich Friel nicht damit zufriedengibt.
»Denn wenn du ein Problem mit mir hast: Hier bin ich.«
»Nein, ich hab kein Problem.«
»Da hab ich aber was anderes gehört«, sagt Friel. »Ich habe gehört, du erzählst rum, du hast ein Problem, weil ich irgendwas gemacht haben soll.«
»Nein.«
Wenn das nicht an einem dieser mörderischen New Yorker Augustnachmittage passiert wäre, hätte es wahrscheinlich hiermit geendet. Hätte das Liffey eine verdammte Klimaanlage gehabt, wäre an dem Punkt wahrscheinlich Schluss gewesen. Aber eine Klimaanlage gibt's da nicht, nur ein paar Deckenventilatoren, die ihre dicke Staubschicht und ein paar tote Fliegen Karussell fahren lassen, jedenfalls endet die Sache nicht da, wo sie hätte enden sollen.
Dabei hat O-Bop hat schon den totalen Rückzieher gemacht. Er hat quasi den Schwanz eingekniffen, und es gibt keinen Grund, die Sache noch weiter zu treiben, außer dass Eddie ein sadistisches Arschloch ist. Also macht er weiter.
»Du verlogener kleiner Schwanzlutscher«, sagt er zu O-Bop.
Mickey Haggerty am anderen Ende der Bar guckt endlich hoch von seinem Bier und sagt: »Eddie, der Junge hat dir doch gesagt, er hat kein Problem.«
»Hat dich einer gefragt, Mickey?«, sagt Friel.
Mickey sagt: »Der ist doch noch ein Kind, Himmelherrgott.«
»Dann soll er nicht rumlaufen und Sachen erzählen wie ein Mann«, sagt Friel. »Dann soll er nicht rumlaufen und erzählen, dass gewisse Leute nicht das Recht haben, das Viertel zu kontrollieren.«
»Es tut mir leid«, winselt O-Bop. Seine Stimme zittert.
»Ja, jetzt tut's dir leid, du mieser kleiner Wichser«, sagt Friel. »Du heulst ja wie ein kleines Mädchen, und du willst der Mann sein, der behauptet, dass gewisse Leute nicht das Recht haben, das Viertel zu kontrollieren?«
»Ich hab doch gesagt, es tut mir leid«, winselt O-Bop.
»Klar. Das hab ich jetzt gehört. Und was erzählst du hinter meinem Rücken?«
»Nichts.«
»Nichts?« Friel zieht eine 38er unterm Hemd vor. »Auf die Knie!«
»Was?«
»Was heißt hier >was<?«, äfft ihn Friel nach. »Runter mit dir auf die Knie, du kleiner Schwanzlutscher.«
O-Bop ist sowieso ein blasser Typ, aber jetzt wird er weiß wie eine Wand. Er sieht schon tot aus, und vielleicht ist er schon tot, denn so wie sich die Sache anlässt, wird ihn Friel auf der Stelle erschießen.
O-Bop steigt zitternd vom Hocker. Er muss sich mit den Händen auf dem Fußboden aufstützen, damit er nicht hinfällt, wenn er in die Knie geht. Und er weint - dicke Tränen rollen ihm übers Gesicht.
Eddie hat ein widerliches, schleimiges Grinsen in der Visage. »Hör auf«, sagt jetzt Callan zu Friel. Friel wendet sich Callan zu.
»Du hängst dich da rein?«, sagt Friel. »Du musst dich entscheiden, für wen du bist, für ihn oder für uns.« Friel starrt ihn an und wartet.
»Für ihn«, sagt Callan, zieht eine 22er unterm Hemd vor und schießt Eddie the Butcher zwei Löcher in die Stirn.
Eddie sieht aus, als könnte er's nicht glauben. Er starrt Callan fassungslos an, dann klappt er zusammen. Liegt der Länge nach auf dem dreckigen Fußboden. Jetzt tritt O-Bop in Aktion. Er nimmt Eddie die 38er aus der Hand, schiebt sie in Eddies Mund und drückt ab.
Dabei weint er und schreit Obszönitäten.
Billy Shields steht mit erhobenen Händen hinter der Theke. »Ich hab kein Problem«, sagt er.
Little Mickey blickt von seinem Bier auf. »Jetzt haut mal lieber ab«, sagt er zu Callan.
»Soll ich die Kanone hierlassen?«, fragt Callan.
»Nein«, sagt Mickey. »Schmeiß sie in den Hudson.«
Zwischen der 38th und 57th Street liegt mehr Hardware auf dem Grund des Hudson River als, sagen wir, in Pearl Harbor, was Mickey natürlich weiß, jedenfalls werden die Bullen nicht gerade dort nach der Waffe fischen, mit der Eddie the Butcher ins Jenseits befördert wurde. Und bei den Leuten im Viertel wird sich die Empörung in Grenzen halten. Eddie Friel wurde erschossen? Oh. Wollen Sie Schokoglasur drauf?
Nein, nicht die Bullen sind das Problem, sondern Matt Sheehan. Nicht dass Mickey nun zu Matt rennt und ihm erzählt, wer Eddie umgelegt hat, Matt könnte zwar beim Haftrichter ein gutes Wort einlegen, damit Mickey wegen der Geiselnahme nicht so hart rangenommen wird, aber daran hat er kein Interesse, also glaubt Mickey nicht, dass er ihm Loyalität schuldig ist.
Doch Billy Shields, der Barmann, bemacht sich fast vor Eifer, wenn es darum geht, sich bei Big Matt einzukratzen. Das heißt, die zwei Kids können sich schon mal selber an Fleischerhaken aufhängen, um Matt die Mühe zu ersparen. Außer, sie schaffen es, Big Matt vorher zu erledigen, und das schaffen sie nicht. Sie sind also schon so gut wie tot, nur hat es wenig Sinn, im Viertel rumzuhängen und auf die Kugel zu warten.
»Haut ab«, sagt Mickey zu ihnen. »Verschwindet aus der Stadt.«
Callan steckt seine 22er wieder unters Hemd und hilft O-Bop auf die Beine, der immer noch neben Eddies Leiche hockt. »Komm«, sagt er. »Moment noch.«
O-Bop wühlt in Friels Taschen und fördert einen Batzen Geldscheine zutage. Rollt ihn auf die Seite und holt etwas aus seiner Gesäßtasche.
Ein schwarzes Notizbuch.
»Okay«, sagt O-Bop.
Zusammen verlassen sie die Bar.
Zehn Minuten später sind die Bullen da.
Der Mann vom Morddezernat macht einen großen Schritt über die Blutpfütze, die sich als roter See um Friels Kopf ausbreitet, und wendet sich an Mickey. Er kennt Mickey, weil er gerade vom Raubdezernat ins Morddezernat aufgestiegen ist. Zieht die Schultern hoch und fragt Mickey: »Was war hier los?«
»Der ist beim Duschen ausgerutscht«, sagt Mickey.
Sie kommen nicht mal bis zum Stadtrand.
Was sie machen: Sie gehen Mickeys Rat folgend auf dem kürzesten Weg zum Hudson und entsorgen die Pistolen.
Dann zählen sie das Geld durch.
»Dreihundertsiebenundachtzig Kröten«, sagt O-Bop.
Enttäuschend wenig.
Mit dreihundertsiebenundachtzig Kröten kommen sie nicht weit.
Außerdem wissen sie nicht, wohin.
Sie sind Kinder dieser Gegend, sind noch nie rausgekommen, wissen nicht, wie man sich in der Fremde durchschlägt, was man tut und was man lässt, wie man funktioniert. Sie müssten mit dem Bus weg. Aber wohin?
In einem Eckladen kaufen sie ein paar Flaschen Bier, dann verziehen sie sich in eine Nische unter dem West Side Highway, um erst mal nachzudenken.
»Jersey?«, fragt O-Bop.
So weit etwa reicht ihr geographischer Horizont. »Kennst du wen in Jersey?«, fragt Callan. »Nein, du?«
»Nein.«
Nur in Hell's Kitchen kennen sie Leute, also killen sie noch ein paar Flaschen, warten, bis es dunkel ist, und schleichen sich zurück in ihre vertraute Nachbarschaft. Knacken ein leerstehendes Lagerhaus und schlafen dort. Am Morgen gehen sie zum Apartment von Bobby Remingtons Schwester in der 50th Street.
Bobby ist da, weil er gerade wieder Zoff mit seinem Alten hatte.
Kommt an die Tür, sieht Callan und O-Bop dastehen und zieht sie schnell rein.
»Heilige Scheiße, was habt ihr gemacht?«
»Er wollte Stevie erschießen«, erklärt ihm Callan.
Bobby schüttelt den Kopf. »Er wollte ihn nicht erschießen. Nur in den Mund pissen, das ist alles.«
Callan zuckt die Schulter. »Egal.«
»Suchen sie uns?«, fragt O-Bop.
Bobby antwortet nicht. Er ist zu sehr damit beschäftigt, die Rollos runterzuziehen.
»Bobby, hast du eine Tasse Kaffee für uns?«, fragt Callan. »Klar, ich mache welchen.«
Jetzt kommt Beth Remington aus dem Schlafzimmer. In einem Rangers-Jersey, das ihr bis auf die Schenkel reicht. Ihr rotes Haar ist gewaltig zerzaust und fällt ihr bis auf die Schultern. Sie sieht Callan und sagt »Scheiße«.
»Hi, Beth.«
»Ihr müsst hier verschwinden.«
»Ich mach ihnen nur ein bisschen Kaffee, Beth.«
»Hey, Bobby«, sagt Beth. Sie schnipst eine Zigarette aus der Schachtel vom Küchentisch, hängt sie in den Mundwinkel und zündet sie an. »Reicht schon, dass ich dich auf meiner Couch habe. Diese Typen kann ich nicht brauchen. Nichts für ungut.«
O-Bop sagt: »Bobby, wir brauchen Hardware.«
»Na, toll«, sagt Beth und pflanzt sich neben Callan auf die Couch. »Warum seid ihr überhaupt zu mir gekommen?«
»Wo hätten wir denn sonst hingehen sollen?«
»Fühle mich geehrt.« Da hat sie sich ein paarmal mit ihm besoffen, ein bisschen mit ihm rumgemacht, und jetzt denkt er, er kann hier aufkreuzen, wenn er Ärger kriegt. »Bobby, mach ihnen Toast oder so was.«
»Danke«, sagt Callan.
»Hier könnt ihr nicht bleiben.«
»Also Bobby«, sagt O-Bop. »Kannst du uns was besorgen?«
»Wenn das rauskommt, bin ich geliefert.«
»Geh doch zu Burke, sag ihm, du brauchst die Sachen für dich.«
»Was macht ihr eigentlich noch hier?«, fragt Beth. »Ihr müsstet längst in Buffalo sein.«
»Buffalo?«, fragt O-Bop. »Wieso Buffalo?«
Beth zuckt die Schultern. »Zu den Niagara-Fällen, was weiß ich.«
Sie trinken ihren Kaffee, essen ihren Toast. »Ich gehe zu Burke«, sagt Bobby.
»Genau das fehlte noch«, sagt Beth. »Dich mit Matty Sheehan anlegen.«
»Scheiß auf Sheehan«, sagt Bobby.
»Dann sag's ihm doch persönlich«, meint Beth und wendet sich an Callan. »Was ihr braucht, sind nicht Kanonen, sondern Bustickets. Ich hab ein bisschen Geld ...«
Beth ist Kassiererin beim Loew's Theater in der 42nd Street und verkauft das eine oder andere Ticket auf eigene Rechnung. So hat sie ein bisschen angespart.
»Geld haben wir selber«, sagt Callan. »Dann haut ab.«
Das tun sie. Sie fahren die ganze Strecke bis zur Upper West Side, hängen im Riverside Park rum, am Grab von Grant. Dann kommen sie wieder zurück; Beth lässt sie ins Loew's, und sie setzen sich den ganzen Tag in die hinterste Reihe des Balkons und gucken Star Wars.
Als sich der blödsinnige Todesstern zum sechsten Mal anschickt zu explodieren, taucht Bobby mit einer Tüte auf und lässt sie vor Callans Füßen stehen.
»Toller Film, was?«, sagt er und ist so schnell weg, wie er gekommen ist.
Callan streift mit dem Fußknöchel über die Tüte und stößt gegen Metall.
Dann gehen sie in die Herrentoilette und gucken in die Tüte rein.
Eine alte 25er und eine mindestens ebenso alte 38er Polizeipistole.
»Was soll das?«, fragt O-Bop. »Warum keine Vorderlader?«
»Wer bettelt, darf nicht wählerisch sein.«
Callan fühlt sich wesentlich besser mit ein bisschen Hardware im Gürtel. Schon lustig, wie schnell dir was fehlt, wenn da nichts im Gürtel steckt, denkt er. Dir wird ganz leicht, als könntest du jeden Moment abheben. Das Metall hält dich am Boden.
Kurz vor Schluss verlassen sie das Kino und machen sich auf den Weg zum Lagerhaus. Mit aller Vorsicht.
Eine Krakauer rettet ihnen das Leben.
Die halbe Nacht schon sitzt Tim Healey hier oben, um auf die beiden zu warten, und er schiebt einen solchen Knast, dass er Jimmy Boylan losschickt, eine Krakauer holen.
»Was willst du dazu?«, fragt Boylan.
»Sauerkraut, scharfen Senf, das übliche«, sagt Tim.
Also holt ihm Boylan die Wurst, und Tim schlingt sie runter, als hätte er den Krieg in einem japanischen Lager verbracht. In seinen Eingeweiden verwandelt sich diese harte Wurst auf wundersame Weise in Gas, und das gerade in dem Moment, als Callan und O-Bop die Treppe raufkommen. Sie stehen auf der anderen Seite der geschlossenen Stahltür, als Healy einen fahren lässt.
Und erstarren zu Salzsäulen.
»Meine Fresse!«, hören sie Boylan sagen. »Gab es Verletzte?«
Callan und O-Bop wechseln einen Blick. »Hat uns Bobby verpfiffen?«, flüstert O-Bop. Callan zuckt die Schultern.
»Ich mach mal die Tür auf, damit ich Luft kriege«, sagt Boylan. »Also wirklich, Tim.«
»Sorry.«
Boylan macht die Tür auf und sieht die Jungs. »Scheiße!«, schreit er, während er die Pistole hebt, aber Callan hört nur den Widerhall der Schüsse im Treppenhaus, die er und O-Bop auf ihn abgegeben haben.
Tim Healey rutscht die Alufolie vom Schoß, als er vom Klappstuhl aufsteht, um seine Kanone zu holen. Aber als er Jimmy Boylan rückwärts stolpern sieht und Teile von ihm aus seinem Rücken rausfliegen, verliert er die Nerven. Er lässt seine 45er fallen und hebt die Hände.
»Leg ihn um!«, brüllt O-Bop.
»Nein, nein, nein, nein!«, schreit Healey.
Sie kennen Fat Tim Healey, seit sie denken können. Er hat ihnen immer Quarters für ihre Comics geschenkt. Einmal beim Hockeyspielen auf der Straße hat Callan Tim Healeys rechten Scheinwerfer mit einem Backswing erwischt. Healey kam aus dem Liffey, lachte darüber und sagte nur: »Schon gut. Wenn ihr für die Rangers spielt, besorgt ihr mir Tickets, okay?« Mehr hat er nicht gesagt.
Jetzt verhindert Callan, dass O-Bop ihn umlegt.
»Schnapp dir seine Kanone!«, schreit er ihm zu.
Er muss schreien, weil ihm die Ohren klingeln. Seine Stimme klingt, als käme sie aus einem Tunnel, und sein Kopf tut tierisch weh.
Healey hat Senf am Kinn.
Irgendwas sagt er von »zu alt für diese Scheiße«. Als gäbe es das richtige Alter für diese Scheiße, denkt Callan. Sie schnappen sich Healeys 45er und Boylans Flinte und hauen ab.
Im Laufschritt.
Big Matty rastet aus, als er das von Eddie the Butcher hört.
Erst recht, als er hört, dass die zwei, die das gemacht haben, praktisch noch in die Windeln scheißen. Hat denn diese junge Generation überhaupt keinen Respekt mehr vor der Autorität? Wohin soll das führen? Was ihn außerdem nervt, sind die vielen Leute, die ihn anflehen, in diesem Falle Gnade vor Recht ergehen zu lassen.
»Strafe muss sein«, erklärt ihnen Big Matt, aber es regt ihn maßlos auf, wenn sie seine Entscheidung in Frage stellen.
»Klar«, sagen sie. »Man könnte ihnen die Beine oder Handgelenke brechen, sie aus Hell's Kitchen verbannen. Aber Exitus? Das haben sie nicht verdient.«
Widerspruch ist Big Matt nicht gewohnt. So was mag er nicht. Und noch weniger gefällt ihm, dass der Buschfunk nicht mehr zu funktionieren scheint. Eigentlich hätten die beiden Hosenscheißer schon Stunden später erledigt sein müssen, aber jetzt sind sie seit Tagen abgetaucht und zwar, was ihn besonders empört, hier im Viertel. Trotzdem weiß angeblich keiner, wo sie stecken.
Selbst die nicht, die es wissen müssten.
Er ringt sich sogar dazu durch, das Strafmaß zu revidieren. Beschließt, dass es vielleicht das Richtige ist, ihnen nur die Hände abzuhacken, mit denen sie zur Waffe gegriffen haben. Je länger er drüber nachdenkt, desto besser gefällt ihm die Idee. Sollen sie doch mit Armstummeln durch Hell's Kitchen laufen, zur Mahnung für alle anderen, dass man der Autorität mit Respekt zu begegnen hat.
Also wird er ihnen die Hände abhacken lassen, und damit fertig -
Zeigen, dass Big Matt Sheehan ein Gemütsmensch ist.
Dann erst fällt ihm ein, dass er keinen Eddie the Butcher mehr hat, der das Abhacken besorgen kann.
Einen Tag später hat er auch keinen Jimmy Boylan und Tim Healey mehr, weil Boylan tot ist und Healey spurlos verschwunden. Und Kevin Kelly findet plötzlich Gründe, sich um irgendwelche Geschäfte in Albany zu kümmern. Marty Stone hat eine kranke Tante in Far Rockaway, und Tommy Dugan ist gerade auf dem Sauftrip.
All das verleitet Big Matt zu der Annahme, dass da ein Putsch - eine regelrechte Revolution - gegen ihn im Gange ist.
Vorsorglich bucht er einen Flug nach Florida, wo er seinen zweiten Wohnsitz hat.
Was eigentlich eine gute Nachricht für Callan und O-Bop ist. Nur sieht es so aus, als hätte sich Matt, bevor er ins Flugzeug stieg, mit Big Paulie Calabrese in Verbindung gesetzt, dem neuen Boss der Cimino-Familie, weil der ihm einen Gefallen schuldig ist.
»Einen Gefallen wofür?«, fragt Callan.
»Vielleicht für ein Stück vom Javits Center?«, sagt O-Bop.
Big Matt kontrolliert die Bau- und Transportarbeitergewerkschaften, die am Bau des riesigen Kongresszentrums auf der West Side beteiligt sind. Die Italiener haben ein Jahr lang oder länger nach einem Stück von diesem Kuchen gegiert. Allein die Provisionen aus dem Zementgeschäft sind Millionen wert. Im Moment ist Matt nicht in der Position, mit einem Nein durchzukommen, aber für sein Ja kann er mit Fug und Recht einen kleinen Gefallen erwarten.
Eine Frage der Kulanz.
Callan und O-Bop sind in einem Apartment der 49th Street zwischen Tenth und Eleventh Avenue eingesargt. Sehr viel Schlaf ist ihnen nicht vergönnt. Sie liegen da und starren an den Himmel. Oder das, was man in New York vom Himmel zu sehen kriegt.
»Wir haben zwei Kerle umgelegt«, sagt O-Bop.
»Stimmt.«
»War allerdings Notwehr«, sinniert O-Bop. »Ich meine, es ging nicht anders, oder?«
»Stimmt.«
Eine Weile später sagt O-Bop: »Ich bin neugierig, ob Mickey Haggerty uns für einen Deal verbrät.«
»Meinst du, das macht er?«
»Den erwarten acht bis zwölf Jahre wegen Raub«, sagt O-Bop. »Da käme ihm ein Deal gerade recht.«
»Nein«, sagt Callan. »Mickey ist alte Schule.«
»Mag ja sein, dass er alte Schule ist«, wendet O-Bop ein. »Aber vielleicht will er einfach nicht so lange in den Bau. Das ist sein zweites Mal.«
Callan weiß, dass Mickey seine Zeit absitzen und erhobenen Hauptes ins Viertel zurückkommen will. Und Mickey weiß, dass ihm keine Bar in Hell's Kitchen auch nur ein Schälchen Erdnüsse hinstellen wird, sollte er irgendwann singen.
Mickey Haggerty ist die kleinste ihrer Sorgen.
Das jedenfalls findet Callan. Vor allem, wenn er sich den Lincoln Continental ansieht, der auf der anderen Straßenseite parkt.
»Eigentlich können wir's gleich hinter uns bringen«, sagt er zu O-Bop.
O-Bop hält seinen roten Lockenkopf unter den Küchenhahn und versucht, sich Kühlung zu verschaffen. Na dann, viel Spaß. Draußen sind vierzig Grad, sie sitzen in einem Zweizimmerapartment der fünften Etage, mit einer Art Spielzeugventilator, und der Wasserdruck liegt bei Null, weil die kleinen Rabauken alle Hydranten der Straße aufgedreht haben. Und als war das nicht schon schlimm genug, steht da unten eine Crew der Cimino-Familie und wartet auf eine günstige Gelegenheit zum Zuschlagen.
Und die wird sich ergeben, wenn die Dunkelheit ihren Schleier über das Geschehen breitet.
»Was willst du machen?«, fragt O-Bop. »Willst du runtergehen und anfangen, rumzuballern? Massenschießerei in Hell's Kitchen?«
»Das ist besser, als hier oben in der Hitze einzugehen.«
»Ist es nicht«, befindet O-Bop. »Klar ist das stressig hier oben, aber auf der Straße erschießen sie uns wie die Hunde.«
»Irgendwann müssen wir runter«, sagt Callan.
»Müssen wir nicht.« O-Bop zieht den Kopf unter dem Hahn hervor und schüttelt das Wasser ab. »Wozu gibt's den Pizza-Service?«
Er kommt ans Fenster und schaut sich den langen schwarzen Lincoln an.
»Die Spaghettis bleiben sich doch immer gleich«, sagt O-Bop. »Man sollte meinen, dass sie irgendwann auch mal im Mercedes aufkreuzen, im BMW oder Volvo. Aber nein. Immer nur beschissene Lincolns und Caddies. Ich schätze, das ist bei denen so eine Art Kodex.«
»Wer sitzt denn in dem Auto drin, Stevie?«
Vier Typen sitzen im Auto, drei stehen draußen rum. So ganz locker. Rauchen, quatschen, trinken Kaffee. Wie um der Nachbarschaft anzudeuten: Leute, verzieht euch, hier gibt's gleich Ärger.
O-Bop sieht noch mal genauer hin.
»Das ist Piccones Crew, und die ist die Subcrew von Johnny Boy Cozzos Crew«, konstatiert er. »Der Demonte-Zweig der Cimino-Familie.«
»Woher weißt du das?«
»Der Typ auf dem Beifahrersitz frisst Pfirsiche aus der Büchse«, sagt O-Bop. »Das ist Jimmy Piccone, auch Jimmy Peaches genannt. Der Mann mit dem Pfirsich-Fimmel.«
O-Bop ist ein wandelndes Familienlexikon der Mafia. Er bleibt an diesen Dingen dran wie andere an ihrer Baseballmannschaft. Er hat die komplette Organisationsstruktur der Fünf Familien im Kopf.
Folglich ist er auch mit der Tatsache vertraut, dass sich die Ciminos seit dem Tod von Carlo Cimino in einer Art Umbruch befinden. Die meisten in der Szene waren sicher, dass Neill Demonte die Nachfolge von Cimino antreten würde, doch stattdessen entschied der sich für seinen Schwager Paulie Calabrese.
Diese Entscheidung stieß auf wenig Gegenliebe, besonders bei der alten Garde, die Calabrese für ein Weichei hielt. Zu sehr darauf bedacht, das Geld in legale Kanäle zu lenken. Die schweren Jungs - Kredithaie, Schutzgeld-Erpresser, ganz gewöhnliche Ganoven - mögen so was nicht.
Jimmy »Peaches« Piccone ist einer von diesen schweren Jungs. Jetzt sitzt er unten im Lincoln und redet genau über dieses Thema.
»Wir sind der kriminelle Cimino-Clan«, sagt Peaches zu seinem Bruder Little Peaches. Joey »Little Peaches« Piccone ist in Wirklichkeit größer als sein großer Bruder, aber niemand würde das laut sagen, also bleiben die Spitznamen, wie sie sind. »Selbst in der New York Times nennt man uns den kriminellen Cimino-Clan. Wir sind Kriminelle und bleiben Kriminelle. Wollte ich Geschäftsmann werden, würde ich zu, sagen wir, IBM gehen.«
Auch Peaches gefällt es nicht, dass Demonte als Boss übergangen wurde. »Er ist ein alter Mann, er hat sich die paar Jahre auf der Sonnenseite redlich verdient. Warum hat ihn der Alte nicht zum Boss gemacht und Johnny Boy Cozzo zum Capo? Dann könnten wir unser Ding machen. Unsere cosa nostra.«
Für seine jungen Jahre - er ist sechsundzwanzig - ist Peaches auffallend rückwärtsgewandt, ein Konservativer. Er schwört auf die gute alte Zeit, auf die alten Traditionen.
»In den alten Zeiten hätten wir das ganz anders gemacht«, sagt Peaches, als wäre er damals schon dabei gewesen. »Da hätten wir uns unser Stück vom Javits Center einfach genommen. Und müssten nicht irgendeiner Harfe wie Matty Sheehan in den Arsch kriechen. Und Paulie will uns das auch noch schmackhaft machen. Den interessiert es doch einen Scheiß, ob wir verhungern.«
»Hey«, sagt Little Peaches. »Hey was?«
»Hey, Paulie gibt diesen Job hier an Neill Demonte, Neill Demonte gibt ihn an Johnny Boy Cozzo, und Johnny Boy Cozzo gibt ihn an uns«, sagt Little Peaches. »Also: Johnny Boy gibt uns den Job, wir machen den Job, und mehr muss ich nicht wissen.«
»Klar doch, wir machen den Job«, ätzt Peaches. Er kann es nicht leiden, wenn ihn sein kleiner Bruder belehrt. Peaches weiß, wie es läuft, ihm gefällt, wie es läuft, besonders im Demonte-Zweig der Familie, wo alles so läuft wie in den guten alten Zeiten.
Und noch was. Peaches ist ein verdammter Fan von Johnny Boy Cozzo.
Johnny Boy Cozzo verkörpert alles, was die Mafia mal war. So soll es wieder sein, denkt Peaches.
»Sobald es dunkel ist«, sagt Peaches, »gehen wir zu denen hoch und lochen ihr Ticket.«
Callan sitzt da und blättert sich durch das schwarze Notizbuch.
»Hier steht dein Dad drin«, sagt er.
»Na, so eine Überraschung«, erwidert O-Bop. »Mit wie viel?«
»Zweitausend.«
»Wahrscheinlich hat er beim Pferderennen auf ein paar Brauereigäule gewettet«, sagt O-Bop. »Hey, da kommt unsere Pizza ... Hey, was soll der Scheiß? Die nehmen uns die Pizzen weg!«
Jetzt ist O-Bop echt sauer. Dass ihn diese Kerle umlegen wollen, juckt ihn nicht weiter, das war zu erwarten, das ist ihr Job - aber dass sie ihm die Pizza wegschnappen, bringt ihn auf die Palme.
»Das können die doch nicht machen!«, jammert er. »Das ist einfach übel!«
Ein Spruch, mit dem, wie sich Callan jetzt erinnert, die ganze Geschichte überhaupt erst angefangen hat.
Als er von dem schwarzen Notizbuch aufblickt, sieht er, wie ihm der grinsende fette Spaghetti da unten ein Stück Pizza entgegenstreckt.
»Hey!«, brüllt O-Bop.
»Schmeckt gut!«, brüllt Peaches zurück.
»Die haben unsere Pizza«, sagt O-Bop zu Callan.
»Na und?«
»Ich hab aber Hunger!«, jammert O-Bop.
»Dann geh doch runter und hol sie dir«, sagt Callan.
»Das könnte ich glatt.«
»Nimm ein Schießeisen mit.«
»Scheiße!«
Callan hört, wie die Jungs auf der Straße über sie lachen. Doch im Unterschied zu O-Bop macht es ihm nichts aus. O-Bop erträgt es nicht, ausgelacht zu werden, und fängt sofort Krach an. Das war schon immer das Problem bei ihm. Callan kann es einfach wegstecken.
»Stevie?«
»Was?«
»Wie, sagtest du, hieß der Typ da unten?«
»Welcher?«
»Der Typ, der uns umlegen soll.«
»Jimmy Peaches.«
»Der steht hier drin.«
»Was du nicht sagst.« O-Bop dreht sich vom Fenster weg. »Mit wie viel?«
»Hunderttausend.«
Sie wechseln einen Blick und fangen an zu lachen. »Callan«, sagt O-Bop, »jetzt kriegt die Sache eine ganz neue Wendung.«
Denn Peaches Piccone schuldet Matty Sheehan hunderttausend Dollar. Und das ist nur die Grundsumme. Die Zinsen dürften schneller wachsen als der Gestank beim Müllarbeiterstreik. Das heißt, Piccone steckt ganz schön in der Scheiße - bis zum Stehkragen. Was eigentlich eine schlechte Nachricht ist, denn um so mehr Grund hat er, Matt Sheehan einen richtig großen Gefallen zu tun, doch jetzt haben Callan und O-Bop das Notizbuch.
Und damit haben sie einen Hebel in der Hand.
Sie müssen nur lange genug leben, um ihn anzusetzen.
Draußen wird es gerade dunkel, und das sehr schnell.
»Hast du irgendeine Idee?«, fragt O-Bop.
»Ja, hab ich.«
Es ist einer dieser aussichtslosen Versuche, aber Scheiße, was haben sie schon zu verlieren?
O-Bop geht mit der Milchflasche auf die Feuertreppe raus.
Brüllt runter. »Hey ihr Spaghetti-Idioten!«
Die blicken von ihrem Continental hoch.
Während O-Bop den Lappen anzündet, der in der Milchflasche steckt, »guten Appetit!« brüllt und die Flasche mit lässiger Geste in Richtung Lincoln wirft.
»Was zum Teufel -«
Der Ausruf kommt von Peaches, der das Fenster runterlässt und sieht, wie diese Irrsinnsfackel direkt auf ihn zugeflogen kommt, also beeilt er sich, aus dem Wagen zu kommen, und er schafft es gerade noch rechtzeitig, denn O-Bop hat gut gezielt, die Flasche zerkracht auf dem Wagendach und setzt den Lincoln im Flammen.
»Der war neu, du Drecksau!«, brüllt Peaches zur Feuertreppe hoch.
Und ist richtig sauer, weil er nicht losballern kann, denn sofort sammeln sich Zuschauer, jetzt heulen auch schon die Sirenen, es kann sich nur um Minuten handeln, bis die ganze Straße voll von irischen Bullen und irischen Feuerwehrleuten ist, die löschen wollen, was dann noch vom Lincoln übrig ist.
Irische Bullen und irische Feuerwehrleute und etwa fünfzehntausend bekloppte Transen von der Ninth Avenue, die jetzt Peaches umtanzen und schreien und kreischen und ihren Zirkus machen. Er schickt Little Peaches zur Telefonzelle an der Ecke, einen neuen Wagen anfordern, und als Little Peaches weg ist, spürt er plötzlich einen metallischen Gegenstand an seiner linken Niere, und jemand flüstert: »Mr. Piccone, drehen Sie sich bitte um. Aber ganz langsam.«
Es klingt irgendwie respektvoll, was Peaches sehr zu schätzen weiß.
Er dreht sich um und sieht sich mit einem irischen Milchbart konfrontiert - nicht mit dem roten Brillo-Pad, der die Flasche geworfen hat, sondern mit einem großen Dunklen, der sein Schießeisen in einer braunen Tüte versteckt und ihm etwas unter die Nase hält.
Was zum Teufel ist das?, fragt sich Peaches.
Dann erkennt er es.
Matty Sheehans schwarzes Notizbuch.
»Wir sollten miteinander reden«, sagt der Milchbart.
»Ja, das sollten wir«, erwidert Peaches.
Also stehen sie jetzt im Keller von Paddy Hoyles Schmuddelrestaurant, drüben in der Twelfth Avenue, und man könnte das, was hier läuft, als Mexikanisches Patt bezeichnen, nur dass weit und breit keine Mexikaner zu sehen sind.
Es ist eher eine Art italo-irische Begegnung, und die sieht so aus, dass Callan und O-Bop buchstäblich mit dem Rücken an der Wand stehen. Callan wie ein Desperado, in jeder Hand eine Pistole, O-Bop mit seiner Flinte, die er in Hüfthöhe hält. Und ihnen gegenüber, an der Tür, die zwei Piccone-Brüder. Die Italiener haben nicht blankgezogen. Stehen einfach nur da in ihren schicken Klamotten und wirken kühl und gelassen.
O-Bop respektiert das, er kann es verstehen. Da sie heute Abend schon einmal das Nachsehen hatten - von dem Lincoln ganz zu schweigen -, werden sie sich nicht noch eine Blöße geben und sich von zwei Straßenkötern aus der Ruhe bringen lassen, die ihr ganzes Waffenarsenal auf sie gerichtet haben. Das ist Mafia-Stil, das hat Klasse, und O-Bop bewundert es.
Callan bleibt kalt wie ein Rattenarsch.
Wenn das Ding in die falsche Richtung läuft, drückt er einfach ab und sieht zu, was passiert.
»Wie alt seid ihr überhaupt?«, fragt Peaches. »Zwanzig«, lügt O-Bop. »Einundzwanzig«, lügt Callan.
»Ihr seid ja zwei richtige kleine Ganoven, alle Achtung«, sagt Peaches. »Jedenfalls, wir müssen das bereinigen. Die Sache mit Eddie Friel.«
Jetzt kommt's, denkt Callan. Er ist nur eine Muskelzuckung vom Abdrücken entfernt.
»Ich habe diese perverse Sau gehasst«, sagt Peaches. »Anderen Leuten in den Mund pissen! Was soll das? Wie viele Kugeln habt ihr ihm verpasst? Acht Stück? Ihr wolltet ganze Arbeit leisten, was?«
Er lacht. Little Peaches auch. Und O-Bop.
Nur Callan nicht. Callan passt auf. »Tut mir leid wegen dem Auto«, sagt O-Bop. »Okay«, sagt Peaches. »Wenn ihr das nächste Mal mit uns reden wollt, benutzt das verdammte Telefon, verstanden?« Alle lachen, außer Callan.
»Das versuche ich ja Johnny Boy die ganze Zeit zu erklären«, sagt Peaches. »Ihr schickt mich rüber auf die West Side, sage ich zum ihm, zu den Zulus, den Puertos und den wilden Iren. Was zum Teufel soll ich da ausrichten? Ich werde ihm sagen, die Iren schmeißen Feuer vom Himmel, und jetzt brauche ich einen neuen Wagen. Verdammte Wilde, diese Iren. Habt ihr in das kleine schwarze Buch reingeguckt?«
»Was glaubt ihr denn?«
»Ich glaube, ihr habt's getan. Mit Bestimmtheit. Was habt ihr gesehen?«
»Hängt davon ab.«
»Wovon?«
»Was hier passiert.«
»Dann sag mir, was hier passieren soll.«
Callan hört, wie O-Bop schluckt, weiß, dass O-Bop Todesängste aussteht, aber er zieht sein Ding durch. Na los, Stevie, denkt Callan. Spiel dein Spiel.
»Zuerst mal«, sagt O-Bop. »Wir haben das Buch nicht dabei.«
»Hey, Brillo«, sagt Peaches. »Wenn wir dich in die Zange nehmen, wirst du uns schon verraten, wo das Buch ist. Das ist keine Trumpfkarte, die ihr in der Hand habt. Und du nimm mal die Finger vom Abzug, noch reden wir miteinander.«
Sagt er mit einem Blick auf Callan.
O-Bop sagt: »Wir wissen über jeden Penny Bescheid, den Matt Sheehan in das Buch eingetragen hat.«
»Kein Witz - aber Sheehan schwitzt Blut und Wasser, weil sein Buch weg ist.«
»Scheiß auf Sheehan«, sagt O-Bop. »Das Buch kriegt er nicht zurück, und ihr schuldet ihm einen Dreck.«
»Ist das wahr?«
»Wenn's nach uns geht«, sagt O-Bop. »Und Eddie Friel wird nicht gefragt.«
O-Bop sieht die Erleichterung in Peaches' Gesicht, also gibt er noch eins drauf.
»Da stehen auch Bullen in dem Buch«, sagt er. »Gewerkschaftshirsche. Stadträte. Paar Millionen Dollar, die da im Umlauf sind.«
»Matty Sheehan ist ein reicher Mann«, sagt Peaches. »Warum denn er?«, sagt O-Bop. »Warum nicht wir? Warum nicht ihr?«
Sie sehen, wie es in Peaches arbeitet. Wie er Vorteil und Risiko abwägt. Nach einer Minute etwa sagt er: »Sheehan tut einiges für meinen Boss.«
O-Bop hält dagegen. »Wenn ihr das Buch habt, könnt ihr das auch.«
Callan merkt allmählich, dass es ein Fehler war, die Kanonen im Anschlag zu halten. Seine Arme werden lahm und zittrig. Sie jetzt sinken zu lassen wäre nicht das richtige Signal. Doch er hat Angst, nicht mehr sicher zu treffen, falls sich Peaches falsch entscheidet.
Dann fragt Peaches noch: »Habt ihr rumerzählt, dass mein Name in dem Buch steht?«
An der Schnelligkeit, mit der O-Bop verneint, erkennt Callan, wie wichtig die Antwort ist. Warum hat sich Peaches bei Matt Sheehan Geld geliehen?, fragt er sich. Was hat er damit gemacht?
Diese wilden Iren, sagt sich Peaches und ist beeindruckt. »Haltet euch bloß bedeckt. Und versucht, die nächsten Tage ausnahmsweise mal keinen umzulegen. Wegen dieser Sache melde ich mich.«
Damit dreht er sich um und geht die Treppe hoch, sein Bruder folgt ihm auf den Fersen.
»Jesus«, sagt Callan und setzt sich auf den Fußboden. Seine Hände zittern wie verrückt.
Peaches klingelt an Matt Sheehans Tür.
Irgendeine Harfe, ein massiger Typ, macht ihm auf. Peaches hört Sheehan fragen: »Wer ist das?«
Es klingt ziemlich ängstlich.
»Jimmy Peaches«, sagt der Dicke und lässt ihn rein. »Er ist in seinem Bau.«
»Danke.«
Peaches geht durch den Flur und biegt links in Mattys »Bau« ab.
Das ganze Zimmer ist knallgrün tapeziert. Und überall ist irischer Krempel verteilt, Kleeblätter und der ganze Scheiß. Ein großes Bild von John F. Kennedy. Ein anderes von Bobby. Sogar ein Papstbild. Nur ein irischer Kobold auf dem Hocker fehlt.
Im Fernsehen läuft das Spiel der Yankees.
Trotzdem erhebt er sich aus seinem Sessel - eine Geste, die Peaches mag -, empfängt Peaches mit einem breiten irischen Politikerlächeln und sagt: »Schön, dass du gekommen bist, James. Hast du dieses kleine Problem gelöst, während ich weg war?«
»Klar.«
»Du hast also diese zwei Rabauken aufgestöbert.«
»Klar.«
»Und?«
Bevor Sheehan auch nur »gosh and begorra« sagen kann, rammt ihm Jimmy das Messer rein. Versenkt die Klinge unter seinem linken Brustmuskel und dreht sie ein bisschen, um der Notaufnahme eine schwierige ethische Entscheidung zu ersparen.
Das verflixte Messer bleibt zwischen den Rippen stecken, Jimmy muss den Fuß auf Mattys breite Brust setzen und heftig zutreten, um es wieder rauszuholen. Sheehan knallt auf dem Boden auf, dass die Wände wackeln.
Der Dicke, der ihn reingelassen hat, steht in der Tür.
Sieht nicht so aus, als wollte er was unternehmen.
»Wie viel schuldest du ihm?«, fragt Peaches.
»Fünfundsiebzigtausend.«
»Du schuldest ihm nichts mehr«, sagt Peaches.
»Wenn er verschwindet.«
Sie zerlegen Matty, bringen ihn raus nach Wards Island und werfen ihn in die Kläranlage.
Einen Monat nach diesen Vorkommnissen, die in die irische Folklore von Hell's-Kitchen eingingen, hat sich Callans Leben ein bisschen verändert. Dass er es überhaupt noch besitzt, grenzt schon an ein Wunder, doch jetzt ist er auch noch zu einer Art Lokalheld geworden.
Denn während Peaches mit Sheehan kurzen Prozess machte, griffen er und O-Bop zu einem schwarzen Filzstift und strichen einige der Schulden, die in Mattys Notizbuch verzeichnet waren. Es war ein irrer Spaß - manche Schulden ganz zu tilgen, andere zu reduzieren und die einträglichsten Posten in eigene Regie zu übernehmen.
Fette Zeiten in Hell's Kitchen.
Callan und O-Bop haben sich im Liffey etabliert, als wäre es ihr Eigentum, was, wenn man das schwarze Notizbuch genauer studiert, in gewisser Weise auch stimmt. Die Leute kommen rein und küssen ihnen förmlich die Ringe - entweder aus Dankbarkeit, weil ihnen die Schulden gestrichen wurden, oder aus Angst, weil sie weiterzahlen müssen, aber nun an diese jungen Typen, die Eddie Friel und Jimmy Boylan umgelegt haben und wahrscheinlich auch Matty Sheehan.
Und dann noch einen.
Larry Moretti.
Das ist die einzige Sache, mit der Callan seine Schwierigkeiten hat. Eddie the Butcher war notwendig. Jimmy Boylan auch. Und Matty Sheehan sowieso. Aber Larry Moretti, das war reine Rache - weil er Eddie geholfen hat, Michael Murphy zu zerstückeln.
»Das wird von uns erwartet«, sagt O-Bop. »Es geht um den Respekt.«
Moretti weiß, was auf ihn zukommt. Er verkriecht sich in seinem Bau, in der 104th Street, Ecke Broadway, und gibt sich die Kante. Seit Wochen hat er sich nirgends blicken lassen - eben weil er ständig betrunken ist -, deshalb ist er leichte Beute, als Callan und O-Bop bei ihm zur Tür reingehen.
Moretti liegt auf dem Fußboden, die Flasche in der Hand, den Kopf zwischen zwei Lautsprechern, und hört irgendeinen miesen Disko-Scheiß mit wummernden Bässen. Eine Sekunde lang macht er die Augen auf und sieht Callan und O-Bop, die ihre Kanonen auf ihn richten, dann macht er sie wieder zu. O-Bop brüllt: »Das ist für Mikey!« - und drückt ab. Callan ist gar nicht wohl dabei, aber er macht mit, und es ist irgendwie komisch, einen Typ wegzupusten, der sowieso schon hinüber ist.
Nun müssen sie sich um die Leiche kümmern. O-Bop hat vorgesorgt und eine dicke Plastikplane mitgebracht. Sie rollen Moretti auf die Plane, und Callan kann jetzt erst ermessen, wie stark Eddie Friel gewesen sein muss, dass er eine Leiche einfach so zerhacken konnte. Es ist eine regelrechte Schinderei, ein paarmal muss Callan ins Badezimmer, sich übergeben, aber am Ende haben sie Moretti in so kleine Stücke zerlegt, dass er in Mülltüten passt, und sie bringen die Mülltüten raus nach Wards Island. O-Bop schlägt vor, Morettis Ding in einen Milchkarton zu stecken und im Viertel rumzuzeigen, aber Callan sagt nein.
So einen Scheiß haben sie nicht nötig. Die Sache spricht sich auch so rum, und eine Menge Leute kommt ins Liffey, um ihnen zu huldigen.
Einer, der nicht kommt, ist Bobby Remington. Callan weiß, dass Bobby Angst hat. Weil er glaubt, dass Callan glaubt, Bobby hätte sie bei Matty verpfiffen. Aber Callan weiß, das war nicht er, das war Beth.
»Du wolltest deinen Bruder schützen«, sagt er zu Beth, als sie in seinem neuen Apartment aufkreuzt. »Das kann ich verstehen.«
Sie senkt den Kopf und blickt zu Boden. Hat sich richtig schick gemacht. Ihr langes Haar glänzt und ist frisch gebürstet, und sie hat ein Kleid angezogen. Ein schwarzes Kleid, gerade so weit ausgeschnitten, dass der Ansatz ihrer weißen Brüste zu sehen ist.
Callan begreift. Sie will ihr Leben retten und das ihres Bruder.
»Versteht Stevie das auch?«, fragt sie. »Ich bring's ihm bei«, sagt Callan.
»Bobby fühlt sich ganz furchtbar.«
»Nein, Bobby ist in Ordnung.«
»Er braucht einen Job«, sagt sie. »Sie geben ihm keine Gewerkschaftskarte ...«
Callan muss sich erst noch dran gewöhnen, dass ihm Leute mit solchen Ansinnen kommen. Das waren Gefälligkeiten, die man sich bei Matty erbettelt hat.
»Klar, können wir regeln«, sagt Callan. Bei ihm stehen alle möglichen Funktionäre in der Kreide - Transport, Bau und so weiter. »Sag ihm, er soll vorbeikommen. Ich meine, wir sind schließlich Freunde.«
»Und was ist mit mir?«, fragt sie. »Sind wir auch Freunde?«
Er würde sie ja ganz gern vögeln. Verdammt gern sogar. Aber das wäre so, als würde er sie nur nehmen, weil er sie kriegen kann. Weil sie ihm was schuldet. Weil er die Macht hat und sie nicht.
Also sagt er. »Okay, wir sind Freunde.« Damit sie weiß, alles ist gut, sie muss nicht die Beine breitmachen für ihn.
»Freunde und weiter nichts?«
»Nein, Beth, weiter nichts.«
Irgendwie tut es ihm leid, weil sie sich so schick gemacht hat, sich angemalt hat und all das, aber er will nicht mehr mit ihr schlafen.
Irgendwie traurig, die Sache.
Jedenfalls kreuzt Bobby bei ihm auf, und sie besorgen ihm einen Job, den sein neuer Boss automatisch als Scheinjob verbucht - ohne in dieser Hinsicht von Bobby enttäuscht zu werden. Auch andere Leute kommen, um ihre Raten zu zahlen oder um einen Gefallen zu bitten, und einen Monat lang spielen Callan und O-Bop an ihrem Tisch im Liffey die Juniorpaten.
Bis sich der richtige Pate meldet.
Big Paulie Calabrese bestellt sie nach Queens, damit sie ihm persönlich erklären, warum sie a) noch am Leben sind und b) sein Freund und Geschäftspartner Matt Sheehan nicht mehr.
»Ich hab ihm erzählt, dass ihr Sheehan umgelegt habt«, sagt ihnen Peaches zur Erklärung. Er sitzt mit ihnen im Landmark Tavern und versucht, irgendeine Sauerei mit Lamm, Kartoffeln und fetter brauner Sauce runterzuwürgen. Bei Big Paulie kriegen sie wenigstens eine anständige Mahlzeit, sagt er sich.
Es könnte ihre letzte sein, aber anständig wäre sie auf jeden Fall.
»Warum hast du ihm das erzählt?«, fragt Callan.
»Er hat seine Gründe«, meint O-Bop.
»Gut«, sagt Callan. »Und welche sind das?«
»Weil«, setzt Peaches zu einer sorgfältigen Erklärung an. »Wenn ich gesagt hätte, dass ich es war, hätte er mich umlegen lassen. Ist doch klar.«
»Das ist ein triftiger Grund«, sagt Callan zu O-Bop und dann zu Peaches: »Jetzt lässt er also uns über die Klinge springen.«
»Nicht unbedingt«, sagt Peaches.
»Nicht unbedingt?«
»Nein.« Peaches erklärt es ihm. »Ihr gehört nicht zur Familie. Ihr seid keine regulären Mobster. Ihr unterliegt nicht derselben Disziplin. Versteh mal: Wenn ich Matt Sheehan umlegen wollte, brauchte ich Calabreses Erlaubnis, und die würde ich niemals kriegen. Wenn ich's also trotzdem täte, hätte ich echt ein Problem.«
»Das sind ja tolle Nachrichten«, sagt Callan. »Aber ihr braucht keine Erlaubnis«, sagt Peaches. »Ihr braucht nur einen guten Grund. Und die richtige Einstellung.«
»Was für eine Einstellung?«
»Zur Zukunft«, sagt Peaches. »Offen für Freundschaft, für Kooperation.«
O-Bop dreht beinahe durch. Sein größter Traum, zum Greifen nahe.
»Calabrese würde uns übernehmen?« Er wirft fast seinen Stuhl um.
»Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will«, sagt Callan. »Das ist deine Chance!«, ruft O-Bop. »Die Cimino-Familie, verdammt noch mal! Die wollen mit uns arbeiten!«
»Dann ist da noch was«, sagt Peaches.
»Gott sei Dank«, sagt Callan. »Das war meine Hoffnung, dass da noch was kommt.«
»Das Buch«, sagt Peaches. »Was ist damit?«
»Mein Eintrag. Die hunderttausend. Calabrese darf nichts davon erfahren. Wenn er's rauskriegt, bin ich ein toter Mann.«
»Warum?«, fragt Callan.
»Weil es sein Geld ist«, sagt Peaches. »Paulie hat ein paar Scheine bei Sheehan angelegt, und ich hab sie bei Sheehan gepumpt.«
»Dann beklaust du also Paul Calabrese«, sagt Callan.
»Wir«, korrigiert ihn Peaches. »Wir beklauen ihn.«
»Großer Gott«, sagt Callan.
Selbst O-Bops Begeisterung lässt nach. »Ich weiß nicht, Jimmy«, sagt er.
»Was soll das heißen?«, fragt Peaches. »Du weißt nicht? Ich sollte euch zwei umlegen. Das war mein Auftrag, und ich hab ihn nicht befolgt. Schon dafür können sie mich erledigen. Ich hab euch den Arsch gerettet. Und das zweimal. Erstens, weil ich euch nicht umgelegt habe, zweitens, weil ich Matty Sheehan für euch umgelegt habe. Und du weißt nicht?«
Callan starrt ihn wortlos an. Dann sagt er: »Also das Treffen. Entweder wir werden reich, oder wir sind tot.«
»Darauf läuft es hinaus«, sagt Peaches.
»Heilige Scheiße«, sagt Callan.
Reich oder tot.
Es gibt schlimmere Alternativen.
Das Treffen ist im Hinterzimmer eines Restaurants in Bensonhurst angesetzt.
»Die Mobster-Zentrale«, sagt Callan.
Und sehr bequem. Wenn Calabrese beschließt, uns zu killen, muss er nur rausgehen und die Tür hinter sich zumachen. Er geht raus auf die Straße, unsere Leichen verschwinden durch den Hintereingang.
Oder Hinterausgang, je nachdem.
Darüber denkt Callan nach, während er vorm Spiegel steht und versucht, einen Schlipsknoten hinzukriegen.
»Hast du schon mal einen Schlips getragen?«, fragt O-Bop. Seine Stimme klingt nervös.
»Klar«, sagt Callan. »Zur Erstkommunion.«
»Scheiße.« O-Bop kommt rüber und nimmt sich den Schlips vor. Dann sagt er: »Dreh dich um. Von vorne krieg ich das nicht hin.«
»Deine Hände zittern.«
»Scheiße, ja. Lass sie zittern.«
Sie gehen nackt zu diesem Treffen. Keine Hardware, nichts dergleichen. Wenn der Boss kommt, trägt keiner eine Kanone außer den Leuten vom Boss. Was es noch leichter macht, sie umzulegen.
Nicht dass sie sich ganz ohne Geleitschutz in die Höhle des Löwen begeben. Sie haben Bobby Remington und Fat Tim Healey und noch einen aus dem Viertel, Billy Bohun, gechartert, die werden im Auto vor dem Restaurant spazieren fahren.
O-Bops Anweisungen sind glasklar.
»Kommen nicht wir aus der Tür, sondern irgendwelche anderen - sofort schießen.«
Und noch eine Vorkehrung: Beth und ihre Freundin Moira werden im öffentlichen Teil des Restaurants essen gehen. Und sie haben auch eine 22er respektive 44er in ihrer Handtasche, für den Fall, dass die Dinge aus dem Ruder laufen und die Jungs eine Chance haben, aus dem Hinterzimmer rauszukommen.
Wie O-Bop sagt: »Wenn ich schon zur Hölle fahre, dann im vollbesetzten Bus.«
Sie fahren mit der U-Bahn nach Queens, weil O-Bop, wie er sagt, verhindern will, dass sie von einem wunderbaren, erfolgreichen Treffen kommen, in ihr Auto steigen, und es macht Rums.
»Italiener arbeiten nicht mit Bomben«, versucht ihn Peaches zu beruhigen. »Nur die Scheiß-Iren.«
O-Bop erinnert ihn daran, dass er Ire ist, und nimmt die U-Bahn. In Bensonhurst steigen sie aus, er läuft mit Callan in Richtung Restaurant, und als sie um die Ecke biegen, sagt O-Bop: »Oh, verdammte Scheiße.«
»Wieso verdammte Scheiße? Was ist denn?«
Vor dem Restaurant stehen vier oder fünf Mobster rum. »Na und?«, sagt Callan. »Vor den Mobster-Lokalen stehen immer vier oder fünf Mobster rum - ist doch ganz normal.«
»Das dort ist Sal Scachi«, sagt O-Bop.
Ein großer dicker Brocken, Anfang vierzig, sinatrablaue Augen und silberweißes Haar, aber für einen Mafioso viel zu kurz geschoren. Der sieht aus wie ein Mafioso, denkt Callan, aber auch wieder nicht. Und trägt diese kantigen schwarzen Schuhe, die so blankgeputzt sind, dass sie glänzen wie schwarzer Marmor.
Der sieht echt gefährlich aus, denkt Callan.
»Was ist mit dem?«, fragt er O-Bop.
»Der war Colonel bei den Green Berets«, sagt O-Bop. »Hat zentnerweise Orden aus Vietnam mitgebracht und ist jetzt bei den Mobstern. Wenn sie uns von ihrer Liste streichen, übernimmt Scachi die Subtraktion.«
Jetzt dreht sich Scachi um und sieht sie kommen. Entfernt sich von den anderen, geht ihnen entgegen und sagt mit einem Lächeln: »Gentlemen, ich begrüße Sie zum ersten oder letzten Tag Ihres Lebens. Nichts für ungut, aber ich muss sichergehen, dass Sie keine Waffen tragen.«
Callan nickt und hebt die Arme. Scachi tastet ihn routiniert ab, von oben bis unten, dann dasselbe bei O-Bop. »Sehr gut«, sagt er. »Wie wär's mit einem ordentlichen Lunch?«
Er geleitet sie ins Hinterzimmer des Restaurants. Callan kennt es schon. Aus achtundvierzig bekloppten Mafia-Filmen. Wandbilder mit ländlichen Szenen aus dem sonnigen Sizilien, ein langer Tisch mit rotkarierten Tischtüchern, Weingläser, Espressotassen, Butterportionen auf Eis.
Flaschen mit Rotwein, Flaschen mit Weißwein.
Obwohl sie auf die Minute pünktlich sind, haben sich die Mobster schon versammelt. Peaches, der seine Nervosität nicht verbergen kann, macht sie mit Johnny Boy Cozzo und Demonte und ein paar anderen bekannt. Dann geht die Tür auf, zwei Killer treten ein, massig wie Fleischerblöcke - und hinter ihnen Calabrese.
Callan wirft einen Blick auf Johnny Boy, dessen Lächeln einem Grinsen gefährlich nahekommt. Aber alle umarmen und küssen sich auf diese sizilianische Manier, dann nimmt Calabrese am Kopf der Tafel Platz, und Peaches übernimmt die Aufgabe, die beiden Gäste vorzustellen.
Callan gefällt es gar nicht, dass er dabei so verängstigt wirkt.
Als Peaches ihre Namen genannt hat und zu einer Erklärung ansetzt, hebt Calabrese die Hand und sagt: »Erst das Essen, dann das Geschäft.«
Selbst Callan muss zugeben, dass das Essen nicht von dieser Welt ist. Es ist die Mahlzeit seines Lebens. Sie beginnt mit einem großen Antipasto - Provolone, Prosciutto, süße rote Paprikaschoten und winzige rote Tomaten, wie sie Callan nie zuvor gesehen hat.
Die Kellner kommen und gehen auf Zehenspitzen - wie Nonnen, die den Papst bedienen.
Nach den Vorspeisen die Pasta. Nichts Aufregendes, nur kleine Schalen mit Spaghetti in einer roten Sauce. Dann eine Hühnerpiccata - dünne Hühnchenbrustscheiben in Weißwein, Zitrone und Kapern -, danach ein gegrillter Fisch. Dann noch ein Salat und das Dessert - ein süßer weißer Kuchen, in Anisette getränkt.
Während des Essens werden die Weingläser wie von Zauberhand nachgefüllt, und als die Kellner den Espresso servieren, ist Callan schon halb hinüber. Er sieht Calabrese nach der Tasse greifen, genüsslich schlürfen, dann hört er ihn sagen: »Jetzt erzählt mir, warum ich euch am Leben lassen soll.«
Eine verdammt knifflige Frage.
Am liebsten würde er schreien: Du sollst uns am Leben lassen, weil Jimmy Piccone dir hunderttausend Dollar geklaut hat, und wir können es beweisen! Aber er hält wohlweislich den Mund und überlegt sich eine andere Antwort.
Da hört er Peaches sagen: »Sie sind gute Jungs, Paul.«
Calabrese lächelt. »Aber du bist kein guter Junge, Jimmy. Wenn du ein guter Junge wärst, würde ich hier heute mit Matt Sheehan essen.«
Er beugt sich vor, nimmt O-Bop und Callan in Augenschein.
»Ich warte auf eure Antwort.«
Das tut auch Callan. Er überlegt, ob er die Antwort zu hören kriegt oder ob er versuchen soll, an den zwei massigen Türhütern vorbeizukommen, sich die zwei Kanonen von Beth zu holen und drauflos zu ballern.
Bis ich draußen bin und wieder zurück, denkt Callan, ist O-Bop tot. Klar, aber ich kann ihn im vollbesetzten Bus zur Hölle schicken.
Er rutscht unauffällig zur Stuhlkante vor und nimmt die Füße nach hinten, damit er einen Sprungstart hinlegen kann. Vielleicht Calabrese bei der Gurgel packen, dann rückwärts zur Tür hinaus ...
Und wohin? Gibt es einen Ort, wo sie uns nicht finden? Scheiß drauf, denkt er. Hol die Kanonen und stirb wie ein Mann.
Sal Scachi, der ihm gegenübersitzt, schüttelt den Kopf - kaum merklich, aber deutlich genug, um ihm zu sagen, dass er tot ist, wenn er sich noch einen Millimeter weiterbewegt.
Callan bleibt still sitzen.
Was sich wie Stunden anfühlt, sind in Wirklichkeit nur ein paar Sekunden in der - wie soll man sagen - angespannten Atmosphäre des Raums, und Callan ist wahrhaft überrascht, als er O-Bops dünne Stimme flöten hört: »Sie sollten uns am Leben lassen, weil...«
Weil, ähhhhhhh...
»... weil wir viel mehr für Sie tun können als Sheehan«, befreit ihn Callan aus seiner Verlegenheit. »Wir können Ihnen einen Anteil am Javits Center bieten, die Ortsverbände von Bau und Transport. Kein Schluck Beton wird bewegt, ohne dass Ihnen ein Teil davon gehört. Sie kriegen zehn Prozent von allen Zinsen, die wir eintreiben, und wir kümmern uns um alles. Sie müssen keinen Finger rühren, Sie stecken nicht mit drin.«
Calabrese bewegt alles in seinem Kopf, und Callan sieht ihm dabei zu.
Es dauert eine kleine Ewigkeit.
Was Callan allmählich auf die Nerven geht. Er hofft schon fast, dass Calabrese Tickt euch, Jungs, sagt, damit sie mit diesem diplomatischen Geplänkel aufhören und endlich zur Sache kommen können.
Aber stattdessen sagt Big Paulie Calabrese: »Es gibt da gewisse Bedingungen und Regeln. Erstens nehmen wir dreißig und nicht zehn Prozent von euren Zinseinnahmen. Zweitens nehmen wir fünfzig Prozent von allen Geschäften mit den Gewerkschaften und dreißig Prozent der Erträge aus allen anderen Aktivitäten. Dafür biete ich euch meine Freundschaft und meinen Schutz. Ich kann euch nicht in die Familie aufnehmen, weil ihr keine Sizilianer seid, aber ihr könnt unsere Partner werden. Ihr arbeitet unter Aufsicht von Jimmy Peaches. Er ist persönlich für euch verantwortlich. Wenn ihr etwas braucht, geht ihr zu Jimmy. Wenn ihr ein Problem habt, geht ihr zu Jimmy. Diese Wildwest-Geschichten müssen aufhören. Unsere Geschäfte laufen am besten in einer ruhigen Atmosphäre. Habt ihr verstanden?«
»Ja, Mr. Calabrese.«
Calabrese nickt. »Von Zeit zu Zeit werde ich auf eure Hilfe zurückgreifen. Ich werde das Jimmy wissen lassen, und Jimmy wird es euch wissen lassen. Von euch erwarte ich, dass ihr mir angesichts der Freundschaft und des Schutzes, den ich euch gewähre, nicht die kalte Schulter zeigt, wenn ich auf eure Hilfe zurückgreifen will. Wenn eure Feinde auch meine Feinde sein sollen, dann müssen meine Feinde auch eure Feinde sein.«
»Jawohl, Mr. Calabrese«, antwortet Callan und fragt sich, ob er ihm jetzt den Ring küssen muss.
»Eine letzte Sache«, sagt Calabrese. »Macht eure Geschäfte, verdient Geld, werdet reich. Macht alles, was ihr wollt - alles, außer Drogen. Das ist die Regel, die uns Carlo hinterlassen hat, und an die halten wir uns. Keine Drogengeschäfte. Viel zu gefährlich. Auf meine alten Tage möchte ich nicht im Gefängnis landen. Daher gilt die Regel ohne Einschränkung: Wer dealt, stirbt.«
Calabrese erhebt sich von seinem Stuhl. Alle stehen auf.
Callan steht da, Calabrese wedelt zum Abschied mit der Hand, die zwei Fleischberge öffnen ihm die Tür. Und Callan weiß, hier läuft was schief. »Stevie«, sagt er, »der Mann geht.« O-Bop guckt ihn verständnislos an. »Stevie, er geht raus!«
Alles erstarrt. Peaches, entsetzt über diesen Fauxpas, sagt so locker, wie er nur kann: »Das Oberhaupt geht immer zuerst.«
»Gibt es ein Problem?«, fragt Scachi.
»Ja«, sagt Callan. »Es gibt ein Problem.«
O-Bop wird leichenblass. Peaches presst die Zähne zusammen. Demonte studiert die beiden Iren, als hätte er eine Sonderausgabe der National Geographie vor sich. Johnny Boy Cozzo findet das Ganze nur lustig.
Nicht so Scachi. »Was ist hier los?«, zischt er.
Callan schluckt. »Das Problem ist, wir haben Leute draußen auf der Straße. Kommt ein anderer durch die Tür als wir, sollen sie schießen.«
Ein spannungsgeladener Moment.
Calabreses Wachmänner haben die Hände auf ihren Kanonen. So auch Scachi, nur dass sein 45er Revolver direkt auf Callans Kopf gerichtet ist.
Calabrese schaut sich Callan und O-Bop an und schüttelt den Kopf.
Jimmy Peaches versucht, sich an den exakten Wortlaut des Bußgebets zu erinnern. Dann lacht Calabrese los.
Lacht so sehr, dass er ein weißes Taschentuch aus der Jackentasche ziehen und sich die Augen trocknen muss. Damit nicht genug. Er muss sich wieder hinsetzen, lacht zu Ende und sagt zu Scachi: »Was steht ihr hier rum? Erschießt sie!«
Doch dann, genauso schnell, fügt er hinzu: »Nein, nein. War nur ein Scherz. Ihr zwei Jungs habt gedacht, wenn ich zur Tür rausgehe, bricht der Dritte Weltkrieg aus. Ahh, das ist wirklich lustig.«
Er winkt sie zur Tür.
»Diesmal noch«, sagt er.
Die Tür schließt sich hinter ihnen, doch das Gelächter geht weiter. Vorbei an Beth und ihrer Freundin Moira laufen sie aus dem Restaurant, hinaus auf die Straße.
Von Bobby Remington und Fat Tim Healey keine Spur.
Eine einzige Reihe von schwarzen Limousinen.
Und überall stehen die Mobster rum.
»O Gott«, sagt O-Bop. »Sie haben keinen Parkplatz gekriegt.«
Später erzählt ihnen ein zerknirschter Bobby, dass er die Straße auf und ab fuhr, bis einer der Mobster das Auto stoppte und ihnen nahelegte, zu verschwinden. Was sie dann auch taten.
Aber das kommt noch.
Im Moment steht O-Bop draußen auf der Straße, schaut zum blauen Himmel auf und sagt zu Callan: »Du weißt, was das bedeutet, oder?«
»Nein, Stevie. Was bedeutet das?«
»Das bedeutet«, sagt O-Bop und legt den Arm um Callans Schulter, »dass wir die Kings der West Side sind.« Die Kings der West Side. Das ist die gute Nachricht.
Die schlechte Nachricht ist, was aus den hunderttausend Dollar wurde, die Jimmy Peaches aus der Erbmasse von Matty Sheehan losgeeist hat. Die hundert Riesen sind weg, denn Jimmy Peaches hat Drogen davon gekauft.
Nicht das übliche Heroin von der Türkei-Sizilien-Connection, auch nicht das von der Marseille-Connection. Nicht mal das von der neuen Laos-Connection, die Santo Trafficante aufgebaut hat. Nein - wenn er diese Quellen anzapft, weiß es Calabrese fünfzehn Sekunden später, und etwa eine Woche später schockiert Jimmys aufgedunsene Leiche die Bootstouristen der Circle Line.
Nein, er hat eine neue Quelle aufgetan.
Mexiko.
3 California Girls
I wish they all could be California girls.
Brian Wilson, California Girls
La folia, Kalifornien
1981
Nora Hayden ist vierzehn, als sich zum ersten Mal ein Freund ihres Vaters an ihr vergreift. Er fährt sie vom Babysitten nach Hause, und plötzlich, ganz unerwartet, nimmt er ihre Hand und legt sie auf seine Wölbung. Sie will die Hand wegziehen, aber was sie fasziniert, ist sein Blick, während er ihre Hand dort festhält.
Und das Gefühl, das er bei ihr auslöst. Ein Gefühl der Macht.
Also lässt sie die Hand, wo sie ist. Fummelt nicht rum oder was immer. Das scheint auch gar nicht nötig zu sein, denn er fängt an, schwer zu atmen und kriegt so einen komischen, innigen Blick, dass sie am liebsten lachen würde, aber sie tut's nicht, um - na ja - den Zauber nicht zu brechen.
Beim nächsten Mal macht er es wieder, und diesmal hält er ihre Hand fest und bewegt sie langsam im Kreis. Sie spürt, wie er unter ihrer Hand anschwillt, spürt das Zucken. Dazu sein lächerlicher Blick.
Beim dritten Mal hält er am Straßenrand, damit sie ihm die Hose aufknöpft.
Und sie? Findet den Typ ziemlich ekelhaft.
Der Typ widert sie voll an, aber sie macht alles, was er will, denn sie spürt, dass sie in dem Moment der Boss ist und nicht er. Sie hat ihn in der Hand, sie kann ihn zügeln und gängeln, sie muss nur aufhören und dann wieder anfangen.
»Das ist kein Schwanz«, sagt sie zu ihrer Freundin Elizabeth, »das ist eine Hundeleine.«
»Nein, das ist der ganze Hund«, sagt Elizabeth. »Du streichelst ihn, du küsst ihn und machst ihm ein weiches Nest, und schon bringt er dir, was du willst.«
Nora ist vierzehn und sieht aus wie siebzehn. Ihre Mutter kriegt es mit, aber was soll sie machen? Sie wohnt teils bei ihrer Mom und teils bei ihrem Dad, und selten hatte die Bezeichnung Joint Custody - geteiltes Sorgerecht - eine so pikante Doppelbedeutung wie in ihrem Fall. Denn jedes Mal, wenn sie bei ihrem Dad aufkreuzt, gibt es erst mal einen Joint.
Dad ist so was wie ein weißer Rasta, aber ohne Dreadlocks und ohne den religiösen Kram. Dad würde Äthiopien nicht mal auf einer Äthiopien-Karte finden, aber er schwört auf das Kraut. Was das betrifft, ist er voll dabei.
Mom ist über all das hinweg, das war auch der Grund für die Scheidung. Aus ihrer Hippie-Phase ist sie rasant rausgewachsen, vom Hippie zum Yuppie, quasi über Nacht, von Null auf Hundert. Und sie kommt voran im Leben. Während er noch immer in Birkenstock-Sandalen rumläuft, als wären sie ihm an die Füße genagelt.
Mom hat einen echt guten Job in Atlanta und will Nora zu sich holen, aber Nora hat keine Lust. Sag mir, wo in Atlanta der Strand ist, sagt sie, sonst komm ich nicht mit. Irgendwann landet das beim Richter, der Nora fragt, bei welchem Elternteil sie wohnen möchte, und am liebsten hätte sie gesagt »bei keinem«, aber dann sagt sie doch »bei meinem Dad«, was bedeutet, dass sie, wenn sie fünfzehn ist, die großen Ferien in Atlanta verbringen muss.
Was auszuhalten sein müsste, wenn sie genug Gras dabei hat.
Die Kids in der Schule nennen sie »Nora die Nutte«, doch das ist ihr egal - und den Kids eigentlich auch. Das mit der Nutte ist weniger ein Schimpfwort als eine Feststellung. Was soll man auch sonst über ein Mädchen sagen, das im Porsche oder im Mercedes oder irgendwelchen Limousinen von der Schule abgeholt wird, und keine davon gehört den Eltern?
An einem Nachmittag ist Nora bekifft, sie füllen einen blöden Fragebogen für den Schulpsychologen aus, und unter »Freizeitbeschäftigung« trägt sie »Blowjobs« ein. Bevor sie es wegradiert, zeigt sie es Elizabeth, und beide lachen.
Und wehe, die Limousine steuert irgendeine Fastfood-Bude an. Nora hat das Aussehen und die Figur, um in besseren Lokalen Eindruck zu machen - im Las Brisas, im Inn von Laguna, im El Adobe.
Willst du Nora, dann musst du ihr ein gutes Lokal, guten Wein, guten Stoff bieten.
Jerry the Doof hat immer gutes Kokain dabei.
Er will, dass sie mit ihm nach Cabo fährt.
Und wie er das will! Er ist vierundvierzig, dealt mit Kokain und hat schon bessere Tage gesehen, sie ist sechzehn und hat einen Body zum Anbeißen. Wer würde da nicht träumen von einem versauten Wochenende in Mexiko?
Nora hat nichts dagegen.
Sie weiß, dass der Typ nicht unbedingt verliebt in sie ist. Und sie nicht in ihn, das nun gar nicht. Eher denkt sie, dass das mit dem Spitznamen stimmt, dass er tatsächlich ein Blödmann ist mit seinem schwarzen Seidenjackett, der schwarzen Basecap über dem spärlichen Haar, den Nikes ohne Socken. Aber Nora versteht ihn - der Typ hat einen Wahnsinns-Horror vorm Altwerden.
Mach dir keine Sorgen, denkt sie. Du bist schon alt.
Jerry the Doof hat nur zwei Dinge, die für ihn sprechen. Und die sind nicht schlecht. Geld und Coke.
Eigentlich dasselbe, wie Nora weiß. Hast du Geld, dann hast du Coke. Und hast du Coke, dann hast du Geld. Sie bläst ihm einen.
Das dauert etwas länger wegen dem Coke, aber egal, sie hat nichts Dringendes zu tun. Und ihm einen runterkauen ist besser als mit ihm reden oder, schlimmer noch, ihn reden lassen. Sie kann das nicht mehr hören, wie er beim Softball einmal das spielentscheidende Triple hingelegt hat - und dann das Gesülze von seiner Exfrau und den Kindern. Scheiße, sie kennt seine Kinder besser als er selbst, weil sie in ihre Schule gehen.
Als sie mit ihm fertig ist, fragt er: »Und, kommst du mit?«
»Wohin?«
»Cabo.«
»Okay.«
»Wann denkst du?«
»Ist mir egal.« Sie zuckt die Schulter.
Sie ist schon halb aus dem Auto, da reicht ihr Jerry ein Plastiktütchen voll vom feinsten Kraut.
»Hey«, sagt ihr Dad, als sie nach Hause kommt. Er liegt auf dem Sofa und guckt eine Wiederholung von Eight is Enough. »Wie war dein Tag?«
»Gut.« sie wirft das Tütchen auf den Couchtisch. »Schönen Gruß von Jerry.«
»Für mich? Cool.«
So cool, dass er tatsächlich aufsteht. Mit einem Mal wird er richtig agil. Dreht sich einen schönen strammen Joint.
Nora geht in ihr Zimmer und macht die Tür zu.
Und fragt sich, was sie von einem Vater halten soll, der seine Tochter für einen Joint auf den Strich schickt.
In Cabo hat sie eine Begegnung, die ihr Leben verändert. Sie trifft Haley.
Nora liegt neben Jerry the Doof am Pool, und drüben auf der anderen Seite liegt eine im Liegestuhl, die eindeutig zu ihr rüberguckt.
Eine vom Typ supercoole Lady.
Ende zwanzig, dunkelbraunes kurzes Haar, schwarzes Sonnenvisier, schlanker, durchtrainierter Körper, den der superknappe Bikini eher zur Schau stellt als verhüllt. Netter Goldschmuck - sparsam, aber teuer. Als Nora den nächsten Blick riskiert, guckt die Frau schon wieder rüber.
Mit diesem wissenden Lächeln, das beinahe schon anzüglich ist.
Und sie ist immer da.
Blickt Nora von ihrem Liegestuhl auf, ist sie da, läuft Nora am Strand entlang, ist sie auch da.
Geht sie im Hotel zum Dinner, sitzt die Frau schon am Tisch. Nora weicht dem Blick aus, sie ist immer die Erste, die wegschaut. Irgendwann hat sie es satt. Sie wartet, bis Jerry in einen seiner postkoitalen Dämmerzustände versinkt, geht an den Pool und setzt sich in den Nachbarliegestuhl.
»Sie beobachten mich«, sagt sie zu der Frau.
»Stimmt.«
»Ich bin nicht interessiert.«
Die Frau lacht. »Sie wissen ja nicht mal, woran Sie nicht interessiert sind.«
»Ich bin nicht lesbisch«, sagt Nora. »Ich auch nicht«, sagt die Frau. »Sondern?«
»Lassen Sie mich so fragen«, sagt die Frau. »Verdienen Sie Geld?«
»Häh?«
»So als Coke-Bunny«, sagt die Frau. »Verdienen Sie damit Geld?«
»Nein.«
Die Frau schüttelt den Kopf. »Kindchen, mit deinem Gesicht und deinem Body könntest du Unmengen verdienen.« Das hört Nora gern. »Und wie?«, fragt sie.
Die Frau greift in ihre Tasche und reicht Nora eine Visitenkarte.
Haley Saxon - und eine Telefonnummer in San Diego. »Handeln Sie mit irgendwas?«
»In gewisser Weise schon.«
»Häh?«
»Häh?«, äfft Haley sie nach. »Da siehst du, was ich meine. Wenn du Geld verdienen willst, musst du aufhören, >Häh< zu machen.«
»Vielleicht will ich das gar nicht.«
»Na dann, schönes Wochenende«, sagt Haley. Sie greift nach ihrer Illustrierten und liest weiter. Aber Nora geht nicht weg, bleibt einfach sitzen und kommt sich blöd vor. Und sie braucht fast fünf Minuten, bis sie ihren Mut zusammenrafft. »Okay«, sagt sie, »könnte sein, dass ich Geld verdienen will.«
»Okay.«
»Also was verkaufen Sie?«
»Dich. Ich verkaufe dich.«
Nora will schon wieder Häh? machen, doch sie kriegt die Kurve und fragt: »Wie meinen Sie das?«
Haley legt lächelnd ihre elegante Hand auf Noras Unterarm. »Das ist so einfach, wie es klingt. Ich verkaufe Frauen an Männer. Für Geld.«
Nora ist nicht schwer von Begriff. »Dann hat es was mit Sex zu tun?«
»Kindchen«, sagt Haley. »Alles hat mit Sex zu tun.«
Haley hält ihr einen ganzen Vortrag, aber im Kern besagt der nur: Die ganze Welt will immer nur das Eine.
Dann kommt sie zum Punkt: »Wenn du dich verschenkst oder unter Wert verkaufst, ist das deine Sache. Wenn du dich für richtig gutes Geld verkaufen willst, überlass mir das Geschäftliche. Wie alt bist du überhaupt?«
»Sechzehn«, sagt Nora.
»Großer Gott!« Haley schüttelt den Kopf.
»Was denn?«
Haley seufzt. »Dieses Potential!«
Erst die Stimme.
»Wenn du dich mit Blowjobs auf dem Rücksitz begnügen willst, kannst du weiter so sprechen wie ein Beachgirl«, erklärt ihr Haley ein paar Wochen später. »Aber wenn du vorankommen willst im Leben ...«
Sie schickt Nora zu einem verkrachten Schauspieler der Royal Shakespeare Company, der ihre Stimme um etwa eine Oktave senkt. (»Das ist wichtig«, sagt Haley. »Eine tiefe Stimme weckt den Johannes und macht ihn neugierig.«) Der trinkfreudige Sprachmentor rundet ihre Vokale, kräftigt ihre Konsonanten, paukt mit ihr Monologe: Portia, Rosalind, Viola, Paulina ...
»Welch Martern sinnst du jetzt, Tyrann, mir aus? Welch Rädern? Foltern? Brennen? Schinden? Sieden In Öl, in Blei?«
Sie bekommt eine kultivierte Stimme. Tiefer, voller, sanfter. Das alles gehört zur Verpackung. Wie auch die Sachen, die sie zusammen mit Haley kauft. Die Bücher, die Haley ihr zu lesen gibt. Die tägliche Zeitungslektüre. »Und nicht die Modeseiten, Kindchen, oder den Kulturteil«, sagt Haley. »Eine Kurtisane liest zuerst den Sportteil, dann den Finanzteil, dann vielleicht die erste Seite.«
Also kreuzt sie in der Schule mit der Zeitung auf. Ihre Freunde sind noch auf dem Parkplatz und ziehen sich hastig einen Joint rein, bevor die Schulglocke läutet, doch Nora sitzt schon da, studiert die Sportseiten, den Dow Jones, den Leitartikel. Sie liest The National Review, The Wall Street Journal, sogar den bekloppten Christian Science Monitor.
Und das ist auch schon alles, was sie auf dem Rücksitz macht.
Nora die Nutte fährt nach Cabo und kommt zurück als Nora, die Eisprinzessin.
»Sie ist wieder Jungfrau geworden« - so erklärt es Elizabeth ihren verwunderten Freundinnen. Nicht, um schlecht über sie zu reden, es scheint einfach die Wahrheit zu sein. »Sie hat sich in Cabo das Jungfernhäutchen wieder einsetzen lassen.«
»Ich wusste gar nicht, dass das geht«, sagt Raven.
Elizabeth seufzt nur.
Raven erkundigt sich nach der Adresse des Arztes.
Nora wird zur Fitness-Bombe, verbringt Stunden auf dem Spin-Bike, noch mehr Stunden auf dem Laufband. Haley heuert für sie eine Trainerin an, einen absolut fanatischen Gesundheitsfreak. Sie nennt sich Sherry, doch für Nora ist sie die »Folterterroristin«. Dieses Naziweib hat einen Body wie ein Windhund und trimmt Nora zu genau dem Kraftpaket, das Haley vermarkten will - mit Liegestützen, Sit-ups, Gewichten.
Das Spannende: Nora fängt an, Gefallen daran zu finden.
Am harten körperlichen und geistigen Schliff, an allem, was dazugehört. Nora fährt da voll drauf ab, wie man so schön sagt. Eines Morgens steht sie auf und wäscht sich das Gesicht (mit dem Spezialreiniger, den ihr Haley gekauft hat), sieht sich im Spiegel und sagt sich: Wow! Wer ist diese Frau? Sie fährt zur Schule, hört sich über aktuelle Politik konferieren und fragt sich: Wow! Wer ist diese Frau?
Wer immer die Frau ist, Nora gefällt sie.
Ihr Dad merkt nichts von der Verwandlung. Wie denn auch?, denkt Nora. Ich komme schließlich nicht im Plastiktütchen.
Haley macht mir ihr einen Ausflug zum Sunset Strip in L. A., um ihr die Crack-Huren zu zeigen. Crack hat das Land überfallen wie ein Virus, und die Huren sind davon infiziert. Und treiben es wie toll. Rücklings auf Autositzen, auf allen vieren in Höfen und Durchgängen. Manche sind alt, manche sind jung - aber Nora ist davon geschockt, dass sie alle alt aussehen. Und krank.
»So was wie diese Frauen würde ich nie machen«, sagt Nora.
»Doch, würdest du«, widerspricht ihr Haley. »Wenn du nicht clean bleibst. Lass die Finger vom Dope, lass dir den Kopf nicht zudröhnen. Und vor allem: Leg dein Geld gut an. Du hast zehn oder zwölf Jahre, in denen du blendend verdienst, wenn du auf dich aufpasst. Danach geht es bergab. Also kauf dir Aktien, Wertpapiere, Immobilien. Ich mach dir einen Termin bei meinem Finanzberater.«
Denn dieses Mädchen wird einen brauchen, denkt Haley.
Nora ist eine echte Granate.
Als sie achtzehn wird, ist sie reif fürs Weiße Haus.
Weiße Wände, weiße Läufer, weiße Möbel. Die Hölle für diejenigen, die hier putzen müssen, aber trotzdem Gold wert, denn die Männer, die hier reinkommen, werden brav wie die Mäuschen (alle hatten sie als Kinder irrsinnige Angst, Mamas weißen Dingsda zu bekleckern). Und wenn Haley im Dienst ist, trägt sie auch immer Weiß: Das Haus und ich, wir sind eine Einheit. Ich bin unantastbar, genau wie das Haus.
Ihre Mädchen tragen immer Schwarz.
Nichts an ihnen, was nicht schwarz wäre.
Haley möchte, dass sich ihre Mädchen von der Umgebung abheben.
Und sie sind immer vollständig bekleidet. Nie in Reizwäsche oder im Bademantel - schließlich führt Haley keinen billigen Reitstall. Sie lässt ihre Mädchen im Rollkragenpulli aufmarschieren, im Business-Kostüm, im schlichten schwarzen Kleid, im Kimono. Sie kleidet ihre Mädchen in Sachen, die ihnen die Männer gern ausziehen. Aber dafür müssen die was tun.
Sie müssen übers Stöckchen springen, selbst im Weißen Haus.
An den Wänden hängen Schwarzweißfotos von Göttinnen: Aphrodite, Nike, Venus, Hedy Lamarr, Sally Rand, Marilyn Monroe. Nora findet die Bilder interessant, besonders das von Marilyn, weil sie sich so ähnlich sehen.
Da hat sie recht, sie ähneln sich wirklich, denkt Haley.
Und verkauft Nora als junge Monroe ohne Pölsterchen.
Nora ist nervös. Auf dem Monitor sieht sie die Klienten im Salon. Einer von ihnen wird ihr erster richtiger Kunde. Seit anderthalb Jahre hatte sie keinen Sex mehr, und sie weiß nicht, ob sie es überhaupt noch kann, geschweige denn so, dass die Sache die fünfhundert Mäuse wert ist. Sie hofft ja, dass sie den einen da abfasst, den Großen, Dunklen, Schüchternen, und es sieht ganz so aus, als würde Haley die Dinge in diese Richtung steuern.
»Nervös?«, wird sie von Joyce gefragt. Joyce ist ihr glattes Gegenteil, ein flachbrüstig-knabenhaftes Wesen im Pariser Existentialistenlook - als Hure Gigi genannt -, sie hilft ihr beim Make-up und mit dem Outfit, einer schwarzen Bluse mit schwarzem Rock.
»Das ging uns allen so beim ersten Mal«, sagt Joyce. »Dann wird's Routine.«
Nora starrt weiter auf die vier Männer, die steif und unbeholfen auf dem großen Sofa sitzen. Sie sehen jung aus, Mitte zwanzig, aber nicht wie reiche, versaute College-Boys, und sie fragt sich, woher sie das Geld haben. Oder warum sie überhaupt hierherkommen.
Callan geht es genauso.
Was zum Teufel machen wir hier?, fragt er sich.
Big Paulie Calabrese würde voll durchdrehen, wenn er wüsste, dass Jimmy Peaches dabei ist, die Pipeline anzuschließen, die kolumbianisches Kokain über Mexiko bis zur West Side von Manhattan pumpen soll.
»Jetzt werdet endlich locker«, sagt Peaches. »Ich setze euch an den gedeckten Tisch, also langt gefälligst zu!«
»Wer dealt, der stirbt«, erinnert ihn Callan. »So hat es Calabrese gesagt.«
»Klar doch. Wer dealt, der stirbt«, sagt Peaches. »Aber wenn wir nicht dealen, verhungern wir. Lässt uns dieser Scheißtyp an die Gewerkschaften ran? Nein. An die Gewinne? Nein. Also scheiß auf den Typ. Soll er uns doch erst mal ans Eingemachte ranlassen, bevor er uns das Dealen verbietet. Und solange das nicht passiert, deale ich.«
Der Hotelpage ist noch gar nicht richtig draußen, da sagt Peaches schon, er will zu diesem Hurenhaus, von dem er gehört hat.
Callan hat keine Lust.
»Wir fliegen dreitausend Meilen weit, um ins Puff zu gehen?«, sagt er. »Das können wir auch zu Hause haben.«
»Aber nicht so wie hier«, sagt Peaches. »Die sollen hier die besten Girls der Welt haben.«
»Sex ist Sex«, sagt Callan.
»Was weißt du denn schon als Ire«, sagt Peaches.
Nicht dass Callan abgeneigt wäre, aber das hier ist eine Geschäftsreise, und wenn es ums Geschäft geht, dann denkt Callan ans Geschäft und nichts sonst. Es ist schon schwer genug, die Piccone-Brüder bei der Stange zu halten, weil sie ständig hinter den Weibern her sind.
Also sagt er: »Ich dachte, das ist eine Geschäftsreise.«
»Mein Gott, wach endlich auf!«, sagt Peaches. »Auf deinem Grabstein wird mal stehen: Hier liegt einer, der nie Spaß hatte. Wir machen Geschäfte, und wir gehen ins Puff. Sogar essen können wir gehen, wenn du die Minute Zeit dafür erübrigen kannst. Ich höre, die haben hier sehr guten Fisch.«
Wirklich sehr clever von Peaches, denkt Callan. Wenn der am Fenster steht und den Ozean sieht, denkt er sofort, da muss es doch irgendwo einen guten Fisch geben.
»Du bist ein richtiger Trauerkloß, weißt du das?«
Klar bin ich ein Trauerkloß, sagt sich Callan. Ich habe - wie viel? - fünf Leute für die Ciminos aus dem Weg geräumt, und Peaches erzählt mir, ich bin ein Trauerkloß.
»Wer hat dir die Nummer von dem Puff gegeben?« fragt Callan. Ihm gefällt die Sache nicht. Peaches wählt die Nummer, da sagt ihm einer: Klar, kommt rüber, sie fahren zu irgendeiner Adresse - und werden von einem Kugelhagel empfangen.
»Die Nummer hab ich von Sal Scachi«, sagt Peaches. »Zufrieden? Du kennst doch Sal.«
»Ich weiß nicht«, sagt Callan. Wenn Calabrese sie wegen der Dealerei umlegen will, dann ist Scachi der ideale Mann, das zu übernehmen.
»Jetzt hör aber auf!«, sagt Peaches. »Du machst mich langsam nervös.«
»Na, hoffentlich.«
»Na, hoffentlich? Du willst, dass ich nervös werde?«
»Ich will, dass du am Leben bleibst.«
»Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Callan, wirklich.« Er packt Callan beim Hinterkopf und gibt ihm einen Schmatz auf die Wange. »So, jetzt kannst du deinem Beichtvater erzählen, dass du mit einem Spaghetti rumgeschwuchtelt hast. Ich liebe dich, du irischer Bastard. Und ich sage dir, heute Abend haben wir Spaß und sonst nichts.«
Trotzdem steckt Callan seine schallgedämpfte 22er ein. Sie fahren vor dem Weißen Haus vor, und eine Minute später stehen sie im Foyer und staunen.
Callan hat sich vorgenommen, nur ein Bier zu trinken, sich auf nichts einzulassen und den Laden im Auge zu behalten. Wer Peaches ins Jenseits befördern will, wird warten, bis er sein Pferdchen besteigt, und ihm dann von hinten die Kugel geben. Daher will Callan zusammen mit O-Bop eine Art Wachdienst aufziehen. Doch O-Bop denkt gar nicht daran, er will auch seinen Spaß haben, Callan muss also allein für die nötige Sicherheit sorgen. Und er schlürft gerade sein Bier, als Haley ein paar schwarze Ringmappen auf dem gläsernen Couchtisch ausbreitet.
»Heute Abend haben wir eine ganze Reihe Damen zur Auswahl«, sagt sie und klappt die erste Mappe auf. In jeder Folientasche steckt das große Schwarzweiß-Porträt eines Mädchens und auf der Rückseite mehrere Ganzaufnahmen in verschiedenen Posen. Haley denkt nicht daran, ihre Mädchen aufmarschieren zu lassen wie bei einer Viehauktion. Nein, diese Mappen beweisen Stil und Würde und dienen dazu, die Phantasie der Freier anzuregen.
»Da ich die Damen gut kenne«, sagt sie, »bin ich Ihnen bei der Auswahl gern behilflich.«
Nachdem die anderen ihre Wahl getroffen haben, setzt sie sich neben Callan, bemerkt auch schon, dass er sich in Noras Foto verguckt hat und flüstert ihm ins Ohr: »Schon ihr Blick macht dich geil.« Callan wird rot bis in die Haarwurzeln.
»Möchtest du sie kennenlernen?« fragt sie.
Ein Nicken bringt er gerade noch zustande.
Er will sie also kennenlernen.
Und ist auf der Stelle verliebt.
Nora tritt ein und richtet den schon erwähnten Blick auf ihn. Er spürt, wie es ihn durchfährt, von oben bis unten und wieder zurück, und ist rettungslos hinüber. Etwas so Schönes ist ihm noch nie begegnet. Etwas so Schönes ganz allein für sich zu besitzen, und sei es nur für kurze Zeit, hat er nicht für möglich gehalten. Und jetzt ist es Wirklichkeit geworden.
Er muss heftig schlucken.
Sie für ihren Teil ist froh, dass sie ihn erwischt hat. Er sieht nicht schlecht aus, auch nicht ordinär. Lächelnd streckt sie ihm die Hand entgegen. »Ich bin Nora.«
»Callan.«
»Hast du auch einen Vornamen, Callan?«, fragt sie.
»Sean.«
»Hallo, Sean.«
Haley strahlt die beiden an wie eine erfolgreiche Kupplerin. Sie wollte den Schüchternen für Noras ersten Einsatz, daher hat sie die anderen Freier diskret von ihrem Foto abgelenkt. Jetzt sind alle so gepaart, wie sie es wollte, stehen da und plaudern und werden sich gleich in ihre jeweiligen Zimmer zurückziehen. Sie schlüpft hinaus, um Adán anzurufen, ihm mitzuteilen, dass seine Klienten sich bestens amüsieren.
»Die Rechnung geht auf mich«, versichert ihr Adán.
Eine Kleinigkeit. Ein Trinkgeld verglichen mit dem, was ihm eine Geschäftsverbindung mit den Piccone-Brüdern einbringen könnte. In Kalifornien verkauft Adán eine Menge Kokain. Er hat reichlich Abnehmer in San Diego und L. A. Aber New York ist ein gigantischer Markt. Wenn er das Netzwerk der Cimino-Familie nutzen kann, um seine Ware auf die Straßen von New York zu bringen ... also, Jimmy Peaches kann alle Huren haben, die er will, auf Kosten des Hauses.
Adán selbst kommt nicht mehr ins Weiße Haus. Nicht als Freier jedenfalls. Es ist unter der Würde eines seriösen Geschäftsmanns, mit Callgirls ins Bett zu gehen.
Außerdem ist er in festen Händen.
Lucia Vivanca, aus guter mexikanischer Familie stammend, ist in den USA geboren. Sie hat die »Doppelwette« gewonnen, wie Raúl das nennt - das heißt, sie hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Erst vor kurzem hat sie die katholische Schule abgeschlossen, jetzt wohnt sie bei ihrer großen Schwester und studiert an der Universität von San Diego.
Und sie ist eine Schönheit.
Zierlich, naturblond mit ausdrucksvollen dunklen Augen und einer so tollen Figur, dass Raúl es nicht lassen kann, bei jeder Gelegenheit anzügliche Bemerkungen zu machen.
»Diese chupas unter ihrer Bluse, die sind ja so spitz, dass man sich dran stechen kann«, sagt er. »Schade, dass sie so eine chifloría ist.«
Nein, sie ist keine Zicke, denkt Adán, sie ist eine Lady. Kultiviert, gebildet, von Nonnen erzogen. Trotzdem muss er zugeben, dass er ziemlich frustriert ist nach all den fruchtlosen Kabbeleien im Auto oder auf dem Sofa ihrer Schwester, wenn diese mal für ein paar Minuten aus dem Zimmer gegangen war.
Lucia will einfach nicht. Nicht bevor sie verheiratet sind.
Und zum Heiraten hab ich noch nicht das Geld, sagt sich Adán. Nicht, wenn es sich um eine Lady wie Lucia handelt.
»Du tust ihr einen Gefallen, wenn du zu den Huren gehst, statt sie ständig zu bedrängen«, sagt Raúl. »Du bist es ihr sogar schuldig, ins Weiße Haus zu gehen. Deine Moral ist doch nichts weiter als eine egoistische Marotte.«
Raúl hingegen ist alles andere als egoistisch, was diese Dinge betrifft, denkt Adán. Da kennt seine Großherzigkeit keine Grenzen. Mein Bruder, sagt sich Adán, lässt im Weißen Haus die Puppen tanzen.
»Das ist eben meine spendable Natur«, sagt Raúl. »Was soll ich machen? Ich bin ein geselliger Mensch.«
»Aber heute Abend knöpfst du deine Spendierhosen nicht auf«, sagt Adán jetzt zu ihm. »Heute Abend geht es ums Geschäft.«
Und er hofft, dass alles gut läuft im Weißen Haus.
Callan möchte Nora einen Drink spendieren.
»Wie wär's mit einem Grapefruitsaft?«, fragt sie.
»Das ist alles?«
»Ich trinke nicht«, sagt Nora.
Er weiß nicht, was er sagen oder tun soll, also steht er einfach da und starrt sie an.
Sie starrt zurück und ist überrascht. Nicht so sehr von dem, was sie empfindet, wie von dem, was sie nicht empfindet.
Nämlich Verachtung.
Sie schafft es einfach nicht, irgendwelche Verachtung in sich aufkommen zu lassen.
»Sean?«
»Ja?«
»Ich hab hier ein Zimmer. Möchtest du mitkommen?«
Er ist ihr dankbar, dass sie kurzen Prozess macht, ihm erspart, wie ein Trottel in der Gegend zu stehen.
Und ob ich möchte, sagt er sich. Ich möchte dich ausziehen, dich überall berühren, in dir drin sein, und dann will ich dich mit nach Hause nehmen. Nach Hell's Kitchen, dich verwöhnen wie die Queen der West Side. Du sollst das Erste sein, was ich morgens beim Aufwachen sehe, und das Letzte, bevor ich einschlafe.
»Klar möchte ich!«
Sie nimmt ihn lächelnd bei der Hand und will mit ihm die Treppe hoch, als sich Peaches hinter ihnen bemerkbar macht. »Hey, Callan!«
Callan dreht sich um und sieht ihn in der Ecke stehen, neben einer kleinen Frau mit kurzen schwarzen Haaren. »Ja?«
»Ich tausche mit dir.«
»Was?«, fragt Callan verdutzt.
Nora will vermitteln: »Ich glaube, er möchte lieber -«
»Glaub, was du willst«, fertigt Peaches sie ab. »Also, was ist?«, sagt er zu Callan.
Peaches ist sauer. Er ist zu spät auf Nora aufmerksam geworden, und so einen Leckerbissen wird er sich nicht entgehen lassen.
»Nein«, sagt Callan.
»Komm schon, sei kein Frosch!«
Alles im Salon erstarrt.
O-Bop und Little Peaches lassen ihre Mädchen stehen und peilen die Lage.
Und die ist angespannt, wie O-Bop nun feststellt.
Denn obwohl Jimmy Peaches nicht der Durchgeknalltere der Piccone-Brüder ist - diese Ehre gebührt Little Peaches -, neigt er sehr zum Jähzorn. Plötzlich, aus heiterem Himmel, tut er Dinge - oder schlimmer noch, verlangt er sie von einem.
Und Jimmy ist im Moment sowieso irritiert, was Callan betrifft, denn Callan ist - wie soll man sagen - so still, so unberechenbar geworden, seit sie in Kalifornien sind. Das macht Jimmy nervös, weil er Callan braucht. Jetzt will Callan auch noch mit der Frau vögeln, die Peaches vögeln will, und das ist einfach nicht fair, weil Peaches hier der Boss ist.
Dann ist da noch was, was diesen Konflikt so gefährlich macht, und alle wissen es, obwohl niemand in der Piccone-Crew es laut sagen würde: Peaches hat Angst vor Callan.
Alle wissen, dass Peaches ein guter Mann ist - hart, raffiniert, kaltblütig.
Aber Callan ist besser.
Ein eiskalter Killer, wie es keinen zweiten gibt.
Jimmy braucht ihn und hat Angst vor ihm, und das ist eine gefährliche Kombination. Wie Nitroglyzerin auf einer Holperstraße, denkt O-Bop. Ihm gefällt das hier überhaupt nicht. Er hat sich den Arsch aufgerissen, um mit den Ciminos ins Geschäft zu kommen, sie fahren alle gut dabei, und jetzt soll das wegen so einer Lappalie in die Brüche gehen?
»Jungs, was soll der Scheiß«, sagt O-Bop.
»Das ist kein Scheiß, die Sache ist ja wohl klar«, sagt Peaches.
»Ich sagte nein«, sagt Callan.
Peaches weiß, dass Callan seine 22er ziehen und ihn wegpusten kann, bevor er auch nur Piep sagt. Aber er weiß auch, dass Callan nicht den ganzen Cimino-Clan wegpusten kann, was die Folge wäre, wenn er Peaches wegpustet.
Das ist es, was Peaches den Rücken stärkt.
Und was Callan gewaltig anstinkt.
Er hat es satt, für die Spaghettis den Pitbull zu spielen.
Zur Hölle mit Jimmy Peaches.
Zur Hölle mit Johnny Boy, Sal Scachi und Paulie Calabrese. Ohne den Blick von Peaches abzuwenden, sagt er zu O-Bop: »Gibst du mir Deckung?«
»Ich gebe dir Deckung.«
Da ist sie nun, die Zwickmühle.
Es sieht nicht so aus, als würde die Sache gut ausgehen, weder für ihn noch für irgendwen anders, bis Nora auf einmal sagt: »Lasst doch mich entscheiden.«
Peaches strahlt. »Das ist okay. Ist das okay, Callan?«
»Ist okay.«
Doch er denkt das Gegenteil. Es ist überhaupt nicht okay, dass er schon total in sie verknallt ist, und jetzt soll er sie wieder hergeben.
»Na los«, sagt Peaches. »Entscheide dich.«
Callan spürt sein Herz klopfen, so sehr, dass er meint, alle können es hören.
Sie blickt zu ihm auf und sagt: »Joyce wird dir gefallen. Sie ist sehr schön.«
Callan nickt.
»Tut mir leid«, flüstert sie.
Und es ist ehrlich gemeint. Sie wollte Callan wirklich. Aber Haley, die gerade dazugekommen ist, versucht, die Lage zu entspannen. Sie hat ihr einen Blick zugeworfen, und Nora ist klug genug, diesen Blick zu verstehen. Sie soll sich für den Grobian entscheiden.
Haley ist erleichtert. Dieser Abend muss ein gelungener Abend werden. Unbedingt. Adán hat ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass es heute nicht um ihr Geschäft geht, sondern um seins. Und da Tío Barrera sie mit dem nötigen Kapital ausgestattet hat, um dieses Haus zu eröffnen, muss sie die Geschäfte der Familie Barrera nach besten Kräften befördern.
»Sei nicht traurig«, sagt Callan zu Nora.
Mit Joyce will er nicht. »Nichts für ungut, aber vielen Dank«, sagt er und geht raus zum Auto. Zieht seine 22er und versteckt sie hinterm Rücken, als ein paar Minuten später ein Auto hält, aus dem Sal Scachi steigt.
Zwar ist er kalifornisch-leger gekleidet, aber er trägt immer noch diese hochglanzpolierten Armeeschuhe. Die Spaghettis und ihre Schuhe, denkt Callan. Er befiehlt Scachi, stehenzubleiben und die Hände auszustrecken, damit er sie kontrollieren kann.
»Hey, da ist ja der Scharfschütze«, sagt Scachi. »Keine Sorge, Billy Peaches hat nichts von mir zu befürchten. Was Paulie nicht weiß ...«
Er gibt Callan einen kleinen Kinnstüber und geht ins Haus. Das tut er mit Freude, denn die letzten paar Monate hat er einen grünen Kampfanzug getragen und an einer CIA-Operation namens Kerberos teilgenommen. Scachi und noch ein paar andere Kriegsveteranen, die drei Sendemasten im kolumbianischen Urwald aufrichten und dann bewachen mussten, um sicherzugehen, dass sie von den kommunistischen Guerillas nicht in die Luft gesprengt wurden.
Jetzt muss er sicherstellen, dass die Connection mit Adán Barrera zustande kommt. Was ihn auf eine Idee bringt...
Er dreht sich zu Callan um und ruft ihm zu: Hey, es kommen noch ein paar Mexikaner. Tu mir den Gefallen und lass sie am Leben.«
Lachend verschwindet er im Weißen Haus.
Callan schaut wieder hoch zu dem erleuchteten Fenster.
Peaches nimmt sie hart ran.
Nora versucht ihn zu bremsen, ihm das zärtliche, langsame Tempo zu zeigen, das Haley ihr beigebracht hat, aber der Mann springt nicht drauf an. Der Sieg im Salon hat ihn scharfgemacht, er wirft sie bäuchlings aufs Bett, reißt ihr Rock und Slip runter und dringt in sie ein.
»Na, fühlst du was?«
Sie fühlt was.
Es tut weh.
Er hat ein Riesenteil, sie ist nicht annähernd feucht genug, und er rammelt drauflos, dass sie gar nicht anders kann, als es zu fühlen. Als er nach ihrem BH tastet, ihn runterreißt und ihre Brüste quetscht, versucht sie mit ihm zu reden, aber dann kommen Wut und Verachtung in ihr hoch. Tob dich nur aus, du Arschloch, sagt sie sich, lässt ihren Schmerzensschreien freien Lauf, die er für Lustschreie hält, also rammelt er sie noch härter, und sie verfällt auf die Idee, ihm die Eier zu kneten, damit er schneller kommt, aber das durchschaut er sofort.
»Komm mir nicht mit deinen verdammten Hurentricks«, sagt er, dreht sie auf den Rücken und nimmt sie zwischen die Schenkel. Presst ihre Brüste zusammen, schiebt seinen Schwanz dazwischen und hinauf zu ihrem Mund.
»Lutschen!«
Sie gehorcht.
Sie macht es so gut, wie es nur geht, während er seinen Kolben wieder und wieder in sie hineinstößt, denn sie will, dass es vorbeigeht. Der Kerl spielt hier seinen eigenen Pornofilm und wird jetzt fertig, er schnappt seinen Schwengel und pumpt ihn und erleichtert sich auf ihr Gesicht.
Sie weiß, worauf er scharf ist.
Sie kennt die Filme auch.
Also nimmt sie was an den Finger, schleckt es auf, schaut ihm treuherzig ins Gesicht und macht »Mmmmmm!« Jetzt lächelt er zufrieden.
Als Peaches raus ist, geht sie ins Bad, putzt sich die Zähne, bis das Zahnfleisch blutet, spült den Mund mit Listerine und lässt es eine Minute lang einwirken, bevor sie es ausspuckt. Dann nimmt sie eine lange, fast brühend heiße Dusche, zieht den Bademantel über und geht ans Fenster.
Da unten steht der Nette, Schüchterne an sein Auto gelehnt, und sie stellt sich vor, er wäre ihr Boyfriend.
ZWEITER TEIL
Kerberos
4 Das mexikanische Trampolin
Wer besitzt die Schiffe, wer besitzt die Flugzeuge?
Malcolm X
Guadalajara Mexiko
1984
Art Keller sieht der DC-4 bei der Landung zu.
Sein Auto steht auf einer Anhöhe über dem Flughafen von Guadalajara, neben im sitzt Ernie Hidalgo. Nach einer Weile beobachten sie, wie mexikanische Federales beim Löschen der Fracht helfen.
»Die machen sich nicht mal die Mühe, ihre Uniformen auszuziehen«, sagt Hidalgo.
»Warum sollten sie?«, erwidert Keller. »Was die da machen, ist doch ihr fob, oder?«
Keller hat sein Nachtsichtgerät auf die Landebahn für Frachtflugzeuge gerichtet, die vom Hauptrollfeld abzweigt. Am diesseitigen Rand stehen Lagerhallen und ein paar Baracken mit den Büros der Luftspediteure. Vor den Hallen sind Lkw geparkt, und die Federales beladen sie mit Kisten, die aus dem Flugzeug kommen.
»Nimmst du das auf?«, fragt Keller.
»Bitte lächeln!«, sagt Hidalgo und lässt die Kamera schnurren. Ernie Hidalgo ist unter den Gangs von El Paso aufgewachsen, musste erleben, wie die Drogen sein Barrio zerstörten, und wollte etwas dagegen unternehmen. Als ihm Keller den Job in Guadalajara anbot, hat er mit Freuden zugegriffen. Jetzt fragt er: »Und was, glaubst, steckt in den Kisten?«
»Schokokekse?«
»Häschenpantoffeln?«
»Wir wissen nur, was nicht drinsteckt«, sagt Keller. »Nämlich Kokain. Denn ...«
Zusammen beenden sie den Satz: »... es gibt kein Kokain in Mexiko!«
Sie lachen über ihr gemeinsames Mantra, das ironische Nachbeten der Parole, die von ihren Chefs bei der DEA ausgegeben wurde. Wenn es nach den Sesselfurzern in Washington geht, sind die mit Kokain beladenen Flugzeuge, die hier öfter landen als die Linienmaschinen der United Airlines, lediglich ein Phantasieprodukt von Art Keller.
Denn die mexikanische Drogenmafia, so heißt es, wurde im Rahmen der Operation Condor ausgeschaltet. Das bestätigen die offiziellen Berichte, das sagt die DEA, das Außenministerium und auch der Justizminister. Und keine dieser erwähnten Instanzen ist sonderlich interessiert an Art Kellers Phantasien über angebliche mexikanische Drogenkartelle.
Keller weiß, wie sie über ihn reden. Dass er zu einer echten Belastung wird, weil er sie jeden Monat mit seinen Berichten bombardiert, weil er ein Häuflein Opiumbauern, die vor neun Jahren aus den Bergen von Sinaloa vertrieben wurden, zu einer »Federacion« aufbauscht. Weil er allen auf den Nerv geht wegen der paar Figuren, die Marihuana, vielleicht auch ein bisschen Heroin in Umlauf bringen, wo er doch wissen müsste, dass die USA von einer wahren Crack-Epidemie heimgesucht werden, und das dafür nötige Kokain kommt aus Kolumbien, nicht aus dem verdammten Mexiko.
Sie haben ihm sogar Tim Taylor aus Mexico City rübergeschickt, damit er ihm sagt, er soll endlich Ruhe geben. Der DEA-Resident in Mexiko hat Art Keller, Ernie Hidalgo und Shag Wallace im Hinterzimmer des DEA-Büros von Guadalajara versammelt und ihnen verkündet: »Die eigentlichen Sachen laufen woanders, das müsst ihr Jungs endlich mal kapieren, statt Dinge zu erfinden, die -«
»Wir erfinden gar nichts«, hat Keller ihm erwidert.
»Wo sind die Beweise?«
»An denen arbeiten wir.«
»Nein«, hat Taylor gesagt. »Wo nichts ist, gibt es auch nichts zu beweisen. Der Justizminister der Vereinigten Staaten hat vorm Kongress erklärt -«
»Ich hab die Rede gelesen.«
»- dass das mexikanische Drogenproblem beseitigt ist. Wollt ihr den Minister aussehen lassen wie ein Arschloch?«
»Ich glaube, das schafft er auch ohne unsere Hilfe.«
»Das werde ich ihm berichten, Arthur, da können Sie Gift drauf nehmen. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie nicht in Mexiko rumlaufen und Phantomen nachjagen, die gar nicht existieren. Haben wir uns da verstanden?«
»Klar«, hat Keller gesagt. »Wenn mir jemand mexikanisches Kokain verkaufen will, soll ich einfach nein sagen.«
Jetzt, drei Monate später, beobachtet er nichtexistente Federales dabei, wie sie nichtexistentes Kokain auf nichtexistente Lkw verladen und an die nichtexistenten Mitglieder der nichtexistenten Federación liefern.
Offenbar gibt es ein Gesetz der paradoxen Wirkungen, denkt Keller beim Anblick der Kisten schleppenden Federales. Operation Condor sollte das Krebsgeschwür der Opiumproduktion beseitigen, doch bewirkt hat sie, dass sich überall im Land Metastasen bilden. Das muss man den Opiumbauern von Sinaloa lassen - ihre Reaktion auf die Vertreibung war einfach genial. Sie haben begriffen, dass ihr wertvollstes Kapital nicht die Drogen sind, sondern die zweitausend Meilen gemeinsame Grenze mit den USA. Den Boden kann man vergiften, Ernten kann man verbrennen, Menschen kann man vertreiben, aber diese Grenze steht fest, ihr kann man nichts anhaben. Und eine Ware, die auf der einen Seite der Grenze ein paar Cent wert ist, lässt sich auf der anderen Seite für zig Dollar verkaufen.
Die Ware, um die es geht, ist - allen offiziellen Verlautbarungen zum Trotz - Kokain.
Die Federación hat eine sehr einfache und profitable Vereinbarung mit dem Medellin-Kartell und dem Cali-Kartell geschlossen. Die Kolumbianer zahlen tausend Dollar für jedes Kilo Kokain, das die Mexikaner in die USA schmuggeln. Mit anderen Worten, die Federación ist von der Drogenproduktion auf den Drogentransport umgestiegen. Die Mexikaner übernehmen das Kokain aus Kolumbien, bringen es zu den Depots entlang der US-Grenze, schmuggeln es auf die andere Seite und übergeben es dort an die Kolumbianer, die ihnen die versprochenen tausend Dollar pro Kilo zahlen und das Kokain in ihren Labors zu Crack verarbeiten - das dann Wochen, manchmal auch nur Tage später, nachdem das Kokain Kolumbien verlassen hat, auf den Straßen der USA vertrieben wird.
Das alles läuft nicht über Florida - weil die DEA auf diese Schmuggelroute eindrischt wie auf einen Maulesel -, sondern über die schlecht bewachte mexikanische »Hintertür«.
Und dank der Federación, denkt Keller, läuft die Sache wie geschmiert.
Aber wie?, fragt er sich und muss zugeben, dass seine Theorie einige gravierende Lücken hat. Wie kann ein Flugzeug durch ganz Mittelamerika fliegen, von Kolumbien bis Guadalajara, ohne vom Radar erfasst zu werden? Über ein Gebiet, das nicht nur von der DEA kontrolliert wird, sondern, dank dem kommunistischen Sandinista-Regime in Nicaragua, auch von der CIA? Dazu kommen Spionagesatelliten, AWACS-Aufklärer - und doch fallen diese Flüge niemandem auf?
Es muss auch ein Treibstoffproblem geben. Eine DC-4 wie die, die dort unten steht, kann die lange Strecke nicht nonstop zurückgelegt haben. Irgendwo muss sie aufgetankt worden sein. Aber wo? Was er sich da vorstellt, liege außerhalb des Möglichen, haben ihm seine Vorgesetzten frohgemut erklärt.
Ja, denkt Keller, vielleicht haben sie recht. Aber dort unten steht das Flugzeug, randvoll mit Kokain beladen. Genauso real wie die Crack-Epidemie, die in den amerikanischen Gettos so viel Leid verursacht. Ich weiß also, dass die Sache funktioniert, denkt Keller. Ich weiß nur nicht, wie sie funktioniert.
Aber das finde ich heraus.
Und werde es beweisen.
»Was ist da los?«, fragt Ernie?
Ein schwarzer Mercedes hält vor einer Bürobaracke. Ein paar Federales öffnen den Wagenschlag, und ein großer, schlanker Mann im schwarzen Anzug steigt aus. Keller sieht die Glut seiner Zigarre, während der Mann durch ein Spalier von Federales die Baracke betritt.
»Ob er das ist?«, fragt Ernie.
»Wer?«
»Der sagenumwobene M-i persönlich.«
»M-i« ist das mexikanische Kürzel für das nichtexistente Oberhaupt der nichtexistenten Federación.
Die Erkenntnisse, die Keller in den vergangenen Jahren zusammengetragen hat, besagen, dass die Federación ihr Operationsgebiet in drei Regionen aufgeteilt hat wie weiland Julius Cäsar das Gebiet der Gallier. Die drei Regionen, das sind die Golfstaaten, Sonora und Baja, und zusammen decken sie die gesamte Südgrenze der Vereinigten Staaten ab. Jede Region wird von einem der Männer kontrolliert, die infolge der Operation Condor aus ihren Anbaugebieten in Sinaloa vertrieben wurden, und Keller hat sogar die Namen dieser drei Männer ermittelt.
Die Golfregion: García Ábrego.
Die Sonora-Region: Chalino Guzmán alias el Verde, »Der Grüne«.
Die Baja-Region: Gúero Méndez.
Und an der Spitze dieses Triumvirats steht M-i, der seinen Sitz in Guadalajara hat.
Aber sie können ihm keinen Namen, kein Gesicht zuordnen.
Wirklich nicht?, fragt sich Keller. Ich bin mir ziemlich sicher, wer der Chef der Federación ist. Ich hab ihm selbst in den Sattel geholfen.
Keller richtet den Feldstecher auf das Barackenfenster und nimmt den Mann ins Visier, der sich nun an einen Schreibtisch setzt. Er trägt einen konventionellen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd mit offenem Kragen, ohne Krawatte. Sein angegrautes schwarzes Haar ist glatt zurückgekämmt. Sein schmales Gesicht ziert ein Oberlippenbärtchen, und er raucht eine schlanke Zigarre.
»Schau dir die Federales an«, sagt Ernie. »Die salutieren wie beim Papstbesuch. Also, ich hab den Kerl noch nie gesehen. Du etwa?«
»Nein«, sagt Keller und legt den Feldstecher hin. »Ich auch nicht.«
Nicht in den letzten neun Jahren, zumindest. Aber Tío hat sich nicht sehr verändert.
Sie haben ein Haus im Tlaquepaque-Viertel gemietet - kleine alte Stadthäuser, viel Grün, Boutiquen und gehobene Restaurants.
Als Keller nach Hause kommt, schläft Althea schon. Kein Wunder, denkt Keller, es ist ja auch drei Uhr nachts. Die vergangenen zwei Stunden hat er damit verbracht, M-i zu verfolgen und seine Tarnung aufzudecken, was keine leichte Sache war. Er hatte mit Ernie auf den schwarzen Mercedes gewartet, bis er auf die Landstraße einbog, die zurück nach Guadalajara führte, und war ihm mit sicherem Abstand durch die Altstadt gefolgt, vorbei an den vier Plätzen - Plaza de Armas, Plaza de la Liberación, Plaza de la Rotonda de los Hombres und Plaza Taparía -, in deren Mitte die Kathedrale steht. Dann durch das moderne Geschäftsviertel und wieder hinaus an den Stadtrand, wo der schwarze Mercedes schließlich in den Hof eines Autohändlers einfuhr.
Deutsche Importe. Luxuskarossen.
Aus sicherer Entfernung beobachteten sie, wie Tío im Gebäude verschwand, ein paar Minuten später wieder herauskam und in einen neuen Mercedes 510 stieg. Diesmal ohne Chauffeur, ohne Wachmänner. Sie verfolgten ihn in ein reiches Villenviertel, wo Tío in eine Einfahrt einbog, ausstieg und in seinem Haus verschwand.
Wie ein ganz normaler Geschäftsmann nach einem langen Arbeitstag.
Wunderbar, denkt Keller. Morgen früh trage ich die Adresse des Autohändlers und von Tíos Villa in die Fahndungsakte ein und liefere die komplette Identität von M-i.
Miguel Angel Barrera.
Tío Angel.
Keller öffnet die Hausbar und gönnt sich einen Johnny Walker Black Label. Dann geht er durch den Flur, nach den Kindern schauen. Cassie ist fünf und sieht gottlob wie ihre Mutter aus. Der dreijährige Michael kommt ebenfalls nach seiner Mutter, hat aber Kellers kräftige Statur. Althea findet es ganz aufregend, dass beide Kinder dank dem mexikanischen Hauspersonal auf dem besten Wege sind, zweisprachig aufzuwachsen. Michael verlangt nicht mehr nach Brot, sondern nach pan, Wasser ist für ihn zu agua geworden.
Keller gibt seinen Kindern einen behutsamen Kuss und geht zurück durch den langen Flur, durchs Schlafzimmer ins angrenzende Bad, wo er lange und ausführlich duscht.
Althea hatte seine YOYO-Regel schon ins Wanken gebracht, doch die Kinder machten ihr endgültig den Garaus. Als er seine neugeborene Tochter sah, wusste er, dass sein »You are on your own« in tausend Stücke zerschellt war, und als sein Sohn kam, eine kleine Kopie seiner selbst, war es nicht besser, nur anders. Und er hatte eine Erleuchtung: Gegen einen schlechten Vater hilft nur, ein guter Vater zu werden.
Und das ist er wirklich. Ein liebevoller Vater für seine Kinder, ein treusorgender Gatte für seine Frau. Die Wut und Erbitterung seiner Jugend ist weitgehend verblasst, nur eine Rechnung ist offengeblieben - die mit Tío Barrera.
Weil Tío mich benutzt hat, damals während der Operation Condor. Er hat mich dazu benutzt, seine Rivalen auszuschalten und seine Federación aufzubauen. Hat mich glauben lassen, ich zerstöre ein Drogennetzwerk, während ich ihm geholfen habe, ein größeres und besseres zu errichten.
Vergiss das nicht, sagt er sich unter der heißen Dusche, die auf seine müden Schultern niederprasselt. Das ist der Grund, weshalb du hier bist.
Sein Wunsch, ins ferne Guadalajara versetzt zu werden, hatte sehr seltsam angemutet für einen wie ihn, für den Helden der Operation Condor. Dass er Don Pedro das Handwerk gelegt hatte, war seiner Karriere sehr dienlich gewesen. Von Sinaloa wurde er nach Washington versetzt, von dort nach Miami, von dort nach San Diego. Art Keller, der Wunderknabe, war drauf und dran, mit dreiunddreißig Jahren der jüngste RAC oder Regionalchef der DEA zu werden. Und seinen Einsatzort durfte er sich aussuchen.
Alle waren verblüfft, als er sich Guadalajara aussuchte.
Und seine Karriere gegen den Baum fuhr.
Kollegen, Freunde, Rivalen fragten ihn nach dem Grund.
Doch Keller verriet ihn nicht.
Nicht mal sich selbst gegenüber ist er ganz ehrlich.
Dass er nur dort ist, um eine alte Rechnung zu begleichen.
Und vielleicht sollte ich's dabei belassen, denkt er, als er aus der Dusche kommt, nach dem Handtuch greift und sich abrubbelt.
Es wäre so einfach, sich zurückzulehnen und Dienst nach Vorschrift zu machen. Die kleinen Marihuana-Dealer zu schnappen, die ihm die Mexikaner als Beute zuteilen. Brav Berichte abzuliefern über die fruchtbare Zusammenarbeit mit den mexikanischen Drogenbehörden. (Was ein guter Witz wäre, denn die US-finanzierten Flugzeuge mit den Entlaubungsmitteln versprühen meist nur Wasser - und päppeln die Mohn- und Hanffelder hoch, statt sie zu vernichten.)
Keine Ermittlungen zu M-i, keine Erkenntnisse über Miguel Angel Barrera.
Lass die Vergangenheit ruhen, sagt er sich.
Die Schlange küssen, das muss nicht sein.
Doch, es muss sein.
Seit neun Jahren verfolgen ihn die Bilder und Erinnerungen. All die Zerstörung, all das Leid, all die Toten im Gefolge von Operation Condor, und das nur, damit Tío seine Federación aufbauen und sich selbst zu ihrem Kopf machen konnte.
Das Gesetz der paradoxen Wirkungen? Unsinn! Diese Wirkungen waren beabsichtigt, Tío hatte sie genau geplant.
Er hat dich benutzt, hat dich wie einen Hund auf seine Feinde gehetzt, und du bist auf ihn reingefallen.
Hast danach fein den Mund gehalten.
Während sie dir auf die Schulter schlugen, dich als Held feierten, dich endlich als ihresgleichen anerkannten. Du verlogener Hundesohn. Das war es doch nur, was du wolltest. Du wolltest endlich dazugehören.
Und hast deine Seele dafür verkauft.
Jetzt denkst du, du kannst sie zurückkaufen.
Lass sie sausen, du hast eine Familie, die dich braucht.
Er schlüpft ins Bett, ganz vorsichtig, damit Althea nicht aufwacht, aber sie wacht trotzdem auf.
»Wie spät?«, fragt sie.
»Fast vier.«
»Vier Uhr morgens?«
»Schlaf weiter.«
»Wann musst du aufstehen?«, fragt sie. »Um sieben.«
»Dann weck mich. Ich muss in die Bibliothek.«
Sie hat einen Leseausweis für die Universitätsbibliothek, wo sie an ihrer Habilschrift arbeitet: »Die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte im vorrevolutionären Mexiko. Ein statistisches Modell.«
Dann sagt sie: »Wollen wir kuscheln?«
»Es ist vier Uhr morgens.«
»Ich hab nicht gefragt, wie spät es ist, sondern ob du kuscheln willst. Na, komm schon.«
Ihre Hand fühlt sich warm an, und ein paar Sekunden später schon ist er in ihr drin. Es ist jedes Mal, als würde er nach Hause kommen. Als ihr Höhepunkt naht, packt sie ihn von hinten und schiebt ihn kräftig rein. »Das war schön«, sagt sie. »Jetzt lass mich schlafen.«
Und schläft ein.
Er aber liegt wach.
Am Morgen begutachtet Keller die Fotos - das Flugzeug, die Federales, die es entladen und Tío in die Baracke eskortieren, Tío, am Schreibtisch sitzend.
Dann hört er sich an, was Ernie inzwischen herausgefunden hat.
»Ich hab mich bei EPIC umgetan«, sagt er und meint damit das El Paso Intelligence Center, eine Datenbank, die alle Daten der DEA, des Zolls und der Einwanderungsbehörde koordiniert. »Miguel Angel Barrera war Polizeioffizier in Sinaloa, genauer gesagt, der persönliche Sicherheitsoffizier des Gouverneurs. Beste Beziehungen zum mexikanischen Geheimdienst DFS. Aber jetzt hör zu: Er hat zu unseren Leuten gehört, als die Operation Condor lief, damals 1977. Berichte bei EPIC besagen, dass er die damalige Heroinproduktion in Sinaloa im Alleingang gestoppt hat. Danach hat er den Polizeidienst verlassen und kommt bei EPIC nicht mehr vor.«
»Keine Treffer nach 1977?«, fragt Keller.
»Nada«, bestätigt Ernie. »Hier in Guadalajara kannst du den Faden wieder aufnehmen. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, besitzt einen Autosalon, vier Restaurants, zwei Wohnhäuser und etliche Grundstücke. Sitzt im Vorstand von zwei Banken und unterhält beste Beziehungen zur Provinzregierung in Jalisco und nach Mexico City.«
»Nicht unbedingt das Profil eines Drogenbarons«, sagt Shag.
Shag ist ein netter Bursche aus Tucson, ein Vietnamveteran, der vom militärischen Geheimdienst zur DEA kam und auf seine stille Art genauso hartgesotten ist wie Ernie. Seine Intelligenz verbirgt er hinter seinem cowboyhaften Auftritt, und so mancher Dealer sitzt jetzt im Knast, weil er Shag Wallace unterschätzt hat.
Ernie zeigt auf die Fotos: »Aber hier sieht man, dass er die Kokaintransporte überwacht.«
»Könnte er M-i sein?«
»Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden«, sagt Keller.
Indem ich noch einen Schritt näher an den Abgrund gehe, denkt er im Stillen, doch er sagt: »Es gibt keine Ermittlungen zur Kokain-Connection von Barrera. Ist das klar?«
Ernie und Shag schauen ihn verdutzt an, aber sie nicken beide.
»Ich möchte nichts davon in euren Berichten wiederfinden, keine Aufzeichnungen, egal, welcher Art«, sagt er. »Uns interéssiert nur Marihuana. In diesem Zusammenhang, Ernie: befrag deine mexikanischen Quellen, ob sie was mit dem Namen Barrera anfangen können. Und du, Shag, kümmerst dich um das Flugzeug.«
»Wie wär's mit einer Observation von Barrera?«, fragt Ernie.
Keller schüttelt den Kopf. »Ich möchte ihn nicht aufschrecken, bevor wir so weit sind. Wir kreisen ihn ein. Sammeln Hinweise, überprüfen den Flug, arbeiten uns an ihn ran. Wenn er derjenige ist.«
Scheiße, denkt Keller. Du weißt doch, dass er's ist.
Die Nummer der DC-4 lautet N-3423VX.
Shag arbeitet sich durch einen Papierwust von Holdings, Briefkastenfirmen, Tarnfirmen. Die Suche endet bei einer Luftfrachtgesellschaft mit dem Namen Servicios Turísticos - SETCO -, die ihren Sitz auf dem Aguacate Flughafen in Tegucigalpa, Honduras, hat.
Dass jemand Drogen aus Honduras herausschafft, ist etwa genauso überraschend wie der Anblick eines Würstchenverkäufers im Yankee-Stadion. Honduras, das Urmuster der »Bananenrepublik«, schaut auf eine lange Tradition als Drogenumschlagplatz zurück, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts befand sich das Land im Alleinbesitz von United Fruit und Standard Fruit. Die beiden Konzerne hatten ihren Sitz in New Orleans, und die Docks von New Orleans befanden sich im Alleinbesitz der Mafia von New Orleans, denn die kontrollierte die Hafenarbeitergewerkschaft. Wenn also die Konzerne ihre Ladung gelöscht haben wollten, taten sie gut daran, noch andere Waren unter den Bananen zu verstecken.
Mit den Bananendampfern kam soviel Dope ins Land, dass Heroin im Mafia-Slang als banana bezeichnet wurde. Ein Firmensitz in Honduras, denkt Keller, ist keine Überraschung. Und es erklärt, wo die Flugzeuge aufgetankt werden.
Auch die Eigentümer der SETCO sind für Keller keine Unbekannten.
David Núñez und Ramón Mette Ballasteros.
Núñez ist Exilkubaner mit Wohnsitz in Miami. Daran ist nichts Besonderes. Das Besondere liegt darin, dass Núñez an Operation 40 beteiligt war, einem CIA-Programm zur Ausbildung von Exilkubanern für die Machtübernahme nach einer erfolgreichen Invasion. Nur war dann die Invasion in der Schweinebucht nicht zum Erfolg geworden, sondern zu einem historischen Fiasko. Ein Teil der Jungs von Operation 40 lag tot am Strand, ein anderer Teil endete vor dem Erschießungskommando, und diejenigen, die Glück hatten, schafften es zurück nach Miami.
Núñez gehörte zu den Glücklichen.
Die Akte von Ramón Mette Ballasteros muss Keller nicht allzu gründlich studieren. Er kennt sie bereits. Mette hat in den goldenen Zeiten der Heroinproduktion für die gomeros als Chemiker gearbeitet. Kurz vor Operation Condor ist er ausgestiegen, hat sich in seiner Heimat Honduras dem Kokain-Geschäft zugewandt. Und es heißt, er hat den Putsch, der erst kürzlich zum Sturz des honduranischen Präsidenten führte, aus eigener Tasche finanziert.
Okay, denkt Keller, die zwei Profile ergänzen sich hervorragend. Ein großer Kokainhändler besitzt eine Fluggesellschaft, die er benutzt, um Kokain nach Miami zu schmuggeln. Aber zumindest eins der SETCO-Flugzeuge fliegt stattdessen Guadalajara an, und das wiederum passt nicht ins offizielle Bild.
Als nächster Schritt böte sich an, das DEA-Büro in Tegucigalpa zu kontaktieren, aber das geht nicht, weil es im vergangenen Jahr geschlossen wurde, »mangels Masse«, wie es heißt. Honduras und El Salvador werden jetzt von Guatemala aus überwacht, also ruft Keller bei Warren Farrar an, dem DEA-Residenten in Guatemala City.
»SETCO«, sagt Keller.
»Was ist damit?«, fragt Farrar.
»Ich hatte gehofft, das von dir zu hören.«
Es entsteht ein Schweigen, das Keller stutzig werden lässt, dann antwortet Farrar: »In dieser Angelegenheit kann ich keine Spielchen mit dir machen, Keller.«
Wirklich nicht? Da muss sich Keller aber wundern. Jedes Jahr sitzen sie gemeinsam in zigtausend Konferenzen, da müsste ein Spielchen schon mal drin sein, gerade in dieser Angelegenheit.
Also versucht er es aufs Geratewohl. »Warum wurde eigentlich das Büro in Honduras geschlossen, Warren?«
»Worauf willst du verdammt noch mal hinaus?«
»Weiß ich nicht. Deshalb frage ich ja.«
Vielleicht hat Mette, als er den Putsch finanzierte, vom neuen Präsidenten eine kleine Gegenleistung verlangt: die Schließung des DEA-Büros in Tegucigalpa. Könnte ja sein.
Doch statt zu antworten, legt Farrar auf.
Na, besten Dank, Warren. Was macht dich eigentlich so nervös?
Der nächste Schritt: Keller ruft das Außenministerium an, Abteilung »Drogen-Support«, eine Bezeichnung von so bitterer Ironie, dass Keller weinen möchte, und deshalb erklären sie ihm auch im schönsten Bürokratenkauderwelsch, dass er sich zum Teufel scheren soll.
Darauf ruft er das CIA-Verbindungsbüro an, gibt seine Frage durch und bekommt noch am selben Nachmittag einen Rückruf. Dass allerdings John Hobbs am Apparat ist, hat er nicht erwartet.
John Hobbs persönlich.
In den alten Zeiten hatte Hobbs das Kommando über Operation Phoenix. Keller war ein paarmal zum Rapport bei ihm erschienen, und Hobbs hatte ihm sogar einen Job für die Zeit nach Vietnam angeboten, aber als es so weit war, hatte sich Keller doch lieber für die DEA entschieden.
Inzwischen ist Hobbs zum Regionalchef für Mittelamerika aufgerückt.
Logisch, denkt Keller. Ein kalter Krieger sucht sich seinen kalten Krieg.
Sie machen ein bisschen Small-Talk (Wie geht's Althea und den Kindern? Wie gefällt es Ihnen in Guadalajara?), dann fragt Hobbs: »Was kann ich für Sie tun, Arthur?«
»Vielleicht könnten Sie mich über eine Fluggesellschaft aufklären«, sagt Keller. »Sie heißt SETCO. Eigentümer ist Ramón Mette.«
»Ja, meine Leute haben mir Ihre Frage weitergeleitet«, sagt Hobbs. »Aber da muss ich passen, fürchte ich.«
»Sie können mir nichts sagen.«
»Die Antwort ist nein.«
Nein, wir haben keine Bananen, denkt Keller. Heute gibt es keine Bananen.
Hobbs redet weiter. »Über SETCO haben wir keine Erkenntnisse.«
»Na, dann vielen Dank für den Rückruf.« Jetzt fragt Hobbs: »Was haben Sie denn da unten zu laufen, Arthur?«
»Ich hab nur ein paar Hinweise aufgegabelt«, lügt Keller. »Hinweise, dass SETCO mit dem Transport von Marihuana zu tun haben könnte.«
»Marihuana.«
»Sicher«, sagt Keller. »Was anderes gibt's doch in Mexiko nicht mehr.«
»Na, dann viel Erfolg bei der Arbeit, Arthur«, sagt Hobbs. »Tut mir leid, dass wir Ihnen nicht weiterhelfen können.«
»Ihre Mühe weiß ich zu schätzen«, erwidert Keller.
Er legt auf und fragt sich, warum sich der Regionalchef für Mittelamerika, der rund um die Uhr mit der Niederschlagung der Sandinisten beschäftigt ist, die Zeit nimmt, ihn persönlich anzurufen - und zu belügen.
Niemand will über SETCO reden, denkt Keller. Weder meine Kollegen von der DEA noch das Außenministerium, nicht mal die CIA.
Alles eine Suppe, denkt er. Und die Buchstaben in der Suppe ergeben immer nur ein Wort: YOYO. You are on your own.
Ernie macht ähnliche Erfahrungen.
Wenn er seine Quellen mit dem Namen Barrera konfrontiert, klappen sie das Visier herunter. Selbst die größten Plaudertasehen bekommen plötzlich Maulsperre. Barrera ist einer der prominentesten Geschäftsleute der Stadt, aber keiner hat je von ihm gehört.
Lass ihn laufen, sagt sich Keller. Das ist deine Chance.
Es geht nicht.
Warum nicht?
Ich kann es nicht.
Sei wenigstens ehrlich.
Okay. Vielleicht weil ich's nicht ertrage, dass er der Sieger bleibt. Vielleicht weil ich ihm einen Denkzettel verpassen will. Klar. Aber du bist es am Ende, der den Denkzettel kassiert. Er bleibt immer schön im Hintergrund. Du kriegst ihn einfach nicht in die Finger.
Es stimmt. Sie kommen nicht an ihn ran.
Dann passiert das Verrückte.
Tío kommt zu ihnen.
Oberst Vega, ein hohes Tier bei den Federales in Jalisco und eigentlich Kellers Verbindungsoffizier, kommt in Kellers Büro, setzt sich hin und verkündet mit Grabesstimme: »Señor Keller, ich sage es ganz offen. Ich bin gekommen, um Sie in aller Höflichkeit, aber Entschiedenheit zu bitten - bitte unterlassen Sie es, Don Miguel Angel Barrera zu belästigen.«
Sie starren sich gegenseitig an, dann sagt Keller: »So gern ich Ihnen helfen würde, Oberst Vega, aber dieses Büro ermittelt nicht gegen Señor Barrera. Nicht dass ich wüsste, jedenfalls.«
Er ruft ins andere Büro hinüber: »Shag, ermittelst du gegen Señor Barrera?«
»Nein, Sir.«
»Ernie?«
»Nein.«
Keller hebt die Hände und zuckt mit den Schultern.
»Senor Keller«, sagt Vega und schaut durch die Tür zu Ernie hinüber. »Ihr Mitarbeiter wirft auf unverantwortliche Weise mit dem Namen von Don Miguel um sich. Señor Barrera ist ein angesehener Geschäftsmann mit vielen Freunden in der Regierung.«
»Und offenbar auch beim Regionalbüro der Bundespolizei.«
»Sie sind Mexikaner, nicht wahr?«, fragt Vega. »Ich bin Amerikaner.« Und?, fragt er sich. Was machst du daraus?
»Aber Sie sprechen Spanisch.« Keller nickt.
»Dann kennen Sie ja das Wort intocable«, sagt Vega und erhebt sich. »Senor Keller, Don Miguel ist intocable.« Unantastbar.
Mit dieser Feststellung verabschiedet sich Vega.
Ernie und Shag kommen zu Keller ins Zimmer. Shag will anfangen zu reden, aber Keller stoppt ihn und gibt beiden zu verstehen, dass sie jetzt alle das Büro verlassen werden. Sie gehen etwa einen Block weit, bis Shag schließlich fragt: »Woher weiß Vega, dass wir gegen Barrera ermitteln?«
Zurück im Büro, brauchen sie nur ein paar Minuten, bis sie das winzige Mikro unter Kellers Schreibtisch aufgespürt haben. Ernie will es herausreißen, aber Keller packt ihn beim Handgelenk. »Ich könnte ein Bier gebrauchen«, sagt er. »Ihr auch?«
Sie fahren in eine Bar in der Altstadt.
»Wunderbar«, sagt Ernie. »In den Staaten werden die bösen Buben von den Cops abgehört. Hier werden die Cops von den bösen Buben abgehört.«
Shag schüttelt den Kopf. »Das heißt, sie wissen alles, was wir wissen.«
Na gut, denkt Keller. Sie wissen, dass wir in Tío M-i vermuten, den Kopf der Federación. Sie wissen, dass wir das Kokain-Flugzeug als Eigentum von Núñez und Mette identifiziert haben. Und sie wissen, dass wir damit keinen Schritt weiterkommen. Was macht sie also so nervös? Warum schicken sie Vega los, um eine Ermittlung zu stoppen, die zu nichts führt?
Und warum gerade jetzt?
»Okay«, sagt Keller. »Wir funken ihnen was rüber. Sollen sie glauben, dass sie uns gestoppt haben. Ihr Jungs haltet euch eine Weile zurück.«
»Und was hast du vor, Art?«
Ich? Ich werde den Unantastbaren antasten.
Im Büro erzählt er Ernie und Shag, dass sie die Ermittlungen zu Barrera leider einstellen müssen. Dann geht er hinaus zur Telefonzelle und ruft Althea an. »Ich schaff's heut nicht zum Abendessen.«
»Schade.«
»Ja, schade. Gib den Kindern einen Gutenachtkuss von mir.«
»Mache ich. Hab dich lieb!«
»Ich dich auch.«
Jeder Mensch hat einen Schwachpunkt, denkt Keller, ein Geheimnis, das ihn verletzlich macht. Ich muss es aufdecken. Mein Geheimnis kenne ich. Aber welches ist deins, Tío?
Keller schafft es nicht, nach Hause zu kommen, nicht in dieser Nacht, auch nicht in den nächsten fünf Nächten.
Ich bin wie auf Entzug, denkt er. Von trockenen Alkoholikern hat er gehört, wie das läuft - wie sie zum Laden gefahren sind und sich geschworen haben, sie würden nicht hineingehen, dann geschworen haben, sie würden nichts kaufen, dann geschworen haben, sie würden das Zeug nicht trinken.
Und es dann getrunken haben.
So einer bin ich auch, denkt Keller. Ich klebe an Tío wie ein Trinker an der Flasche.
Statt also nach Hause zu fahren, parkt er auf dem Boulevard, ein gutes Stück entfernt von Tíos Autosalon, und beobachtet die Einfahrt im Rückspiegel. Tío muss eine Menge Autos verkaufen, denn er arbeitet bis acht oder halb neun am Abend, dann steigt er in sein Auto und fährt nach Hause. Keller wartet am Ende der Straße, der einzigen Zufahrt zu Tíos Haus, bis weit in die Nacht, aber Tío zeigt sich nicht.
Endlich, am sechsten Abend, hat Keller mehr Glück.
Tío verlässt den Autosalon um halb sieben und fährt nicht nach Hause, sondern zurück in die Stadt. Mit Mühe gelingt es ihm, dem Wagen im Abstand zu folgen, durch den dichten Verkehr des Centro Histórico, bis er vor einem Tapas-Lokal hält.
Zwei Federales, zwei Provinzpolizisten und ein paar Kerle, die aussehen wie DFS-Agenten, stehen draußen Wache, und ein Schild an der Tür verkündet CERRADO - geschlossen. Einer von den Federales hält Tío die Wagentür auf, der andere bringt den Wagen weg wie ein Hotelboy. Einer von den Provinzpolizisten hält Tío die Tür zum Lokal auf, der andere geht auf Kellers Auto zu und winkt ihn weiter.
Keller öffnet das Seitenfenster. »Ich wollte hier was essen.«
»Privatparty.«
Ja, vermute ich auch, denkt Keller.
Er parkt das Auto zwei Straßen weiter, greift nach der Nikon mit dem Dreihunderter-Objektiv und steckt sie unter den Mantel. Dann überquert er die Straße, geht ein Stück weiter, biegt links ein und läuft durch die Parallelstraße zurück, so weit, bis er schätzt, auf der Rückseite des Hauses zu stehen, das dem Tapas-Lokal gegenüberliegt. Mit einem Luftsprung erwischt er die Feuerleiter und zieht sie nach unten. Dann klettert er hoch, drei Etagen, bis aufs Dach.
Für Regionalchefs der DEA ist das nicht der richtige Job. Die sollen im Büro sitzen und die Zusammenarbeit mit den mexikanischen Behörden pflegen. Aber wenn ich sehe, wie sehr meine mexikanischen Kollegen bemüht sind, mein Zielobjekt vor mir zu verstecken, kommen mir ernstliche Zweifel am Nutzen dieser Zusammenarbeit, denkt sich Keller.
Geduckt überquert er das Dach bis zum Mäuerchen am vorderen Rand und legt sich flach hin. Observieren bedeutet Arbeit - auch für die chemische Reinigung, denkt er sich auf dem schmutzigen Dach. Er stellt die Kamera aufs Mäuerchen und fokussiert sie auf das Lokal. Und du kannst das nicht mal als Spesen abrechnen.
Jetzt heißt es warten, denkt er sich, doch es dauert nicht lange, bis sich ein ganzer Wagenkonvoi vor Talaveras Tapas aufreiht. Und der Ablauf ist jedes Mal derselbe: Die Provinzpolizisten stehen Wache, während die Federales die Lakaienrolle übernehmen und einen Drogenboss nach dem anderen ins Lokal geleiten.
Wie eine Hollywood-Premiere, denkt Keller.
García Ábrego, der Chef des Golf-Kartells, steigt aus seinem Mercedes und sieht sehr würdig aus mit seinem Silberhaar, dem sorgfältig gestutzten Schnurrbart und dem grauen Maßanzug. Gúero Méndez, Chef des Baja-Kartells, wirkt dagegen wie ein Cowboy. Langes blondes Haar unter dem weißen Cowboyhut - daher sein Spitzname Gúero -, dazu ein schwarzes, bis zur Taille offenes Seidenhemd, schwarze Seidenhose, spitze schwarze Cowboystiefel mit Silberkappen. Und in Chalino Guzmán erkennt man den Bauern, der er ist - ein altes, schlecht sitzendes Jackett, eine Hose, die nicht dazu passt, grüne Stiefel.
Mein Gott, das sieht ja aus wie ein ausgewachsenes Mafia-Treffen, staunt Keller, nur dass sich diese Jungs wegen der Polizeipräsenz nicht allzu viele Sorgen machen. Als würden sich die Paten des Cimino-, Genovese- und Colombo-Clans zu einem Gipfeltreffen vereinigen und das Ganze vom FBI bewachen lassen. Aber die sizilianische Mafia würde mich nicht so nah heranlassen, das ist der Unterschied. Ihre mexikanischen Vettern sehen das lockerer. Sie glauben sich in Sicherheit.
Womit sie wahrscheinlich recht haben.
Eins aber fragt sich Keller: Warum treffen sie sich hier? Tío besitzt ein halbes Dutzend Lokale in Guadalajara, nicht aber das Talavera. Warum veranstaltet er seine Gipfeltreffen nicht auf eigenem Terrain?
Vielleicht weil sich Tío dann eindeutig als M-i zu erkennen gibt.
Jetzt halten keine Autos mehr, Keller richtet sich auf eine lange Wartezeit ein. So etwas wie ein schnelles mexikanisches Essen gibt es nicht, und die Tagesordnung hat es wahrscheinlich in sich. Mein Gott, was würde ich drum geben, wenn ich in diesem Lokal eine Wanze verstecken könnte!
Er zieht einen KitKat-Riegel aus der Hosentasche, wickelt ihn aus, bricht zwei Stücken ab und steckt den Rest zurück in die Tasche, weil er nicht weiß, wie lange er auf die nächste Mahlzeit warten muss. Dann dreht er sich auf den Rücken, kreuzt die Arme auf der Brust, um die Kälte abzuhalten, und legt erst mal ein Nickerchen ein, gönnt sich ein paar Stunden unruhigen Schlaf, bis ihn Stimmen und das Klappen von Autotüren wecken.
Showtime!
Er geht wieder in Stellung und sieht, wie sie alle herauskommen, vor dem Lokal verweilen. Wenn es keine Federación gibt, denkt Keller, dann ist das hier verdammt gut gespieltes Theater. Alle stehen locker und unbefangen herum, lachen, schütteln Hände, zücken ihre kubanischen Zigarren und geben sich gegenseitig Feuer, während sie darauf warten, dass ihre Lakaien, die Federales, die Wagen vorfahren.
Den Rauch und das Testosteron rieche ich bis hier oben, denkt Keller.
Alles ändert sich mit einem Schlag, als das Mädchen aus der Tür tritt.
Was für ein Anblick! Eine junge Liz Taylor, doch mit olivfarbener Haut und dunklen Augen unter langen Wimpern. Aufreizend blickt sie in die Runde, während ein älterer Mann, der ihr Vater sein dürfte, nervös lächelnd in der Tür steht und den Gomeros ein adiós zuwinkt.
Aber die wollen gar nicht weg.
Gúero Méndez ist so hingerissen von dem Mädchen, dass er seinen Cowboyhut abnimmt. Was bei ungewaschenem Haar nicht besonders gut kommt, denkt Keller. Doch jetzt macht er sogar einen Bückling, verbeugt sich tief, schleift seinen Hut übers Pflaster und grinst das Mädchen an.
Seine silbernen Zähne blitzen im Licht der Laternen.
Bravo, Gúero, denkt Keller, damit kriegst du sie.
Tío kommt dem Mädchen zu Hilfe. Er legt den Arm geradezu väterlich um Gúeros Schultern und führt ihn mit elegantem Schwung zu seinem Auto, das gerade eben vorfährt. Bei der Abschiedsumarmung aber blickt Gúero noch einmal über Tíos Schulter zu dem Mädchen hinüber, bevor er einsteigt.
Das muss wahre Liebe sein, denkt Keller. Zumindest echte Gier.
Nachdem sich Ábrego mit einem würdevollen Handschlag verabschiedet hat, kehrt Tío zu dem Mädchen zurück, verbeugt sich und küsst ihre Hand.
Eine lateinamerikanische Höflichkeitsgeste?, fragt sich Keller.
Oder... Nein...
Aber am nächsten Tag geht Keller zum Lunch ins Talavera.
Das Mädchen heißt Pilar, und natürlich ist sie Talaveras Tochter.
Sie sitzt in der hinteren Ecke, scheinbar über einem Schulbuch brütend, doch ab und zu dreht sie sich in den Hüften und schaut unter ihren langen Wimpern hervor, wie um festzustellen, ob sie vielleicht einer anstarrt.
Alle Kerle in diesem Lokal starren sie an, denkt Keller.
Sie sieht älter aus als fünfzehn, abgesehen von einer Spur Babyspeck und dem noch halb kindlichen Schmollmund, den ihre aufreizend vollen Lippen perfekt hinbekommen. Obwohl sich Keller fast dafür schämt, taxiert er ihre ganz und gar nicht mehr kindlichen Proportionen. Dass sie wirklich erst fünfzehn ist, bestätigt sich erst, als ihre Mutter kommt, sich zu ihr setzt und sie lautstark daran erinnert.
Und Papa blickt jedes Mal ängstlich hoch, wenn die Tür aufgeht. Warum zum Teufel ist er so nervös?, fragt sich Keller.
Und wird sogleich aufgeklärt.
Tío kommt zur Tür herein.
Keller sitzt mit dem Rücken zur Tür, und Tío geht direkt an ihm vorbei - vorbei an seinem lang vermissten Neffen, ohne es zu merken, weil er nur Augen für das Mädchen hat. Und Blumen in der Hand. So wahr mir Gott helfe, denkt Keller, er umklammert einen Blumenstrauß mit seinen schlanken Fingern und hat zu allem Überfluss eine Bonbonniere unter dem Arm.
Tío ist gekommen, um ihr den Hof zu machen.
Das erklärt auch, warum Talavera so in Panik ist. Er weiß, dass Miguel Angel Barrera das Herrenrecht des ländlichen Sinaloa für sich beansprucht, wo die jungen Mädchen, meist Kinder noch, in aller Regel von den dominierenden Gomeros entjungfert werden.
Und das ist die Sorge der Eltern. Dass dieser mächtige patrón, der selbstverständlich verheiratet ist, ihre kostbare, hübsche, unberührte Tochter zu seiner segundera macht, seiner Geliebten. Dass er sie benutzt und wegwirft, ihren Ruf zerstört und damit alle Aussichten auf eine gute Partie.
Und es gibt absolut nichts, was sie dagegen tun können.
Tío wird das Mädchen nicht vergewaltigen, sagt sich Keller. Er wird sie nicht mit Gewalt entführen. Das könnte er sich in den Bergen von Sinaloa leisten, nicht hier. Doch wenn ihm das Mädchen freiwillig folgt, sind die Eltern machtlos. Und welches fünfzehnjährige Mädchen ist schon dagegen gefeit, dass ihr ein reicher und mächtiger Mann den Kopf verdreht? Dieses Kind ist sicher nicht dumm - sie weiß, dass es mit Blumen und Süßigkeiten beginnt, aber dass ihr auch Schmuck und teure Kleider winken, traumhafte Reisen und mehr. Sie steht am Anfang eines Regenbogens, ohne zu bedenken, dass er sich am Ende wieder neigt. Dass Schmuck und Kleider eines Tages von Blumen und Süßigkeiten abgelöst werden und dann auch die ausbleiben werden.
Während Tío das Mädchen hofiert, legt Keller ein paar Pesos auf den Tisch, steht unauffällig auf und geht zur Kasse.
Für dich, Tío, ist sie ein exotischer Leckerbissen, denkt Keller. Für mich so etwas wie ein Trojanisches Pferd.
Am Abend, es ist schon neun, steigt Keller in seine Jeans, zieht einen Pullover über und geht ins Badezimmer, wo Althea duscht. »Du, ich muss noch mal los.«
»Jetzt?«
»Ja.«
Sie ist klug genug, keine Fragen zu stellen - als Ehefrau eines Polizisten, der seit acht Jahren für die DEA arbeitet, weiß sie, woran sie ist. Aber das Wissen schützt nicht vor der Angst. Sie öffnet die Schiebetür und küsst ihn zum Abschied. »Ich brauche nicht auf dich zu warten, wie es aussieht.«
»Das siehst du richtig.«
Was hast du vor?, fragt er sich auf der Fahrt in die Vorstadt, zum Wohnhaus der Talaveras.
Nichts. Ich schwöre, dass ich nicht trinken werde.
Er findet die Adresse und parkt ein Stück weiter auf der anderen Straßenseite. Es ist ein stilles Viertel, solide Mittelklasse, die Straßenbeleuchtung sorgt für Sicherheit, ohne aufdringlich zu wirken.
Er sitzt in seinem dunklen Winkel und wartet.
Diese Nacht und auch die nächsten drei.
Jede Nacht, wenn die Talaveras von der Arbeit nach Hause kommen, sitzt er schon da. Er sieht, wie im oberen Stockwerk ein Licht angeht und nach einer Weile, wenn Pilar ins Bett gegangen ist, verlischt. Keller wartet noch eine halbe Stunde, dann fährt er nach Hause.
Vielleicht liegst du falsch, sagt er sich.
Nein, liegst du nicht. Tío nimmt sich, was er will.
In der vierten Nacht, Keller will sich gerade davonmachen, kommt ein Mercedes, schaltet den Scheinwerfer aus und hält vor dem Haus der Talaveras.
Sehr galant, denkt Keller, Tío schickt ihr einen Wagen mit Chauffeur. Bloß kein Taxi für dieses minderjährige Hürchen. Keller ist fast gerührt, als Pilar aus der Haustür schlüpft und hinten in den Wagen steigt.
Er lässt dem Mercedes reichlich Vorsprung, dann folgt er ihm.
Der Mercedes hält vor einem Reihenhaus, gelegen auf einem Hügel der westlichen Vorstadt. Ein nettes, stilles Viertel, ziemlich neu, viele kleine Häuschen, umgeben von den hier üblichen Jacaranden. Die Adresse ist Keller neu, sie gehört nicht zu den Immobilien, die er als Tíos Besitz ausgemacht hat. Wie nett, denkt er. Ein brandneues Liebesnest für eine brandneue Affäre.
Tíos Auto steht schon da. Der Chauffeur steigt aus und hält Pilar die Wagentür auf. Tío empfängt sie an der Tür und führt sie hinein. Bevor sich die Tür schließt, liegen sie sich schon in den Armen.
Heiliger Bimbam, denkt Keller. Wenn ich eine Fünfzehnjährige vögeln wollte, würde ich wenigstens die Vorhänge zumachen.
Aber du denkst, du bist hier sicher, nicht wahr, Tío?
Der gefährlichste Ort der Welt ist der ... ... wo du dich sicher glaubst.
Am nächsten Vormittag fährt Keller gleich wieder zur Casa del Amor (so hat er das Reihenhaus getauft), denn er weiß, dass Tío jetzt im Büro ist und Pilar in der - ähemm! - Schule. Er hat seinen Overall übergezogen und eine Astschere mitgebracht. Er schneidet auch wirklich ein paar vorwitzige Zweige ab, während er seine Erkundigungen einzieht, sich die Farbe des Außenanstrichs merkt, den Verlauf der Telefonleitung, die Lage der Fenster, des Pools, der Nebengebäude.
Eine Woche später, er hat inzwischen Bastlerläden besucht, einen Technikversand in San Diego angerufen, kommt er ein drittes Mal, wieder im Overall, und stutzt ein paar weitere Zweige, bis er sich zu den Büschen vorgearbeitet hat, die das Schlafzimmerfenster vor zudringlichen Blicken schützen. Dorthin zieht es ihn - nicht aus erotischer Neugier, diesen Teil der Veranstaltung möchte er sich lieber ersparen -, sondern weil die Telefonleitung ins Schlafzimmer führt. Mit einem kleinen Schraubenzieher bohrt er, behutsam wie ein Chirurg, ein Loch in die Eckfuge des Fensters, direkt über dem Fensterblech aus Aluminium. Dann schiebt er eine winzige FX-i0i-Wanze in das Loch, holt eine Tube Dichtungsmasse aus der Tasche und verschließt das Loch. Darauf öffnet er das Fläschchen mit grüner Farbe, die annähernd der Farbe des Anstrichs entspricht, und übermalt die Dichtungsmasse mit einem kleinen Pinsel, wie man ihn zum Lackieren von Modellflugzeugen benutzt. Vorsichtig bläst er die Farbe trocken, dann geht er auf Abstand, um seine Arbeit zu begutachten.
Die Wanze, illegal und ungenehmigt, ist von geübten Augen nicht zu entdecken.
FX-ioi zeichnet jedes Geräusch im Umkreis von zehn Metern auf und sendet es sechzig Meter weit, so dass für Keller ein ausreichender Aktionsradius verbleibt. Er geht hinaus auf die Straße, hebt den Gullydeckel an und befestigt den Empfänger und das stimmaktivierte Tonbandgerät mit Klebeband an der Schachtwand. So kann er eben mal vorbeikommen und eine neue Kassette einlegen.
Es ist ein Versuch auf gut Glück, aber er braucht ein paar Treffer. Tío wird das Haus vor allem für seine Nächte mit Pilar nutzen, aber er wird auch telefonieren, vielleicht auch mal Besucher empfangen. Selbst der umsichtigste Kriminelle kann Privates und Geschäftliches nicht immer trennen, wie Keller weiß.
Ich auch nicht, gesteht er sich ein.
Er belügt Ernie und Shag.
Neuerdings gehen sie zu dritt joggen, angeblich, um fit zu bleiben, in Wirklichkeit, um Dinge zu bereden, die sie im Büro nicht bereden können. Es ist schwer, ein bewegtes Ziel zu belauschen, besonders auf den großen Plätzen der Altstadt von Guadalajara, also steigen sie jeden Tag vor dem Lunch in ihre Sportsachen und drehen eine Runde.
»Ich habe einen VI«, erzählt ihnen Keller - einen vertraulichen Informanten.
Dass er sie belügt, macht ihm ein wenig zu schaffen, aber es dient ihrem eigenen Schutz. Wenn diese Sache schiefläuft, und das ist fast zu erwarten, will er alles auf die eigene Kappe nehmen. Seine Jungs dürfen nicht erfahren, dass er illegale Abhörmethoden einsetzt, denn laut Vorschrift sind sie verpflichtet, solche Verstöße zu melden. Und eine Verletzung der Meldepflicht könnte ihre Karriere zerstören. Er weiß, dass sie ihn niemals verpfeifen würden, also erfindet er einen VI.
Einen imaginären Freund, denkt Keller. Das passt ja auch ins Bild. Ein nichtexistentes Drogenkartell, nichtexistentes Kokain, eine nichtexistente Quelle und so weiter ...
»Ist ja toll«, sagt Ernie. »Wer-«
»Sorry«, sagt Keller. »Ich bin noch ganz am Anfang. Wir daten nur.«
Sie nicken verständig. Ein Informant muss umworben werden wie eine Frau. Man arbeitet mit Flirt, Versuchung, Verführung. Man kauft ihm Geschenke, erzählt ihm, wie sehr man ihn braucht, dass man ohne ihn nicht leben kann. Und wenn man ihn tatsächlich ins Bett kriegt, erzählt man es keinem - erst recht nicht den Jungs, mit denen man joggen geht.
Zumindest nicht, bevor die Sache perfekt ist. Und wenn es sich allgemein herumspricht, ist es sowieso meist vorbei.
Kellers Arbeitstag sieht jetzt so aus: Er sitzt seine Stunden im Büro ab, fährt nach Hause, verlässt das Haus in der Nacht, holt die tägliche Bandaufzeichnung und wertet sie in seinem Arbeitszimmer aus.
Und das zwei Wochen lang ohne Erfolg.
Was er zu hören bekommt, ist Liebesgeflüster und handfester Sex-Talk, während Tío seine junge Geliebte in die tieferen Geheimnisse des Eros einführt. Keller spult das meiste weg, der flüchtige Eindruck reicht ihm.
Pilar Talavera ist Tíos gelehrige Schülerin, während er ihre Liebeskunst um einige interessante Kniffe bereichert. Interessant sind die allerdings nur, wenn man auf so etwas steht, was Keller nicht von sich behaupten kann. Ihm wird eher übel dabei.
Du warst ein böses, böses Mädchen. Wirklich?
]a. Und deshalb muss ich dich bestrafen.
Das ist nun mal die Crux der Abhörerei - man erfährt unendlich viel, nur das nicht, was man wissen wollte.
Doch ab und zu findet sich ein Diamant im Misthaufen.
Eines Nachts legt Keller zu Hause die Kassette ein, macht es sich bei einem Scotch gemütlich und spult sich durch das widerwärtige Gewäsch, als er plötzlich hört, wie Tío die Lieferung von »dreihundert Brautkleidern« an eine Adresse in Chula Vista bestätigt. Chula Vista liegt in Kalifornien, auf halbem Wege zwischen Tijuana und San Diego.
jetzt hast du deinen Treffer, denkt Keller. Aber was fängst du damit an? Die Vorschriften verlangen, dass du deine mexikanischen Kollegen informierst, gleichzeitig das DEA-Büro in Mexico City, das die Meldung an das Büro in San Diego weiterleitet. Wenn ich die Sache aber an meine mexikanischen Kollegen melde, weiß Tío sofort Bescheid, und wenn ich sie an Tim Taylor melde, wird er nur die offizielle Version wiederkäuen, dass es in Mexiko keine »Brautkleider« gibt. Und er wird mich nach meiner Quelle fragen.
Die ich ihm nicht verraten kann.
Sie sprechen die Sache beim Joggen durch.
»Jetzt sind wir angeschmiert«, meint Ernie.
»Nein, sind wir nicht«, antwortet Keller.
Es wird Zeit für den nächsten Schritt - den nächsten Schritt in Richtung Abgrund.
Nach dem Lunch geht er hinaus zur Telefonzelle. In den Staaten, denkt er, sind es die Ganoven, die zur Telefonzelle gehen, um nicht angezapft zu werden, hier sind es die Polizisten.
Er ruft einen Bekannten beim Drogendezernat von San Diego an. Er heißt Russ Dantzler, und sie kennen sich von einer DEA-Konferenz, die ein paar Monate zurückliegt. Kam ihm vernünftig vor, der Mann. Ein Macher.
Genau, so einen brauche ich jetzt. Einen Macher.
Einen, der die Puppen tanzen lässt.
»Russ? Hier Art Keller, DEA. Wir haben ein paar Bier zusammen getrunken, wann war das, im Juli?«
Dantzler erinnert sich. »Was gibt's, Art?«
Keller erzählt ihm von den Brautkleidern.
»Das könnte eine Fehlanzeige sein«, sagt er, »aber ich glaube nicht. Vielleicht sollte man dem nachgehen.«
Ja, zum Teufel, das sollte man. Und keiner kann einen daran hindern. Nicht der Justizminister der Vereinigten Staaten, nicht das Außenministerium, erst recht nicht die Regierung. Die von der Bundespolizei werden sich über die Polizei von San Diego ereifern, und die Polizei von San Diego wird ihnen sagen, sie können sich selber ficken, aber mit einem recht kantigen Gegenstand.
Unter angemessener Berücksichtigung der Polizeietikette fragt Dantzler: »Was erwartest du nun von mir?«
»Dass du mich heraushältst, aber mit Infos versorgst. Du vergisst, dass ich dir den Tip gegeben habe, aber nicht, mich immer zu informieren.«
»Abgemacht«, sagt Dantzler. »Aber ich brauche einen belastbaren Zeugen. Das nur für den Fall, dass du vergessen hast, wie es in einer Demokratie läuft, die die Bürgerrechte schützt.«
»Ich habe einen VI«, lügt Keller.
»Alles klar.«
Mehr muss nicht gesagt werden. Dantzler gibt die Info an einen seiner Männer, der sie einem seiner Vis weitererzählt, der sie dann brühwarm an Dantzler berichtet, der damit zum Haftrichter geht - und schon wird die Sache plausibel.
Am nächsten Tag ruft Dantzler zur verabredeten Zeit in der Telefonzelle an. »Dreihundert Pfund Kokain!«, krächzt es aus dem Hörer. »Ein Marktwert von sechs Millionen Dollar! Das ist dein Verdienst, Keller!«
»Vergiss, dass du den Tip von mir hast«, sagt Keller. »Aber nicht, dass ich was bei dir guthabe.«
Zwei Wochen später hat er auch was bei der Polizei von El Paso gut, weil sie einen Lkw-Anhänger mit Kokain beschlagnahmt haben. Wieder einen Monat später meldet sich Keller bei Russ Dantzler und gibt ihm einen weiteren Hinweis - auf ein Haus in Lemon Grove.
Die anschließende Razzia bringt die magere Ausbeute von fünfzig Pfund Kokain.
Plus vier Millionen Dollar in Scheinen, drei Geldzählmaschinen und bergeweise interessante Beweismittel wie zum Beispiel Kontoauszüge. Die Kontoauszüge sind so interessant, dass der Bundesrichter, bei dem Dantzler sie abliefert, sofort weitere fünfzehn Millionen Dollar einfriert, die unter verschiedenen Namen bei fünf Banken in San Diego County deponiert sind. Obwohl keins dieser Konten auf Miguel Ángel Barrera lautet, gehört jeder Penny entweder ihm oder seinen Kartellmitgliedern, die ihn dafür bezahlen, dass er ihr Geld sicher anlegt.
Und den belauschten Telefongesprächen entnimmt Keller, dass sie alle nicht sehr glücklich sind.
Auch Tim Taylor nicht.
Der DEA-Chef hat ein Fax mit der Titelseite der San Diego Union-Tribune vor sich, auf der in Riesenlettern prangt: RIESIGER DROGENFUND IN LEMON GROVE - mit Hinweisen auf eine »federacion«. Und noch ein anderes Fax aus dem Büro des Justizministers mit der bohrenden Frage: Was zum Teufel geht da vor? Taylor hängt sich ans Telefon.
»Was zum Teufel geht da vor?«, brüllt er in den Hörer.
»Inwiefern?«, fragt Keller zurück.
»Verdammt noch mal, ich weiß genau, was Sie da treiben!«
»Dann verraten Sie's mir doch.«
»Sie haben einen VI! Sie verbreiten das über andere Dienststellen, und dann geben Sie diesen Mist auch noch an die Presse!«
»Tue ich nicht«, antwortet Keller wahrheitsgemäß. Ich verbreite das über andere Dienststellen, damit die es an die Presse geben.
»Wer ist der VI?«
»Es gibt keinen VI«, erwidert Keller. »Ich habe nichts damit zu tun.«
Klar. Nur dass er drei Wochen später der Polizei von L. A. einen Tip gibt, der zur Beschlagnahme von zweihundert Pfund Kokain in Hacienda Heights führt. Die Polizei von Arizona stoppt auf der Interstate 10 einen Lkw mit dreihundert Pfund Kokain an Bord. Und die Polizei von Anaheim macht bei einer Hausdurchsuchung die stattliche Beute von zehn Millionen Dollar.
Alle leugnen sie, irgendwelche Informationen von Keller bekommen zu ha. <_n, aber sie wiederholen sein Evangelium: La Federacion, La Federación, La Federación - von Ewigkeit zu Ewigkeit, amen.
Selbst der DEA-Resident von Bogotá kommt zum Altar.
Eines Tages geht Shag ans Telefon, drückt den Hörer an die Brust und sagt zu Keller: »Der große Zampano persönlich. Von der vordersten Front des Drogenkriegs.«
Noch vor zwei Monaten hätte Chris Conti, der DEA-Resident in Kolumbien, seinen alten Freund Art Keller nicht mal mit der sprichwörtlichen Feuerzange angefasst. Aber jetzt scheint sogar er bekehrt zu sein.
»Keller«, sagt er, »ich bin da auf was gestoßen, was dich interessieren könnte.«
»Kommst du her?«, fragt Keller, »oder soll ich zu dir kommen?«
»Treffen wir uns doch einfach in der Mitte. Warst du in letzter Zeit in Costa Rica?«
Mit anderen Worten, keiner soll mitkriegen, dass er sich mit Art Keller trifft, vor allem Tim Taylor nicht. Sie treffen sich in Quepos. Setzen sich in eine Palmhütte am Strand. Und Conti bringt Geschenke mit - breitet eine Reihe von Kontoauszügen auf dem Brettertisch aus. Die Belege passen zu den Auszahlungsquittungen der Bank of Amerika in San Diego, die bei der letzten Razzia beschlagnahmt wurden, und beweisen hieb- und stichfest, dass Barreras Federación mit kolumbianischem Kokain handelt.
»Wo hast du die her?«, fragt Keller.
»Aus Kleinstadtbanken in der Gegend von Medellin.«
»Ich danke dir sehr, Chris.«
»Von mir hast du die nicht.«
»Natürlich nicht.«
Conti legt ein unscharfes Foto auf den Tisch.
Eine Landebahn im Dschungel, mehrere Männer vor einer DC-4 mit der Nummer N-3423VX. Den einen identifiziert Keller sofort als Ramón Mette, ein anderer kommt ihm irgendwie bekannt vor. Mittleres Alter, Bürstenschnitt, glänzende schwarze Springerstiefel.
Das muss lange her sein.
Sehr lange.
Vietnam. Operation Phoenix.
Schon damals liebte Sal Scachi schwarze Stiefel.
»Denkst du, was ich denke?«, fragt Conti.
Also wenn du denkst, dass dieser Mann nach CIA aussieht, dann liegst du richtig. Als ich das letzte Mal von ihm gehört habe, war Scachi Oberst bei den Special Forces, dann ist er ausgestiegen. Die typische CIA-Karriere.
»Hör zu«, sagt Conti. »Ich hab da ein paar Gerüchte gehört.«
»Gerüchte sind mein Geschäft. Red weiter.«
»Drei Funktürme im Dschungel nördlich von Bogota«, sagt Conti. »Ich komme nicht in die Gegend, um das nachzuprüfen.«
»Das Medellin-Kartell ist ohne weiteres in der Lage, so etwas zu bauen«, sagt Keller. Das würde auch erklären, warum die SETCO-Flugzeuge nicht vom Radar erfasst werden. Drei Funktürme mit VOR-Signalen bilden eine eigene Flugleiteinrichtung.
»Technisch ist das machbar«, sagte Conti. »Aber haben sie auch die Möglichkeit, die Türme unsichtbar zu machen?«
»Wie meinst du das?«
»Satellitenfotos.«
»Okay.«
»Die Türme sind nicht zu finden. Nicht drei, nicht zwei, nicht einer. Wir können Nummernschilder entziffern auf diesen Fotos, Keller. Und ein VOR-Turm soll nicht zu sehen sein? Dann die Flugzeuge. Ich kriege die AWACS-Protokolle, aber die geben nichts her. Jedes Flugzeug von Kolumbien nach Honduras muss Nicaragua überfliegen, Sandinistengebiet. Und das, mein Freund, haben wir voll im Blick.«
Wohl wahr, denkt Keller. Nicaragua, ein kommunistisches Regime ganz nach dem Geschmack der Monroe-Doktrin, liegt im Fadenkreuz der Reagan'schen Mittelamerika-Politik. Die Contras, von der US-Regierung unterstützt, haben Nicaragua von Honduras und Costa Rica her in die Zange genommen, aber dann hat der Kongress beschlossen, ihnen die Militärhilfe zu streichen.
Und jetzt steht da ein ehemaliger Oberst der Special Forces und fanatischer Antikommunist (»Zur Hölle mit diesen Atheisten!«) zusammen mit Ramón Mette Ballasteros vor einem SET-CO-Flugzeug.
Als Keller aus Costa Rica abreist, ist er noch mehr mit den Nerven fertig als vorher.
Wieder in Guadalajara, schickt er Shag Wallace auf Missionsfahrt in die Staaten. Shag beehrt alle Drogendezernate und DEA-Büros des Südwestens mit seinem Besuch und erzählt ihnen mit seiner sanften Cowboystimme: »Das mit Mexiko ist kein Quatsch. Erzählt mir nicht, ihr hattet keine Ahnung, wenn die Bombe platzt. Und das wird sie unter Garantie. Pro forma könnt ihr ja die offizielle Linie weiterfahren, aber ich rate euch, lieber mit uns mitzuziehen, denn wenn die Trompeten blasen, Amigos, trennen wir die Böcke von den Schafen.«
Und den Jungs in Washington sind die Hände gebunden. Was sollen sie auch machen? Die Polizei anweisen, auf amerikanischem Boden keine Drogen mehr zu beschlagnahmen? Das Justizministerium würde Keller am liebsten kreuzigen. Sie vermuten, dass er diese Nachrichten verbreitet, aber sie können ihm nichts anhaben, obwohl das Außenministerium laut über »eine irreparable Beschädigung der Beziehungen zu einem wichtigen Nachbarn« zetert.
Die Bundesanwaltschaft möchte Art Keller am liebsten mit der Peitsche durch die Pennsylvania Avenue treiben und auf dem Capitol Hill ans Kreuz nageln, nur haben sie leider keine Beweise. Sie können ihn auch nicht aus Guadalajara abziehen, weil sich inzwischen die Medien für La Federación interessieren. Wie sähe das denn aus?
Also schauen sie mit wachsendem Verdruss zu, wie Art Keller ein ganzes Imperium auf den Enthüllungen des unsichtbaren, nichtexistenten CI-D0243 errichtet.
»CI-D0243 klingt ziemlich unpersönlich, findet ihr nicht?«, sagt Shag eines Tages. »Ich meine, für einen Kerl, der uns so viele Informationen liefert.«
»Wie willst du ihn denn nennen?«, fragt Keller.
»Deep Throat«, schlägt Ernie vor.
»Der Name ist besetzt«, sagt Keller. »Aber er ist eine Art mexikanischer Deep Throat.«
»Chupar«, sagt Ernie. »Nennen wir ihn Chupar.« Chupar wie Blowjob.
Wegen der Quelle Chupar hat Keller bei den Drogenfahndern an der Grenze einen Riesenstein im Brett. Sie leugnen zwar, dass sie die Tips von ihm bekommen, aber sie sind ihm sehr dankbar. Dankbar? Unsinn. Sie lieben ihn. Die DEA ist auf Informationen aus dem Hinterland angewiesen. Und wenn sie die haben wollen, legen sie sich besser nicht mit Art Keller an.
Nein, auch Art Keller wird zusehends intocable.
Aber nur scheinbar.
In Wirklichkeit ist es extrem aufreibend, eine Operation gegen Tío durchzuziehen, die angeblich gar nicht stattfindet. Spätnachts Haus und Familie zu verlassen, sein Tun geheim zu halten, seine alte Verbundenheit mit Tío zu verraten - bis Tío ihn überführt und daran erinnert, dass er ihn zu seinem Neffen erklärt hat.
Tío und sobrino.
Keller leidet unter Appetitlosigkeit, er findet keinen Schlaf.
Mit Althea schläft er kaum noch. Sie wirft ihm vor, er sei gereizt, geheimnistuerisch, verschlossen.
Unantastbar, sagt sich Keller, der um vier Uhr morgens auf dem Rand der Badewanne sitzt. Er hat soeben das mexikanische Hühnchen ausgekotzt, das ihm Althea im Kühlschrank kaltgestellt hat. Nein, die Katastrophe holt dich nicht ein, du marschierst geradewegs drauf zu. Unaufhaltsam, Schritt für Schritt, in Richtung Abgrund.
Nachts liegt Tío wach und grübelt darüber nach, wer der soplón sein könnte - der Informant. Die patrones der Federación - Ábrego, Méndez, el Verde - beschweren sich lautstark und setzen ihn gewaltig unter Druck, damit er etwas unternimmt.
Denn die undichte Stelle befindet sich eindeutig in Guadalajara. Weil alle drei Regionen betroffen sind. Ábrego, Méndez und el Verde sind überzeugt, dass es im Umkreis von M-i einen soplón geben muss.
Spür ihn auf, sagen sie. Bring ihn zur Strecke. Mach was.
Sonst machen wir's.
Neben ihm, gleichmäßig atmend, schläft Pilar Talavera. Er blickt hinab auf ihr glänzendes schwarzes Haar, ihre langen schwarzen Wimpern, die jetzt geschlossen sind, ihre volle Oberlippe mit den winzigen Schweißtröpfchen. Er liebt ihren jungen, frischen Duft.
Auf dem Nachttisch liegen die Zigarren. Er nimmt eine und zündet sie an. Der Rauch wird sie nicht wecken, er hat sie daran gewöhnt. Und nach dem, was wir diese Nacht getrieben haben, gibt es nichts, was sie wecken könnte. Wie seltsam, sich in seinem Alter zu verlieben. Wie seltsam und wie wunderbar. Sie ist mein Glück, denkt er, la sonrisa de mi corazón - das Lächeln meines Herzens. Ein Jahr noch, und sie ist meine Frau. Eine schnelle Scheidung, eine noch schnellere Hochzeit.
Und die Kirche? Die Kirche ist käuflich. Ich verspreche dem Kardinal ein Krankenhaus, eine Schule, ein Waisenhaus. Und dann heiraten wir in der Kathedrale.
Nein, die Kirche ist nicht das Problem.
Aber der Informant.
Die verfluchte »Quelle Chupar«.
Kostet mich Millionen.
Schlimmer noch, sie macht mich angreifbar.
Ich höre förmlich, wie Ábrego, der eifersüchtige alte Fuchs, gegen mich hetzt: M-i kriegt die Dinge nicht in den Griff. Er kassiert Unsummen für einen Schutz, den er uns nicht bieten kann. Er hat einen Verräter unter seinen Leuten.
Ábrego will sich die ganze Federación unter den Nagel reißen. Wann fühlt er sich stark genug? Kommt er selbst, oder schickt er andere vor?
Nein, denkt er, sie werden sich alle gegen mich verbünden, wenn ich den Verräter nicht finde.
Kurz vor Weihnachten geht es los.
Die Kinder haben lange gebettelt, sie wollen unbedingt den großen Weihnachtsbaum in der Altstadt sehen. Keller hatte gehofft, sie würden sich mit den posadas zufriedengeben, den abendlichen Umzügen im Tlaquepaque-Viertel, bei denen die Kinder, verkleidet als Maria und Josef, von Haus zu Haus ziehen und um Herberge bitten. Aber die Prozessionen machen seine Kinder nur noch neugieriger auf den Weihnachtsbaum und auf die pastorelas, die heiter-burlesken Krippenspiele, die vor der Kathedrale veranstaltet werden.
Doch ihm ist nicht nach Heiterkeit. Er hat gerade ein Gespräch von Tío abgehört, es geht um achthundert Kilo Kokain, verpackt in achthundert Geschenkkartons, mit Weihnachtspapier, Schleifen und allem, was dazugehört.
Weihnachtsgeschenke im Wert von dreißig Millionen Dollar, gut versteckt in Arizona, und Keller hat noch nicht entschieden, wen er mit seiner Nachricht beglückt.
Aber er weiß, dass er seine Familie vernachlässigt, also fährt er am Samstag vor dem Fest mit Althea, den Kindern, der Köchin Josefina und dem Kindermädchen Guadelupe zum Einkaufsbummel auf den Weihnachtsmarkt der Altstadt.
Und muss zugeben, dass es ihm gewaltige Freude macht. Sie kaufen Geschenke und handgemachten Christbaumschmuck für den Baum zu Hause, anschließend gehen sie ganz groß essen - frisch aufgeschnittene carnitas und schwarze Bohnen, zum Nachtisch mit Honig gesüßte sopaipillas.
Dann sieht Cassie eine der herausgeputzten Pferdekutschen vorbeirollen, schwarz lackiert mit roten Samtkissen, und mit so einer Kutsche muss sie unbedingt fahren. Bitte, Daddy, bitte! Keller handelt mit dem Kutscher in Gauchokluft den Preis aus, alle steigen ein und kriechen unter die Decke. Michael, der auf Daddys Schoß sitzt, schläft beim eintönigen Hufeklappern sofort ein, aber nicht Cassie. Sie ist außer sich vor Begeisterung, bestaunt die Schimmel mit dem reich verzierten Riemenzeug und den roten Federbüschen, dann den zwanzig Meter hohen Weihnachtsbaum in seinem Lichterglanz, und Keller, der den Atem seines Sohns an der Brust spürt, weiß, dass er glücklicher ist, als er es sein dürfte.
Es ist schon dunkel, als die Fahrt endet, behutsam weckt er Michael und gibt ihn in Josefinas Obhut. Sie laufen über die Plaza Tapatia Richtung Kathedrale, zu der kleinen Bühne, wo gleich das Krippenspiel beginnt.
Da entdeckt er Adán Barrera.
Seinen alten Boxkumpan. Er sieht ein wenig mitgenommen aus in seinem zerknitterten Anzug, als hätte er eine lange Reise hinter sich. Adán gibt Keller ein Zeichen und geht zu einer öffentlichen Toilette am Rand der Plaza.
»Ich muss mal verschwinden«, sagt Keller. »Michael, du auch?«
Sag nein, Kind, sag nein.
»Ich war schon, im Restaurant.«
»Geht weiter zur Bühne«, sagt Keller. »Ich komme nach.«
Adán lehnt an der Wand, als Keller den Toilettenraum betritt. Keller will prüfen, ob die Abteile leer sind, doch Adán sagt: »Ich hab schon nachgesehen. Und es kommt keiner rein. Lange nicht gesehen, Arturo.«
»Was willst du von mir?«
»Wir wissen, dass du's bist.«
»Wovon redest du?«
»Spiel nicht den Ahnungslosen. Beantworte mir nur eine Frage - Kannst du mir sagen, was das soll?«
»Ich mache nur meinen Job. Nimm's nicht persönlich.«
»Es ist aber sehr persönlich«, sagt Adán. »Wenn ein Mann seine Freunde verrät, ist das verdammt noch mal sehr persönlich !«
»Wir sind keine Freunde mehr.«
»Mein Onkel bedauert das sehr.« Keller zuckt die Schultern.
»Du hast ihn Tío genannt«, sagt Adán. »So wie ich auch.«
»Das war einmal«, sagt Keller. »Die Zeiten ändern sich.«
»So etwas nicht«, sagt Adán. »Das gilt für immer. Du hast seinen Schutz beansprucht, seinen Rat, seine Hilfe. Er hat dich zu dem gemacht, was du bist.«
»Wir uns beide gegenseitig.«
Adán schüttelt den Kopf. »Da erwartet man nun Loyalität. Oder Dankbarkeit.«
Er greift in seine Brusttasche, und Keller macht einen Schritt auf ihn zu, um sicherzugehen, dass er nicht die Pistole zieht.
»Keine Sorge«, sagt Adán. Er holt einen Umschlag heraus und legt ihn auf den Rand eines Waschbeckens. »Das sind hunderttausend US-Dollar, in bar. Aber wenn du möchtest, können wir das Geld auf den Caymans deponieren. Oder in Costa Rica ...«
»Ich bin nicht käuflich.«
»Wirklich nicht? Das wäre neu.«
Keller packt zu, drückt ihn gegen die Wand und tastet ihn ab. »Bist du verdrahtet, Adán? Willst du mich in die Falle locken? Wo sind die verdammten Kameras?«
Keller lässt ihn los und sieht sich um. Schaut in alle Ecken, in die Kabinen, unter die Waschbecken. Nichts zu finden. Erschöpft gibt er die Suche auf und lehnt sich an die Wand.
»Hunderttausend sofort, als vertrauensbildende Maßnahme«, sagt Adán. »Weitere hunderttausend für den Namen deines Informanten. Dann zwanzigtausend pro Monat fürs Nichtstun.«
Keller schüttelt den Kopf.
»Ich hab Tío prophezeit, dass du ablehnst. Möchtest lieber mit anderer Münze bezahlt werden. Okay. Wir schenken dir so viele Marihuana-Fahndungserfolge, dass du wieder zum Star wirst. Das wäre Plan A.«
»Was ist Plan B?«
Adán geht auf Keller zu, zieht ihn an sich, sagt ihm leise ins Ohr: »Arturo, du bist ein undankbarer, sturer, Möchtegern-Yankee. Aber du bist immer noch mein Freund, und ich liebe dich. Also nimm das Geld oder lass es, aber halt dich aus der Sache raus. Du ahnst nicht, auf was du dich einlässt.«
Adán wendet ihm das Gesicht zu, so dass sich ihre Nasen fast berühren, er blickt ihm tief in die Augen und wiederholt: »DU ahnst nicht, auf was du dich einlässt.«
Darauf lässt er ihn los, nimmt den Umschlag und hält ihn in die Höhe. »Nein?«
Keller schüttelt den Kopf. Schulterzuckend steckt Adán den Umschlag ein. »Arturo?« sagt er. »Frag lieber nicht nach Plan B.«
Und damit geht er hinaus.
Keller dreht den Wasserhahn auf und spritzt sich kaltes Wasser ins Gesicht. Dann trocknet er sich ab und geht seine Familie suchen.
Sie stehen am Rand einer spärlichen Zuschauermenge, die Kinder hüpfen auf und ab vor Freude über die Kapriolen der beiden Darsteller, die als Erzengel Gabriel und Luzifer verkleidet sind und sich gegenseitig mit Stöcken auf den Kopf schlagen, weil sie um die Seele des Christkinds streiten.
Als sie das Parkhaus am Abend verlassen, setzt sich ein Ford Bronco in Bewegung und folgt ihnen. Die Kinder merken es nicht, natürlich, sie schlafen fest, auch Althea, Josefina und Guadelupe merken nichts. Aber Keller behält den Bronco im Auge. Er spielt ein wenig mit seinem Verfolger, versucht ihn abzuschütteln, aber der Bronco bleibt an ihm dran. Er macht keine Anstalten, sich zu verstecken, denkt Keller, also will er was von mir.
Als Keller in die Einfahrt biegt, fährt der Bronco vorbei, wendet und parkt auf der anderen Straßenseite, ein paar Häuser weiter.
Keller bringt die Familie hinein, dann sagt er, er habe etwas im Auto vergessen, geht wieder hinaus, läuft hinüber zum Bronco und klopft an die Scheibe.
Als sich die Scheibe senkt, beugt er sich hinein, drückt den Mann auf den Sitz, greift in seine Brusttasche und schnappt sich die Brieftasche. Er klappt die Brieftasche auf, sieht das Polizeiwappen von Jalisco und wirft sie zurück, dem Polisten auf den Schoß.
»Das ist meine Familie da drinnen«, sagt Keller. »Wenn du der Angst machst, wenn die auch nur ahnen, dass du hier draußen stehst, dann nehme ich dir deine pistola weg und schieb sie dir in den Arsch. Hast du mich verstanden, Bruder?«
»Ich mache nur meinen Job, Bruder.«
»Dann gib dir ein bisschen mehr Mühe.«
Aber Tíos Botschaft ist angekommen, denkt Keller, als er ins Haus zurückgeht - seine Freunde verrät man nicht.
Nach einer so gut wie schlaflosen Nacht kocht sich Keller eine Tasse Kaffee und wartet, bis die Familie wach wird. Dann macht er den Kindern Frühstück, gibt Althea einen Abschiedskuss und fährt ins Büro.
Auf dem Weg dorthin hält er an einer Telefonzelle, um beruflichen Selbstmord zu begehen - er ruft den Sheriff von Pierce County, Arizona an. »Fröhliche Weihnachten«, sagt er und erzählt von den achthundert Geschenkpackungen mit Kokain. Dann fährt er weiter und wartet im Büro auf seinen Anruf.
Als Althea am nächsten Vormittag vom Einkaufen nach Hause fährt, wird sie von einem seltsamen Auto verfolgt. Der Fahrer macht kein Hehl aus seiner Absicht, fährt einfach hinter ihr her und bleibt immer dicht dran. Sie weiß nicht, wie sie reagieren soll, hat Angst, nach Hause zu fahren, und traut sich auch nicht woandershin, also schlägt sie den Weg zum Büro der DEA ein. Sie ist völlig verschreckt - die beiden Kinder sitzen hinter ihr -, und kurz vorm Büro wird sie von dem Auto gestoppt. Vier bewaffnete Männer steigen aus.
Der Anführer zückt das Abzeichen der Provinzpolizei.
»Können Sie sich ausweisen, Señora Keller?«
Mit zitternder Hand kramt sie nach dem Führerschein. Währenddessen beugt sich der Mann durchs Fenster. »Nette Kinder«, sagt er.
»Danke«, erwidert sie und ärgert sich auch schon darüber. Sie reicht dem Mann den Führerschein. »Haben Sie einen Pass?«
»Zu Hause.«
»Sie sind verpflichtet, ihn bei sich zu tragen.«
»Ich weiß, aber wir wohnen hier schon lange, und ich -«
»Vielleicht zu lange«, erwidert der Mann. »Sie müssen leider mitkommen.«
»Aber ich habe meine Kinder bei mir.«
»Das sehe ich selbst, Señora. Trotzdem müssen Sie mitkommen.«
Jetzt ist Althea den Tränen nahe. »Was soll ich denn mit meinen Kinder machen?«
Der Polizist befiehlt ihr zu warten und geht zu seinem Auto. Lange Minuten sitzt Althea da und versucht, sich zu beruhigen. Sie kämpft gegen die Versuchung, in den Rückspiegel zu schauen, gegen den Impuls, einfach auszusteigen und mit den Kindern zu Fuß weiterzugehen. Endlich kommt der Polizist zurück, beugt sich durchs Fenster und sagt mit ausgesuchter Höflichkeit: »In Mexiko genießt die Familie einen hohen Stellenwert. Guten Tag.«
Keller bekommt seinen Anruf.
Es ist Tim Taylor. Ihm seien da Dinge zu Ohren gekommen, die müsse er jetzt klären.
Taylor bellt immer noch in den Hörer, als die Schüsse krachen.
PlanB.
Erst hören sie ein Auto, das sich mit Vollgas nähert, dann das Geknatter aus mehreren Kalaschnikows. Keller, Ernie und Shag werfen sich zu Boden, ducken sich hinter die Schreibtische. Nach ein paar Minuten gehen sie hinaus und sehen nach Kellers Auto. Der Ford Taurus hat keine Scheiben mehr, die Reifen sind platt, die Fahrerseite ist von ein paar Dutzend Einschusslöchern geziert.
»Den Listenpreis zahlt dir jetzt keiner mehr«, sagt Shag.
Es dauert keine Minute, und die Federales sind da.
Wenn sie nicht schon vorher da waren, denkt Keller.
Sie nehmen ihn mit aufs Revier, wo ihn Oberst Vega schon erwartet, mit tiefbesorgtem Blick.
»Danken Sie Gott, dass Sie nicht in dem Fahrzeug saßen«, sagt er. »Ich frage mich, wer so etwas tut. Haben Sie irgendwelche Feinde in der Stadt, Señor Keller?«
»Sie wissen verdammt gut, wer das war«, zischt ihn Keller an. »Ihr Musterknabe, Barrera.«
Vega starrt ihn ungläubig an. »Miguel Angel Barrera? Warum sollte er so etwas tun? Sie sagten mir doch selbst, dass Sie nicht gegen Don Miguel ermitteln.«
Vega hält ihn dreieinhalb Stunden im Verhörzimmer fest und fragt ihn nach seinen Ermittlungen aus - unter dem Vorwand, ein Motiv für den Überfall zu suchen.
Ernie hat schon Angst, dass sie Keller gleich dabehalten. Er pflanzt sich im Vorraum auf und will nicht eher gehen, bis sein Boss aus einer der Türen kommt. Während Ernie also ausharrt, fährt Shag zu Althea nach Hause und bringt ihr die Nachricht: »Keller ist unversehrt, aber ...«
Als Keller nach Hause kommt, findet er Althea im Schlafzimmer, beim Packen.
»Ich hab uns einen Flug gebucht«, sagt sie. »Nach San Diego, noch heute Abend. Wir wohnen eine Weile bei meinen Eltern.«
»Wovon redest du überhaupt?«
»Art, ich habe Angst«, sagt sie und erzählt ihm von der Passkontrolle und wie ihr zumute war, als sie hörte, dass sein Auto zerschossen und er aufs Revier der Federales mitgenommen wurde. »So eine Angst hatte ich noch nie, Art. Ich will raus aus Mexiko.«
»Deine Angst ist unbegründet.«
Sie blickt ihn an, als wäre er nicht bei Trost. »Die haben dein Auto kaputtgeschossen, Art.«
»Sie wussten, dass ich nicht drinsaß.«
»Und wenn sie das Haus in die Luft sprengen, wissen sie dann, dass ich und die Kinder nicht da sind?«
»Den Familien tun sie nichts.«
»Ach ja? Ist das eine Art Gesetz?«
»Ja, eine Art Gesetz«, sagt er. »Jedenfalls bin ich es, hinter dem sie her sind. Eine persönliche Geschichte.«
»Eine persönliche Geschichte? Was meinst du damit?«
Als sie nach etwa dreißig Sekunden noch immer keine Antwort hat, wiederholt sie: »Art, was meinst du damit?«
Er schiebt sie in den Sessel und erzählt ihr von seiner alten Bekanntschaft mit Tío und Adán Barrera. Erzählt ihr von dem Hinterhalt in Badiraguato, der Erschießung von sechs Gefangenen und seinem langen Schweigen dazu. Dass sein Schweigen Tío geholfen hat, die Federación aufzubauen, die nun die amerikanischen Großstädte mit Crack überschwemmt, und dass es jetzt an ihm ist, etwas dagegen zu unternehmen.
Sie schaut ihn ungläubig an. »Das lastet alles auf deinen Schultern?«
Er nickt.
»Dann musst du ja unglaubliche Kräfte haben, Art«, sagt sie. »Was hättest du denn damals machen sollen? Es war nicht deine Schuld. Du konntest nicht wissen, was Barrera vorhatte.«
»Halb hab ich es gewusst«, sagt Keller. »Ich wollte es nur nicht wahrhaben.«
»Und jetzt glaubst du, du musst das wiedergutmachen? Indem du Barrera zur Strecke bringst? Selbst wenn du dafür mit dem Leben bezahlst?«
»Etwa so.«
Sie steht auf und geht ins Bad. Ihm erscheint es wie eine Ewigkeit, aber es sind nur ein paar Minuten, bis sie wieder herauskommt, seinen Koffer aus der Kammer holt und aufs Bett wirft. »Fahr mit uns.«
»Das kann ich nicht.«
»Dein Kreuzzug ist dir wichtiger als deine Familie?«
»Nichts ist mir wichtiger als meine Familie.«
»Dann beweise es«, sagt sie. »Komm mit.«
»Althea -«
»Wenn du hierbleiben und High Noon spielen willst, na gut. Aber wenn du deine Familie zusammenhalten willst, dann fang an zu packen. Sachen für ein paar Tage. Tim Taylor hat versprochen, dass alles andere eingepackt und nachgeschickt wird.«
»Du hast mit Tim Taylor gesprochen?«
»Er hat hier angerufen«, sagt sie. »Und das war immerhin mehr, als du getan hast.«
»Ich war zur Vernehmung!«
»Du meinst also, da kann ich ja beruhigt sein?«
»Verdammt noch mal, Althie! Was willst du überhaupt?«
»Ich will, dass du mitkommst.«
»Ich kann nicht!«
Er sitzt auf der Bettkante, neben sich den leeren Koffer wie zum Beweis, dass er seine Familie nicht liebt. Er liebt seine Familie - tief und innig -, aber er kann trotzdem nicht tun, was sie von ihm erwartet.
Warum nicht?, fragt er sich. Hat Althea recht? Hänge ich an diesem Kreuzzug mehr als an meiner Familie?
»Verstehst du denn nicht?«, sagt sie. »Es geht nicht um diese Barreras. Es geht um dich. Dass du nicht fähig bist, dir selbst zu verzeihen. Es sind nicht sie, die du unbedingt bestrafen willst. Das bist du selbst!«
»Besten Dank für die Küchentherapie.«
»Fick dich selbst, Art.« Sie lässt ihre Kofferschlösser zuschnappen. »Ich hab ein Taxi gerufen.«
»Ich bringe euch wenigstens zum Flughafen.«
»Nur wenn du mit ins Flugzeug steigst. So kann ich das den Kindern nicht zumuten.«
Er nimmt ihre Tasche und trägt sie nach unten. Wartet dort mit der Tasche in der Hand, während sie sich von Josefina verabschiedet, unter Tränen und Umarmungen. Er hockt sich neben Cassie und Michael und nimmt sie in die Arme. Michael versteht noch nicht, was passiert, aber Keller spürt Cassies warme Tränen auf der Wange.
»Warum kommst du nicht mit, Daddy?«, fragt sie.
»Ich hab hier noch zu tun«, sagt Keller. »Es dauert nicht lange, dann komme ich nach.«
»Aber ich will, dass du mitkommst!«
»Bei Grandpa und Grandma werdet ihr viel Spaß haben«, sagt er.
Draußen hupt es, er trägt das Gepäck hinaus.
Auf der Straße herrscht Hochbetrieb, es findet gerade eine posada statt, verkleidete Kinder ziehen vorbei, manche tragen mit Bändern und Blumen verzierte Stöcke und stampfen den Takt zur Musik einer kleinen Kapelle, die hinter der Prozession hermarschiert. Keller muss die Taschen über die Köpfe der Kinder hinweg an den Taxifahrer übergeben.
»Aeropuerto«, sagt er.
»Yo se«, antwortet der Fahrer und lädt das Gepäck ein.
Keller umarmt die Kinder noch einmal, gibt ihnen einen letzten Kuss und behält das Lächeln im Gesicht, bis er sich von ihnen verabschiedet hat. Althea steht wie verloren neben der Beifahrertür. Keller umarmt sie, will ihr auch einen Kuss geben, aber sie hält ihm nur die Wange hin.
»Ich liebe dich«, sagt er. »Pass auf dich auf, Art.«
Keller schaut ihnen nach, bis die Rücklichter im Straßenverkehr verschwunden sind. Dann bahnt er sich einen Weg durch die posada zurück zum Haus, hinter ihm wird gesungen.
Tretet ein ihr heiligen Pilger-
in diese bescheidene Hütte -
die Herberge ist ärmlich -
doch unsere Gabe kommt von Herzen -
Ein Stück weiter parkt immer noch der weiße Bronco. Keller will auf ihn zugehen und wirft fast einen kleinen Jungen um, der ihm die rituelle Frage stellt: »Haben Sie Raum in Ihrer Herberge, Senor?«
»Was?«
»Einen Platz zum Übernachten.«
»Nein, heute nicht.«
Er drängt sich durch bis zum Bronco und klopft an die Scheibe. Als sich die Scheibe gesenkt hat, packt er den Polizisten, zerrt ihn durchs Fenster heraus und versetzt ihm drei harte Schläge mit der Rechten, bevor er ihn fallen lässt. Er hält ihn am Kragen, schlägt immer weiter auf ihn ein und brüllt: »Ich hab euch gesagt, ihr sollt meine Familie in Ruhe lassen! Ich hab euch gesagt, ihr sollt meine Familie in Ruhe lassen!«
Zwei Männer aus der Nachbarschaft gehen dazwischen und halten ihn fest.
Er schüttelt sie ab und geht zurück zu seinem Haus. Im Gehen sieht er, dass der Polizist, der noch am Boden liegt, die Pistole zieht.
»Na los«, sagt Keller. »Schieß doch, du Arschloch.« Der Polizist senkt die Pistole.
Keller läuft durch die geschockte Menge und verschwindet in seinem Haus. Er trinkt zwei gut gefüllte Gläser Scotch und geht ins Bett.
Den Feiertag verbringt Keller bei Ernie und Teresa Hidalgo, nachdem er sich lange gegen die Einladung gesträubt hat. Er kommt zu spät, weil er nicht dabei sein will, wenn Ernesto jr. und Hugo ihre Geschenke auspacken, aber er kommt mit vollen Händen, und die Kinder, ohnehin schon völlig überdreht, toben herum und schreien: »Tio Arturo! Tío Arturo!«
Er tut, als würde ihm das Essen schmecken. Teresa hat sich die größte Mühe gegeben und einen traditionellen Truthahn zubereitet (traditionell für ihn, nicht für Mexiko), also verdrückt er eine Menge Truthahn mit Kartoffelbrei, worauf er wirklich keinen Appetit hat. Er besteht darauf, den Tisch abzuräumen, und in der Küche sagt Ernie zu ihm: »Boss, ich hab ein Angebot. Ich kann mich nach El Paso versetzen lassen.«
»Ach ja?«
»Ich will zusagen.«
»Okay.«
Ernie hat Tränen in den Augen. »Wegen Teresa. Sie hat Angst hier in Guadalajara. Um mich, um die Jungs.«
»Du schuldest mir keine Erklärung.«
»Doch.«
»Ich nehm's dir nicht übel.«
Tío hat die Hunde von der Leine gelassen, er schickt sie den DEA-Agenten auf den Hals. Seine Hunde, die Federales, haben das Büro durchsucht, nach Waffen, nach illegalen Abhörvorrichtungen, sogar nach Drogen. Unter den lächerlichsten Vorwänden stoppen sie die Agenten in ihren Autos, und das mehrmals täglich. Und Tíos Sicarios fahren nachts an ihren Häusern vorbei, parken auf der anderen Straßenseite, winken ihnen morgens zu, wenn sie die Zeitung hereinholen.
Keller kann gut verstehen, dass Ernie die Flucht ergreift. Wenn ich auf meine Familie verzichte, denkt er, heißt das nicht, dass auch er auf seine Familie verzichten muss. »Ich glaube, es ist richtig, was du tust«, sagt er.
»Tut mir leid, Boss.«
»Lass gut sein.«
Es folgt eine unbeholfene Umarmung.
Dann sagt Ernie: »Mein neuer Job fängt erst in einem Monat an. Bis dahin ...«
»Klar. Bis dahin richten wir noch ein bisschen Schaden an.«
Kurz nach dem Dessert verabschiedet sich Keller. In sein leeres Haus zurückzufahren, das hält er nicht aus. Er tourt ein bisschen durch die Gegend, bis er eine Bar findet, die noch geöffnet hat. Er setzt sich an den Tresen und bestellt zwei Drinks, danach hat er immer noch keine Lust, nach Hause zu fahren. Also fährt er zum Flughafen.
Steht mit dem Auto auf der Anhöhe über dem Rollfeld und verfolgt die Landung der SETCO-Maschine. Wie Santa Claus mit seinem Schlitten, sagt er sich. Und einem großen Sack voller guter Gaben für unsere lieben Kleinen.
Der Schnee würde für einen ganzen Minnesota-Winter reichen, sagt er sich. Und es kommt immer neuer Schnee nach. Mit dem Drogengeld könnte man die gesamten Staatsschulden bezahlen. Solange das mexikanische Trampolin funktioniert, jedenfalls. In mehreren Hüpfern kommt das Kokain aus Kolumbien über Honduras und Mexiko bis in die Staaten. Wird zu Crack verarbeitet und hüpft dann lustig durch die Straßen.
Die weiße DC-4 ist zum Stehen gekommen.
Dieses Kokain wird nicht von Börsenmaklern oder Starlets geschnupft. Dieses Kokain wird als Crack geraucht - wird für zehn Dollar pro Brocken an die armen Schlucker verkauft, meist Schwarze und Hispanics. Dieses Kokain geht nicht in die Wallstreet oder nach Hollywood, es geht nach Harlem und Watts, nach South Chicago und East L. A., nach Roxbury und ins Barrio Logan.
Keller hockt in seinem Auto und sieht den Federales dabei zu, wie sie das Kokain auf Lkw umladen. Der übliche Ablauf, denkt er, alles reibungslos und intocable, und er will schon losfahren, als er etwas Merkwürdiges beobachtet.
Die Federales haben die Fracht entladen, und jetzt laden sie Kisten in das Flugzeug ein. Eine Kiste nach der anderen verschwindet in der Ladeluke der DC-4.
Was zum Teufel geht dort vor?
Er schwenkt den Feldstecher und entdeckt Tío, der den Ladevorgang überwacht.
Was zum Teufel laden die in das Flugzeug?
Auf der Heimfahrt zerbricht er sich weiter den Kopf.
Okay, denkt er, sie haben Flugzeuge, die das Kokain aus Kolumbien holen. Die Flugzeuge unterlaufen die Luftüberwachung. Sie legen eine Zwischenlandung in Honduras ein und werden aufgetankt - unter Aufsicht von Ramón Mette, dessen Partner ein Exilkubaner und Schweinebucht-Teilnehmer ist.
Die Flüge gehen dann weiter nach Guadalajara, wo die Ladung unter Tíos Aufsicht in die Grenzregionen weitergeleitet wird - Golf von Mexiko, Sonora oder Baja. Von dort bringen die Schmuggler das Kokain über die Grenze und lagern es in Depots. Dann liefern sie es an die Kolumbianer - für tausend Dollar pro Kilo. Und wenn das gelaufen ist, erhält Tío seinen prozentualen Anteil.
So funktioniert das mexikanische Trampolin, denkt Keller. Das DEA-Büro in Honduras ist geschlossen, Mexiko will nichts unternehmen, Justizministerium und Außenministerium wollen nichts davon wissen. Nichts sehen, nichts hören - und um Gottes willen nichts sagen.
Okay, das ist nichts Neues.
Was ist hier anders?
Dass der Warenverkehr in beide Richtungen läuft. Jetzt wird auch etwas zurückgeliefert. Aber was?
Darüber zerbricht er sich den Kopf, während er die Tür aufschließt, sein leeres Haus betritt.
Und plötzlich den harten Pistolenlauf im Nacken spürt. »Nicht umdrehen.«
»Keine Sorge.« Ich bin doch nicht blöd. Mir reicht es schon, die Kanone zu spüren. Ich brauch sie nicht zu sehen.
»Da siehst du mal, wie leicht wir dich kriegen können, Keller«, sagt der Mann.
Amerikaner, denkt Keller. Ostküste. New York. Er riskiert einen Blick nach unten, aber er sieht nur die Schuhspitzen von dem Mann.
Schwarz - und spiegelblank poliert.
»Ich hab verstanden, Scachi«, sagt Keller.
Das betroffene Schweigen liefert ihm die Bestätigung.
»Das war saudumm von dir, Keller«, sagt Scachi.
Er drückt ab.
Keller hört das trockene, metallische Klicken. »Mein Gott«, sagt er. Seine Knie werden weich wie Gummi, der kalte Schweiß bricht ihm aus, sein Atem stockt. »Die nächste Kammer ist nicht leer, Keller.«
»Okay.«
»Lass die Finger von dem Scheiß«, sagt Scachi. »Du weißt nicht, auf was du dich da einlässt.«
Das hat mir Adán auch schon gesagt, denkt Keller. Mit den gleichen Worten.
»Hat dich Barrera geschickt?«
»Fragen kannst du stellen, wenn du mich vor der Flinte hast«, sagt Sal. »Ich kann dir nur raten, halt dich vom Flughafen fern. Das nächste Mal wird die Unterhaltung gestrichen, und du bist tot, von einer Sekunde auf die andere. Verstanden?«
»Ja.«
»Kerberos.«
»Was?«
»Nichts«, sagt Scachi. »Nicht umdrehen.«
Keller dreht sich nicht um, als er ihn gehen hört. Er bleibt stehen, wo er ist, eine volle Minute, bis draußen das Auto startet.
Dann setzt er sich hin und fängt an zu zittern. Er braucht ein paar Minuten und einen steifen Scotch, um sich wieder einzukriegen und einen klaren Gedanken zu fassen.
Halt dich vom Flughafen fern.
Was immer die verladen, denkt er, es macht sie sehr nervös, wenn ihnen einer dabei zusieht. Und was zum Teufel ist Kerberos?
Durchs Fenster sieht er, dass draußen schon wieder ein Polizist steht. Er geht ins Arbeitszimmer und ruft Ernie zu Hause an.
»Du musst mir ein Auto bringen. Fahr durch die Parallelstraße und parke ihn zwei Ecken weiter südwärts. Fahr mit dem Taxi zurück.«
Als es so weit ist, verlässt er das Haus durch die Küchentür, klettert über den Zaun aufs Nachbargrundstück und geht hinaus auf die Parallelstraße. Er findet das Auto dort, wo es sein soll, aber es gibt ein Problem.
Ernie sitzt noch drin.
»Du solltest doch mit dem Taxi zurückfahren«, sagt Keller und schlüpft neben ihn auf den Sitz. »Ich glaube, das hab ich nicht gehört.«
»Fahr nach Hause«, sagt Keller. Und als Ernie sich nicht vom Fleck rührt: »Hör zu, ich will dir dein Leben nicht auch noch versauen.«
»Wann erzählst du mir, was da läuft?«, fragt Ernie, während er aussteigt.
»Wenn ich selbst weiß, was da läuft.« Vielleicht also nie.
Keller rutscht auf den Fahrersitz und fährt zu Tíos Liebesnest.
Wenn sie mich nun schon erwarten?, fragt er sich auf dem Weg dorthin, wo er das Tonband auswechseln will. Ein kurzer Blick über die Mauer verrät ihm, dass noch Licht in Tíos Schlafzimmer ist. Er duckt sich über den Gully und stöpselt den Ohrhörer in den Rekorder ein, damit er hören kann, was gerade läuft.
Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand', sagt das Sprichwort. Keller ist gespannt.
»Hat es geklappt?«, fragt Tío.
»Ich weiß es nicht.« Scachis Spanisch ist ziemlich gut, es ist zweifelsfrei seine Stimme. »Aber ich glaube schon. Der Junge hatte ganz schön Schiss.«
Allerdings, denkt Keller. Wollen wir doch mal sehen, wie cool du bleibst, wenn dir einer die Kanone in den Nacken schiebt.
»Wusste er über Kerberos Bescheid?«
»Ich glaube nicht. Darauf hat er nicht reagiert.«
Bleib locker, denkt Keller. Ich hab nicht die geringste Ahnung.
Dann hört er Tío sagen: »Wir können kein Risiko eingehen. Den nächsten Tausch...«
Tausch?, denkt Keller. Welcher Tausch? »... machen wir in El Norte.« El Norte also. In den Staaten.
Wunderbar, denkt Keller. Nur zu, Tío.
Bring's über die Grenze.
Denn wenn du das machst...
... hole ich das Flugzeug vom Himmel.
Borrego Springs, Kalifornien Januar
1985
Ein Flugzeug, jedes Flugzeug eigentlich, orientiert sich an VOR-Signalen. Ein VOR (Variable Oscillation Radio) ist so etwas Ähnliches wie ein Leuchtturm, nur dass man anstelle von Lichtsignalen Funksignale verwendet, die im Flugzeug als Piepser registriert werden oder als pulsierendes Licht auf der Instrumententafel. Alle Flughäfen, auch die kleinsten, besitzen ein VOR.
Aber ein Flugzeug voller Kokain wird keinen US-Flughafen ansteuern, und wenn er noch so klein ist. Vielmehr wird es auf einer privaten Piste landen, in einer entlegenen Wüstengegend. Auf die VOR-Signale ist es trotzdem angewiesen, weil der Pilot die Piste lokalisiert, indem er ihre Position zwischen den drei nächstliegenden VOR-Signalen anvisiert, und das sind die Funkfeuer der Flugplätze von Borrego Springs, Ocotillo Wells und Blythe. Technisch läuft das so, dass die Leute am Boden ihre Position durchgeben, die sich aus der Lage und Entfernung der drei Funkfeuer errechnet.
Dann postieren sie sich mit dem Auto am Ende der Piste, und wenn das Flugzeug in Sicht kommt, verwandeln sie sich in einen Landeturm, wenn man so will, indem sie die Scheinwerfer einschalten. Der Pilot schwenkt auf das Lichtsignal ein und bringt das Flugzeug zu Boden, mitsamt seiner kostbaren Fracht.
Aus Sicherheitsgründen geben die Jungs am Boden ihre Position erst dann durch, wenn das Flugzeug schon in der Luft ist, denn bis dahin kann einiges dazwischenkommen. Aber was?
Nun, eine ganze Menge. Der Radiokompass sendet in einer bestimmten Frequenz, die kennt Keller, weil er Tíos Gespräche belauscht, und er hat sie angepeilt, so dass er die Landeposition zur gleichen Zeit erfährt wie der Pilot. Aber damit ist es nicht getan. Kellers Mannschaft kann nicht warten, bis das Flugzeug landet, um es dann zu stürmen, weil sie nicht nahe genug herankommen, ohne schon von weitem gesehen zu werden - bevor das Flugzeug auch nur zur Landung ansetzt.
Denn gleich hinter Borrego Springs beginnt die Anza-Borrego-Wüste - Tausende Quadratkilometer Einöde. Wenn man dort eine Taschenlampe anknipst, leuchtet sie so weit wie ein Scheinwerfer, und es ist so still da draußen, dass ein einziger Jeep so gut zu hören ist wie eine gepanzerte Kolonne. Man kommt einfach nicht an den Landeplatz heran, selbst wenn man rechtzeitig erfährt, wo er sich befindet.
Das ist der Grund, weshalb Keller etwas ganz anderes probiert - statt den Ort der Landung zu ermitteln und sich dann anzuschleichen, will er das Flugzeug zu einer Piste seiner Wahl dirigieren.
Er ist verrückt, dieser Plan, so übergeschnappt, dass keiner mitmachen wird.
Zuerst braucht er einen Landeplatz.
Wie sich zeigt, kennt Shag Wallace einen Rancher in der Gegend, wo man an die fünfzig Hektar braucht, um eine Kuh zu ernähren. Dieser alte Bekannte von Shag besitzt also ein paar tausend Hektar und natürlich auch eine Landebahn, wie Shag erklärt: »Zum Einkaufen muss der gute Wayne immer nach Ocotillo fliegen - kein Scherz.« Da der gute Wayne ebenso wenig von Drogendealern hält wie die Regierung in Washington, stellt er seine Piste gern zur Verfügung und ist natürlich auch bereit, absolutes Stillschweigen zu bewahren.
Als Nächstes braucht Keller einen Komplizen, weil die bereits erwähnte Regierung in Washington alles andere als begeistert sein wird, wenn der DEA-Regionalchef in Guadalajara einen solchen Piratenakt vollführt, und das Hunderte Meilen von seinem Einsatzort entfernt. Keller braucht zudem jemanden, der die zu erwartenden Beschlagnahmungen und Verhaftungen vornehmen kann, den Zugriff vor der Presse vertritt und dann die Hintermänner ermittelt, ohne Einmischung der DEA oder des Außenministers. Und das ist der Grund, weshalb Russ Dantzler neben ihm sitzt.
Noch eine Sache, die Keller bewerkstelligen muss: Er muss den Radiokompass des Piloten manipulieren, ihn auf eine andere Frequenz umschalten, damit das Flugzeug zu der Party auf Waynes Ranch dirigiert werden kann.
Mit anderen Worten: Was Keller am allermeisten braucht, ist eine riesige Mistfuhre Glück, wie der gute Wayne das ausdrücken würde.
Adán sitzt in einem Landrover, mitten in der beschissenen Wüste. Von irgendwo da oben naht eine Millionenladung Coke, die Zukunft liegt in seiner Hand.
Und ausgerechnet jetzt streikt der beschissene Radiokompass.
»Was ist denn mit dem Ding?«, fragt er schon wieder.
»Ich weiß nicht«, wiederholt der junge Techniker. Er fummelt an Knöpfen, Schaltern, Anzeigen, um das Signal zu finden. »Eine Gewitterstörung, irgendwas mit dem Flugzeug ... ich versuch's weiter.«
Der Typ klingt verängstigt. Aus gutem Grund - Raúl hat die 44er gezogen. »Mach schon!«
»Steck die Knarre weg«, befiehlt Adán. »Die hilft jetzt auch nicht.«
Raúl schiebt die Pistole schulterzuckend zurück in den Gürtel.
Aber die Hände des Technik-Freaks zittern jetzt. So sollte die Sache nicht laufen. Das sollte nur ein kleiner Nebenjob werden, für eine kleine Gratis-Lieferung Coke, und jetzt wollen sie ihm das Hirn rauspusten, wenn er das Flugzeug nicht orten kann. Und er kriegt es nicht hin.
Was er hinkriegt, ist ein Feedback, der sich anhört wie Led Zeppelin auf LSD. Und seine Finger zittern so sehr, dass sie am Gehäuse klappern.
»Bleib locker«, sagt Adán. »Finde einfach das Flugzeug.«
»Ich versuch's ja«, sagt er schon wieder. Gleich fängt er an zu weinen.
Adán wirft Raúl einen Blick zu, der besagt: Siehst du, was du angerichtet hast? Raúl ist sauer.
Erst recht, als Jimmy Peaches rüberkommt, an die Scheibe klopft und fragt: »Was ist los, verdammt?«
»Wir versuchen, das Flugzeug zu orten.«
»Ist denn das so schwer?«, fragt Peaches.
»Wenn du hier rumnervst, wird's noch schwerer«, fährt ihn Raúl an. »Hau ab, setz dich in deinen Truck, ist alles cool.«
Nein, nicht alles, denkt Peaches auf dem Weg hinüber zum Track. Erstens ist es gar nicht cool, dass ich hier im absoluten Niemandsland den Lawrence of Arabia mache, zweitens, dass ich in einem Track voller Embargo-Waffen hocke, drittens, dass ich diesen schweineteuren, vom Umtausch ausgeschlossenen Krempel mit dem Geld anderer Leute vorfinanziert habe, viertens, dass es sich bei diesen Leuten um Johnny Boy Cozzo, Johnnys Bruder Gene und Sal Scachi handelt, alle nicht gerade bekannt für ihre versöhnliche Wesensart, was mich fünftens darauf bringt, dass uns Big Paulie, wenn er Wind von dem Drogendeal kriegt, allesamt kaltmachen wird - wobei das »uns« mit »mich« anfängt -, und sechstens auf die Tatsache stößt, dass die ganze Ladung Coke in irgendeinem Flugzeug durch die Gegend fliegt und diese verkackten Bohnenfresser das Ding einfach nicht orten können.
»Jetzt finden die das beschissene Flugzeug nicht«, sagt er zu Little Peaches, als er in den Truck zurücksteigt.
»Ich versteh nicht«, sagt Little Peaches.
»Hab ich mich unklar ausgedrückt?«
»Bist ja ganz schön sauer.«
»Und ob!«
Einen Truck voller Waffen durch ganz Amerika zu karren! Nicht nur ein paar lausige Pistolen, sondern echt schweres Geschütz - kistenweise Sturmgewehre und Munition, sogar ein paar LAWs. Weiß der Teufel, wozu die Mexikaner Panzerabwehrraketen brauchen. Aber das war der Deal. Die Bohnenfresser wollten diesmal mit Waffen bezahlt werden, also hab ich mir das Geld von den Cozzos und von Sal Scachi besorgt, meinen stillen Anteil dazugetan und die ganze Ostküste abgeklappert, um dieses irrsinnige Waffenarsenal zusammenzuramschen. Dann bin ich mit dem ganzen Krempel quer durch die Staaten und hab mich jedes Mal eingeschissen, wenn irgendwo Bullen aufkreuzten, denn damit erwischt zu werden - das bedeutet Lebenslänglich in Lewisburg.
Sauer ist Peaches auch deshalb, weil er Ärger mit der Cimino-Familie hat.
Vor allem hat Big Paulie die Hosen voll wegen dem großen Mafiaprozess, denn der New Yorker Bezirksanwalt Giuliani droht den Oberhäuptern der vier anderen Familien mit jeweils hundert Jahren Haft. Deshalb hat ihnen Paulie alles verboten: Raub, Mord und natürlich Drogenhandel. Sie dürfen rein gar nichts mehr für ihren Lebensunterhalt tun. Und wenn sie dem Boss zu verstehen geben, dass sie am Verhungern sind, kriegen sie zur Antwort, dass sie ihr Geld hätten ordentlich anlegen sollen.
Dass sie legale Geschäfte hätten aufziehen sollen, um sich abzusichern.
So ein Quatsch, denkt Peaches. Den ganzen Mafia-Zirkus mitmachen - und dann als Schuhverkäufer arbeiten? Das fehlte noch.
Nur, weil Paulie so ein Waschweib ist?
Peaches hat ihn sogar schon »Großmutter« genannt.
Neulich, beim Telefonieren mit Little Peaches.
»Hey«, sagt Peaches, »weißt du, wie die Großmutter ihr Hausmädchen fickt? Du wirst es nicht glauben, aber er benutzt dafür so ein Ding zum Aufpumpen.«
»Wie soll denn das funktionieren?«, fragt Little Peaches.
»Frag lieber nicht. Wie ein platter Reifen, denke ich, den man aufpumpt, damit er hart wird.«
»Du meinst, der hat so was wie einen Schlauch in seinem Teil?«
»Könnte sein«, sagt Peaches. »Jedenfalls ist das eine Sauerei, was der macht, das Hausmädchen flachlegen, direkt unter den Augen seiner Frau. Das ist respektlos, so was. Danken wir Gott, dass Carlo das nicht mehr erleben muss.«
»Wenn Carlo noch am Leben wäre, dann würde da gar nichts laufen«, sagt Little Peaches. »Denn Paulie hätte nicht den Mumm, geschweige denn den aufblasbaren Schwanz, um eine Hure zu ficken, direkt unter den Augen von Carlos Schwester. Dann wäre Paulie nämlich tot. Mausetot.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, sagt Peaches. »Wenn einer mal über die Stränge hauen will - soll er. Wenn er eine Affäre will, kein Problem. Aber nicht im eigenen Haus. Das gehört der Frau. Das muss er respektieren. So ist es bei uns Sitte.«
»Genau.«
»Im Moment läuft alles scheiße«, sagt Big Peaches. »Wenn Neill Demonte abtritt, muss Johnny Boy Unterboss werden, sonst gibt's Ärger.«
»Paulie macht John niemals zum Unterboss«, sagt Little Peaches. »Vor dem hat er viel zu viel Angst. Der Job geht an Bellavia, pass auf.«
»Tommy Bellavia? Das ist doch Paulies Chauffeur!« Big Peaches schnauft verächtlich. »Ein Taxifahrer, nichts weiter. Ich arbeite doch für keinen beschissenen Taxifahrer! Die sollen bloß Johnny Boy nehmen, das sag ich dir!«
«Wie auch immer«, sagt Little Peaches. »Bei diesem Transport dürfen wir nichts riskieren. Wir müssen das Zeug an den Mann bringen und schleunigst zu Geld machen.«
»Was du nicht sagst.«
Callan denkt so ziemlich dasselbe. Er sitzt hinten im Truck, und diese Wüstennacht ist lausig kalt. Hätte er nur mehr drübergezogen als seine alte Lederjacke.
»Wer hat denn auch geahnt«, sagt O-Bop, »dass es in der Wüste kalt wird?«
»Was läuft hier eigentlich?«, fragt Callan.
Ihm passt dieser ganze Zirkus nicht. Dass sie von New York weg sind, dass sie hier in der tiefsten Einöde rumhängen, dass sie überhaupt mitmachen. Er sieht, was auf den Straßen abgeht, was Crack in der Nachbarschaft anrichtet, in der ganzen Stadt. Und er fühlt sich beschissen. Das ist keine Art, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das mit den Gewerkschaften, mit den Baugeschäften ist eine Sache, Kreditwucher, Glücksspiel, sogar Auftragsmord - alles okay. Aber es macht ihm wirklich keinen Spaß, für Peaches Crack unter die Leute zu bringen.
»Was sollen wir machen?«, hat O-Bop ihn gefragt, als das Thema zu Debatte stand. »Ablehnen?«
»Am besten, ja.«
»Wenn die Sache platzt, sind wir auch geliefert.«
»Ich weiß.«
Nun sitzen sie also da, im Laderaum eines Trucks mit genügend Waffen, um eine kleine Bananenrepublik zu erobern, und warten auf das Flugzeug, damit sie umladen und nach Hause fahren können.
Für den Fall, dass die Mexikaner tricksen wollen, hat Callan zehn Schuss im Magazin und einen weiteren in der Kammer.
»Wir haben doch hier ein ganzes Waffenarsenal«, sagt O-Bop. »Was willst du da mit deiner 22er?«
»Die reicht mir aus.«
Da hat er verdammt noch mal recht, denkt O-Bop und muss an Eddie Friel denken.
»Geh mal nachsehen, was da läuft«, sagt Callan.
O-Bop hämmert an die Wand vom Fahrerhaus. »Was ist denn nun?«
»Die finden das verdammte Flugzeug nicht.«
»Du willst mich wohl verarschen!«
»Klar will ich dich verarschen!«, brüllt Peaches zurück. »Der Flieger ist gelandet, wir haben unsern Tausch gemacht und essen bei Rocco Linguine mit Muschelsauce!«
»Wie kann denn ein ganzes Flugzeug verlorengehen?«, fragt Callan.
Draußen ist nichts als Finsternis.
Das ist das Problem. Der Pilot fliegt achttausend Fuß über der Wüste, unter ihm nichts als Finsternis. Er kann Borrego Springs, Ocotillo Wells und Blythe orten, aber wenn ihm nicht bald jemand die Landekoordinaten durchgibt, dann ist seine Chance, diese Piste zu finden, gleich null.
Nichts zu sehen da unten.
Das Problem ist, dass der Treibstoff nicht ewig reicht, und wenn nicht bald was passiert, muss er umkehren, zurück nach El Salvador. Er versucht es wieder mit dem Funkgerät und kriegt dasselbe metallische Kreischen. Dann dreht er eine Halbfrequenz weiter und hört etwas.
»Bitte melden, bitte melden.«
»Wo zum Teufel steckt ihr?«, fragt der Pilot. »Ihr sendet auf der falschen Frequenz!« Glaubst du, denkt Keller.
Der heilige Antonius ist der Schutzpatron der hoffnungslosen Fälle, und Keller nimmt sich vor, ihm mit einer Kerze und einem Zwanzigdollarschein zu danken, als Shag ins Funkgerät spricht: »Wollen Sie stänkern, oder wollen Sie landen?«
»Ich will landen!«
Die Männer, die sich in dieser klirrend kalten Nacht um das Funkgerät drängen, grinsen sich triumphierend an. Und beim Gedanken, dass gleich ein Flugzeug landet, randvoll bepackt mit Kokain, wird ihnen sofort wärmer.
Wenn die Sache nur nicht in die Hose geht.
Was durchaus passieren könnte.
Shag ist schon alles egal. »Meine Karriere ist sowieso im Eimer.«
Er gibt dem Piloten die Koordinaten durch. »Zehn Minuten«, sagt der Pilot. »Verstanden. Over.«
»Zehn Minuten«, sagt Keller.
»Das werden lange zehn Minuten«, meint Dantzler.
In diesen zehn Minuten kann eine Menge passieren. Der Pilot kann misstrauisch werden und umkehren. Der Funker von der anderen Landebahn kann Dantzlers Frequenzsperre durchbrechen, mit dem Piloten Kontakt aufnehmen und ihn auf seine Piste lenken. In diesen zehn Minuten, denkt Keller, kann es auch ein Erdbeben geben, mit einem Riss quer über die Landebahn, der uns alle verschluckt. In diesen zehn Minuten ...
Er stößt einen tiefen Seufzer aus.
»Jetzt wird's ernst«, meint Dantzler.
Shag lacht ihm ins Gesicht.
Adán Barrera lacht nicht, er beißt die Zähne zusammen. Dieser Deal darf auf keinen Fall schiefgehen. Tío hat ihn gewarnt. Dieser Deal muss einfach klappen. Aus vielen Gründen, denkt Adán.
Er ist jetzt verheiratet. Der Tag, an dem er mit Lucia getraut wurde, von Padre Juan persönlich, war sein schönster Tag, aber noch schöner war die Nacht darauf. Nach Jahren der Zurückweisung bekam er Lucia endlich ins Bett. Und sie war alles andere als passiv. Sie wand sich wie eine Schlange, rief seinen Namen, breitete ihr blondes Haar übers Kissen, genauso hingebungsvoll, wie sie ihre Schenkel öffnete.
Das Eheleben ist eine großartige Sache, aber es bedeutet auch Verantwortung, besonders jetzt, wo Lucia schwanger ist. Jetzt, denkt Adán, der draußen in der Wüste sitzt, wird alles anders. Das ist eine Sache auf Dauer. Du wirst papá, musst eine Familie ernähren, ihre Zukunft liegt in deiner Hand. Er ist nicht unglücklich darüber, im Gegenteil. Er ist geradezu versessen darauf, diese Verantwortung zu übernehmen, über die Maßen beglückt, Vater zu werden - dieser Deal darf also auf gar keinen Fall schiefgehen.
»Versuch eine andere Frequenz«, sagt er zu dem Techniker.
»Ich hab schon alle durch -«
Er sieht, wie Raúl zur Pistole greift.
»Ich versuch's noch mal«, beeilt er sich zu sagen, aber er ist sich schon sicher, dass es nicht an der Frequenz liegt. Es liegt an der Ausrüstung, an diesem Funkgerät. Da muss sich irgendein Draht gelöst haben, kein Wunder bei diesen Holperstraßen hier. Die Leute sind doch alle gleich, denkt er. Transportieren Millionenwerte auf dem Luftweg, aber sind nicht bereit, ein paar hundert Dollar für ein anständiges Funkgerät auszugeben. Und ich muss mich mit diesem Schrott rumärgern.
Aber er hält wohlweislich den Mund.
Dreht nur weiter an den Knöpfen herum.
Adán starrt in den nächtlichen Himmel.
Die Sterne leuchten so hell und stehen so tief, dass man meint, nach ihnen greifen zu können. Am liebsten aber würde er das mit dem Flugzeug so machen.
Keller auch.
Denn da oben ist nichts zu sehen. Nichts als Sterne und eine schmale Mondsichel. Er schaut auf die Uhr.
Alle schauen ihn an, als hätte er die Pistole gezogen. Die zehn Minuten sind vorbei.
Du hattest deine zehn Minuten, denkt er. Deine endlosen, nervtötenden, hirnzerrüttenden zehn Minuten. Also mach schon. Spann uns nicht auf die Folter.
Er schaut wieder in den Himmel.
So wie die anderen auch. Stehen in der Kälte, starren in den Himmel wie eine Rotte Urmenschen, die begreifen wollen, was das da oben zu bedeuten hat.
»Es ist vorbei«, sagt Keller nach einer Weile. »Sie müssen was gemerkt haben.«
»Verfluchter Mist«, sagt Shag.
»Tut mir leid, Art«, sagt Dantzler.
»Schon gut«, sagt Keller. »War ein Versuch.«
Aber es ist nicht gut. Eine solche Chance, harte Beweise für die Existenz des mexikanischen Trampolins zu bekommen, wird vielleicht nie wiederkehren.
Das Büro in Guadalajara wird geschlossen, sie versetzen uns sonstwohin, und fertig.
»Warten wir noch fünf Minuten, und dann -«
»Klappe halten!«, sagt Shag.
Alle starren ihn an. So unhöflich kennen sie den Cowboy gar nicht.
»Horcht mal«, sagt er. Dann hören sie es auch. Das Brummen eines Motors. Eines Flugzeugmotors.
Shag rennt zum Truck, startet den Motor und schaltet den Scheinwerfer ein.
Die Positionslichter des Flugzeugs blinken zurück. Es dauert zwei Minuten, bis es sich aus dem Dunkel gelöst hat und sicher gelandet ist.
Der Pilot atmet erleichtert auf, als er den Mann kommen sieht.
Dann hält ihm der Mann eine Pistole unter die Nase. »Überraschung, du Arschloch«, sagt Russ Dantzler. »Sie haben das Recht zu schweigen ...« Schweigen?
Der Pilot ist einfach sprachlos.
Shag aber nicht. Er sitzt mit Keller im Auto und überschlägt sich mit Lobsprüchen. »Boss, du bist der Größte! Du hast die Arme eines Orang-Utan! Du bist King Kong! Du greifst an den Himmel und holst dir ein Flugzeug runter!«
Keller lacht. Dann sieht er Dantzler kommen. Dantzler schüttelt den Kopf und wirkt selbst im Dunklen leichenblass.
Am Boden zerstört.
»Art«, sagt Dantzler. »Der Mann ... der Pilot... er sagt...«
»Was?«
»Er sagt, er arbeitet für uns.«
Keller öffnet die Wagentür und sieht den Piloten dasitzen. Phil Hansen müsste eigentlich ziemlich nervös sein. Aber er ist es nicht. Er sitzt locker da, als ginge es um ein kleines Verkehrsdelikt, das sowieso gleich bereinigt wird. Keller würde ihm nur zu gern in die grinsende Visage schlagen.
»Lange nicht gesehen, Keller«, sagt er in einem Ton, als wäre das Ganze ein dreckiger Witz.
»Was zum Teufel soll das heißen: Du arbeitest für uns?«
Hansen mustert ihn seelenruhig. »Kerberos.«
»Was?«
»Komm schon! Kerberos? Ilopongo? Hangar 4?«
»Wovon redest du, verdammt?«
Das Lächeln weicht aus Hansens Gesicht. Jetzt packt ihn die Angst.
»Dachtest du, du kommst damit durch?«, fragt Keller. »Du schmuggelst Hunderte Kilo Kokain in die USA und kommst damit durch? Was bildest du dir ein, du Arschloch?«
»Es hieß, du wärst -«
»Es hieß, ich wäre was?
»Nichts.«
Hansen wendet sich ab und schaut aus dem Fenster. Keller sagt: »Wenn du den großen Joker dabei hast, dann zieh ihn jetzt! Nenn mir einen Namen. Wen soll ich anrufen?«
»Das weißt du selbst.«
»Nein. Sag's mir.«
»Ich sage nichts mehr.« Er starrt aus dem Fenster.
»Jemand hat dich reingelegt, Hansen«, sagt Keller. »Ich weiß nicht, was sie dir erzählt haben, aber wenn du glaubst, wir spielen im selben Team, dann liegst du falsch. Was du da geladen hast, bringt dir dreißig Jahre bis Lebenslänglich, und fünfzehn davon sitzt du ab, unter Garantie. Aber noch kannst du auf die richtige Seite wechseln. Wenn du kooperierst, und die Sache läuft gut, handle ich einen Deal für dich raus.«
Als Hansen sich zu ihm umdreht, hat er Tränen in den Augen. »Ich habe Frau und Kinder in Honduras«, sagt er.
Ramón Mette, denkt Keller. Hansen hat eine Heidenangst, dass sich Mette an seiner Familie rächt. Scheißsituation, denkt Keller. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Bevor du Drogenkurier wurdest.
»Wenn du deine Kinder wiedersehen willst, bevor sie selber Kinder haben, dann rede mit mir.«
Keller kennt ihn schon, diesen Delinquentenblick, mit dem ein Beschuldigter auf Auswege sinnt - und zu seinem Schrecken erkennt, dass es keinen Ausweg gibt, nur das kleinere Übel. Keller wartet, dass bei Hansen der Groschen fällt.
Hansen schüttelt den Kopf.
Keller knallt die Wagentür zu und geht ein Stück in die Wüste. Sie könnten das Flugzeug jetzt beschlagnahmen, doch was würde das nützen? Sie hätten den Beweis, dass SETCO Drogen transportiert, aber das weiß er schon. Und er würde nicht erfahren, welche Fracht für den Rückflug vorgesehen ist und an wen sie geht.
Nein, es wird Zeit für den nächsten Piratenakt. Er geht zurück zu Dantzler. »Ich schlage vor, wir ändern unseren Plan. Wir lassen die Maschine weiterfliegen.«
»Waas?«
»Dann schlagen wir drei Fliegen mit einer Klappe«, sagt Keller. »Wir sehen, wohin das Kokain geht, wohin das Geld fließt - und was da zurücktransportiert wird.«
Dantzler zieht mit. Was soll er auch machen. Schließlich kommt der Vorschlag von Art Keller.
Keller nickt und geht zurück zum Auto.
»War nur ein Test«, sagt er zu Hansen. »Alles in Ordnung. Du kannst weiterfliegen.«
Keller schaut dem startenden Flugzeug nach.
Dann geht er ans Funkgerät, um Ernie durchzugeben, dass er die Zwischenlandung des Flugzeugs in Guadalajara abwarten und dokumentieren soll.
Aber Ernie meldet sich nicht.
Ernie Hidalgo ist vom Radar verschwunden.
5 Narcosantos
Was das amerikanische Volk nicht will, ist ein weiteres Kuba auf dem mittelamerikanischen Festland und ein weiteres Vietnam.
Ronald Reagan
Mexiko
Januar 1985
Sechs Stunden nach dem Verschwinden von Ernie stürmt Keller das Büro von Oberst Vega. »Einer meiner Leute ist weg«, sagt er. »Ich will, dass Sie die ganze Stadt auf den Kopf stellen, dass Sie Miguel Ángel Barrera verhaften, dass Sie mir nicht wieder mit Ihren albernen Ausreden kommen -«
»Senor Keller -«
»- von wegen, Sie wüssten nicht, wo er steckt, und dass er völlig unbescholten ist. Ich will, dass Sie die ganze Bande festsetzen - Barrera, seine Neffen, Ábrego, Méndez, jeden einzelnen von diesen gottverdammten Drogenkriminellen - und ich -«
»Sie wissen doch gar nicht, ob er entführt wurde«, sagt Vega. »Vielleicht hat er eine Geliebte, oder er hat sich irgendwo betrunken. Und woher wollen Sie wissen, dass Barrera damit zu tun hat -«
Keller springt fast über den Schreibtisch, brüllt dem Oberst ins Gesicht.
»Wenn Sie wollen, fassen Sie das als Kriegserklärung auf!«
Und er meint es ernst. Er wird alle Register ziehen, mit der Presse drohen, die Drohung wahrmachen, mit gewissen Kongressabgeordneten drohen, auch diese Drohung wahrmachen - er wird eine ganze Marinedivision von Camp Pendieton hierher verlegen und einen gottverdammten Krieg anfangen, wenn das nötig ist, um Ernie Hidalgo herbeizuschaffen.
Wenn - bitte, lieber Gott, Jesus und Maria - Ernie noch am Leben ist.
Eine Sekunde später fragt er: »Warum sitzen Sie noch hier?« Vega gibt das Startsignal.
Plötzlich, wie durch einen Zauber, weiß er, wo die Gomeros stecken. Es ist ein wahres Wunder. Vega weiß auch, wo die unteren und mittleren Chargen wohnen, wo sie sich treffen, ihre Geschäfte betreiben. Und alle werden sie aufgescheucht. Die Federales von Oberst Vega wüten wie die Gestapo, nur dass sie weder Miguel Angel finden noch Adán oder Raúl, Méndez oder Ábrego. Immer dieselbe Masche, denkt Keller. Man findet nur, was man finden will. Sie wissen genau, wo die Kerle wohnen, sie wissen nur nicht, wo sie gerade stecken.
Vega lässt sogar Barreras Haus durchsuchen, plötzlich kennt er die Adresse, doch Barrera ist nicht da. Dafür finden sie etwas, was Keller zum Berserker werden lässt.
Ein Foto von Ernie Hidalgo.
Ein Passfoto, angefertigt in einer Dienststelle der Federales. Keller hält es Vega unter die Nase.
»Sehen Sie sich das an!«, brüllt er. »Hat er das Foto von Ihren Leuten? Haben die ihm das Foto gegeben?«
»Auf keinen Fall.«
»Darauf verwette ich meinen Arsch!«
Keller fährt zurück ins Büro und ruft Tim Taylor in Mexico City an.
»Ich hab's schon gehört«, sagt Taylor. »Was haben Sie unternommen?«
»Ich war beim Botschafter«, sagt Taylor. »Er wird persönlich beim Präsidenten vorsprechen. Haben Sie Teresa und die Kinder in Sicherheit gebracht?«
»Sie wollte nicht weg, aber -«
»Verdammter Mist!«
»Aber ich hab Shag beauftragt, sie zum Flughafen zu bringen«, sagt Keller. »Sie müssten schon in San Diego sein.«
»Was ist mit Shag?«
»Der ist im Einsatz.«
»Ich ziehe Sie und Ihre Leute von dort ab.«
»Den Teufel werden Sie!«, sagt Keller.
Schweigen in der Leitung, dann fragt Taylor: »Was brauchen Sie, Art?«
»Einen verlässlichen Cop«, sagt Keller und erzählt Taylor von dem Foto, das er in Barreras Haus gefunden hat. »Ich hab genug von diesen beschissenen Federales. Schicken Sie mir einen fähigen Mann, der sauber ist.«
Am Nachmittag trifft Antonio Ramos in Guadalajara ein.
Adán hört den Mann schreien.
Dann die ruhige, geduldige Stimme, die immer wieder dieselbe Frage stellt.
Wer ist Chupar? Wer ist Chupar? Wer ist Chupar?
Ernie sagt ihnen wieder und wieder, dass er es nicht weiß. Sein Folterer glaubt ihm nicht und stößt immer von neuem mit dem Eispickel zu, kratzt damit an Ernies Schienbein.
Du weißt es. Sag uns, wer es ist. Wer ist die Quelle Chupar?
Ernie nennt ihnen Namen. Alle Namen, die ihm einfallen. Kleindealer, Großdealer, Federales, Provinzpolizisten, Gomeros - Hauptsache, sie hören auf.
Aber sie hören nicht auf. Sie nehmen ihm keinen einzigen Namen ab. Der Doktor - so wird der Mann von den anderen genannt - stößt immer wieder mit dem Eispickel zu. Langsam, geduldig, sorgfältig, unbeeindruckt von Ernies Schreien. Ohne jede Eile.
Wer ist Chupar? Wer ist Chupar? Wer ist Chupar? »Ich weiß es nicht....«
Der Eispickel schafft sich einen neuen Zugang zu einem neuen Stück Knochen und kratzt.
Gúero Méndez kommt entnervt aus dem Verhörraum.
»Ich glaube, er weiß es wirklich nicht«, sagt er.
»Doch«, behauptet Raúl. »Das ist ein Macho - ein harter Hund.«
Hoffen wir, dass er nicht zu hart ist, denkt Adán. Wenn er uns den Namen nennt, können wir ihn laufen lassen, bevor die Sache außer Kontrolle gerät. Ich kenne die Yankees besser als du, hat Adán seinem Onkel erklärt. Sie werfen Bomben, Feuer, Gift auf andere Völker, aber wenn einem von ihnen auch nur ein Haar gekrümmt wird, reagieren sie mit blinder, selbstgerechter Raserei.
Nur wenige Stunden nach der Entführung von Hidalgo hat eine Armee von DEA-Leuten Adáns Depot in Rancho Santa Fe ausgehoben.
Der größte Drogenfund aller Zeiten.
Eine Tonne Kokain im Wert von 37,5 Millionen Dollar, zwei Tonnen Marihuana im Wert von fünf Millionen Dollar, 27 Millionen in bar, außerdem Geldzählmaschinen, Waagen und andere Utensilien des Drogengewerbes. Nicht zu vergessen fünfzehn illegale mexikanische Arbeiter, deren Job es war, das Kokain zu portionieren und zu verpacken.
Aber der Preis war noch viel höher, denkt Adán, während er versucht, die Schreie aus dem Nachbarzimmer zu überhören. Der Preis war noch viel höher. Drogen und Geld kann man ersetzen, aber ein Kind...
»Eine lymphatische Malformation«, haben die Ärzte gesagt, »ein zystisches Lymphangiom«. Das nichts zu tun hat mit der hektischen Flucht aus dem Haus in San Diego, nichts zu tun mit den Erschütterungen während des Endspurts zur Grenze bei Tijuana, nicht durch den Flug nach Guadalajara. Diese Fehlbildung, haben ihm die Ärzte erklärt, entwickle sich schon am Anfang der Schwangerschaft, die Ursachen seien nicht geklärt. Klar ist nur, dass sich das Lymphsystem der Tochter von Adán und Lucia nicht normal entwickelt hat, dass sie daher Missbildungen an Gesicht und Hals hat und dass es kein Mittel dagegen und keine Aussicht auf Heilung gibt. Zwar ist die Lebenserwartung normal, aber es gibt eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen und Schlaganfälle, gelegentlich Atemprobleme...
Lucia gibt ihm, Adán, die Schuld.
Nicht ihm direkt, sondern dem Leben, das er ihnen aufzwingt, seinen Geschäften, dem Drogenschmuggel. Hätten sie in den Staaten bleiben können, wo die pränatale Vorsorge einfach hervorragend ist, wäre das Kind wie vorgesehen in der Scripps Clinic entbunden worden, hätten sie gleich, als sie sahen, dass etwas mit dem Kind nicht stimmte, dass etwas schrecklich falsch war mit dem Kind, die besten Ärzte der Welt zur Verfügung gehabt. Dann wäre vielleicht alles ganz anders gekommen - obwohl die Ärzte in Guadalajara ihr versicherten, dass das in diesem Fall auch nicht geholfen hätte.
Lucia wollte das Kind in den Staaten bekommen, aber sie wollte nicht ohne ihn fahren, und er durfte nicht. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl, und Tío ließ ihn nicht weg.
Aber wenn ich es gewusst hätte, denkt er jetzt, wenn ich nur die leiseste Befürchtung gehabt hätte, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt, dann wäre ich das Risiko eingegangen. Und hätte alle Konsequenzen getragen.
Zur Hölle mit den Yankees.
Zur Hölle mit Art Keller.
Gleich in den ersten Stunden nach der Geburt hatte Adán bei Padre Juan angerufen. Lucia war untröstlich, sie alle waren untröstlich, und Padre Juan kam sofort ins Krankenhaus. Kam und nahm eine Nottaufe vor, für alle Fälle, dann hielt er Lucias Hand und redete mit ihr, betete mir ihr, versicherte ihr, sie würde eine wunderbare Mutter sein, für ein wunderbares, ganz besonderes Kind, das seine Mutter sehr brauchen würde. Dann, als die Beruhigungsmittel wirkten und Lucia endlich einschlief, ging Adán mit Padre Juan hinaus auf den Parkplatz, wo sie rauchen konnten.
»Sagen Sie mir, was Sie denken«, sagte Padre Juan. »Dass Gott mich bestraft.«
»Gott bestraft keine unschuldigen Kinder für die Sünden ihrer Väter«, antwortete Padre Juan. Selbst wenn es so in der Bibel steht, dachte er im Stillen.
»Dann erklären Sie mir«, sagte Adán. »Drückt Gott so seine Liebe zu den Kindern aus?«
»Lieben Sie Ihr Kind, trotz alledem?«
»Natürlich.«
»Dann liebt Gott durch Sie.«
»Die Antwort reicht mir nicht aus.«
»Eine bessere habe ich nicht.«
Nein, diese Antwort reicht nicht aus, denkt Adán auch jetzt noch. Und die Entführung von Hidalgo wird uns allen das Genick brechen, wenn es nicht schon passiert ist.
Hidalgo festzusetzen war die leichteste Übung. Das hat die Polizei für sie erledigt. Drei Polizisten haben ihn an der Plaza de Armas aufgegriffen und bei Raúl und Gúero abgeliefert, die ihn unter Drogen gesetzt und mit verbundenen Augen hierher gebracht haben.
Wo ihn der Doktor wieder munter gemacht hat, um mit seiner Behandlung zu beginnen.
Die bis jetzt aber keine Resultate zeigt.
Er hört die sanfte, geduldige Stimme des Doktors im Nachbarzimmer.
»Nenn mir die Namen«, sagt der Doktor. »Die Namen von Regierungsbeamten, die auf der Gehaltsliste von Miguel Angel Barrera stehen.«
»Ich kenne keine Namen.«
»Hat Chupar dir diese Namen genannt? Du hast gesagt, er hat sie genannt. Sag sie mir.«
»Ich habe gelogen. Das war erfunden. Ich weiß keine Namen.«
»Dann sag mir den Namen von Chupar. Damit wir das hier mit ihm machen können statt mit dir.«
»Ich weiß nicht, wer er ist.«
Könnte es sein, denkt Adán, dass er es wirklich nicht weiß? Ihm klingt noch immer die eigene, verängstigte Stimme von damals in den Ohren, als ihn die DEA und die Federales geschlagen und gefoltert haben, um Dinge aus ihm herauszuholen, die er nicht wusste. Angeblich, weil sie sichergehen wollten, dass er es wirklich nicht wusste, also haben sie ihn weiter gefoltert, obwohl er wieder und wieder gesagt hatte, dass er es nicht wusste.
»Mein Gott«, sagt er. »Wenn er's nun wirklich nicht weiß?«
»Na und?« Raúl zuckt die Schultern. »Die Scheiß-Yankees brauchen mal eine Lektion.«
Adán hört, wie die Lektion im Nachbarzimmer erteilt wird. Er hört Hidalgos Stöhnen, während die Stahlspitze an seinem Schienbeinknochen kratzt. Und die sanfte, beharrliche Stimme des Doktors: »Du willst doch deine Frau wiedersehen, deine Kinder. Denen schuldest du doch mehr als diesem Informanten. Überleg mal: Warum haben wir dir die Augen verbunden? Wenn wir dich umbringen wollten, müssten wir uns diese Mühe nicht machen. Wir wollen dich laufen lassen. Zurück zu deiner Familie. Zu Teresa und Ernesto und Hugo. Überleg mal, welche Sorgen sie sich machen. Welche Angst deine kleinen Söhne haben müssen. Wie sehr sie sich nach ihrem Papa sehnen. Du willst doch nicht, dass sie ohne Vater aufwachsen, oder? Wer ist Chupar? Was hat er dir erzählt? Welche Namen hat er genannt?«
Dann Hidalgos Antwort, unterbrochen durch Schluchzen und Stöhnen.
»Ich ... weiß ... es... nicht.«
»Pues...«
Es fängt von vorne an.
Antonio Ramos ist auf der Müllkippe von Tijuana groß geworden.
Und das ist wörtlich zu nehmen.
Er hat in einem Verschlag am Rand der Müllkippe gelebt und sein Essen, seine Kleidung, selbst seinen Verschlag aus dem Müll zusammengeklaubt. Als sie in der Nähe eine Schule bauten, ist Ramos hingegangen, jeden Tag, und wenn ein Kind ihn hänselte, weil er nach Müll stank, verprügelte er das Kind. Ramos war groß und kräftig - unterernährt zwar, aber hochgewachsen, mit flinken Händen.
Nach kürzester Zeit schon wurde er nicht mehr gehänselt.
Er schaffte die Schule bis zum Abschluss, und als ihn die Polizei von Tijuana in Dienst nahm, war das für ihn die Erlösung. Guter Lohn, gutes Essen, saubere Sachen. Er sah nicht mehr aus wie ein Hungerleider, gewann Statur, und seine Vorgesetzten stellten fest, dass er nicht nur Härte besaß, sondern auch Intelligenz.
Der DFS, der mexikanische Geheimdienst, stellte das ebenfalls fest und warb ihn an.
Und wenn es irgendeine Sache gibt, die Intelligenz und Härte erfordert, kriegt Ramos den Job.
Er hat den Auftrag bekommen, den amerikanischen DEA-Agenten Hidalgo aufzuspüren, um jeden Preis.
Keller holt ihn vom Flughafen ab.
Ramos hat ein gebrochenes Nasenbein, auch manche andere Fraktur hat ihre Spuren hinterlassen. Seine dichte schwarze Mähne streicht er immer mal wieder vergeblich aus der Stirn. Zwischen die Lippen geklemmt hat er sein Markenzeichen - die schwarze Zigarre.
»Jeder Polizist braucht ein Markenzeichen«, belehrt er seine Leute. »Die bösen Buben sollen sagen: Hütet euch vor dem Macho mit der schwarzen Zigarre.«
Und das tun sie.
Sie geben offen zu, dass sie Angst vor Ramos haben, denn sein wohlverdienter Ruf gründet sich auf eine ganz besonders brutale Art von Selbstjustiz. Ganoven, die es mit ihm zu tun bekamen, sollen schon, so heißt es, nach der Polizei geschrien haben, doch vergeblich, denn auch die Polizei will sich nicht mit Ramos anlegen.
In Tijuana, nahe der Avenida Revolución, gibt es eine Gasse, und diese Gasse heißt im Volksmund La Universidad de Ramos. Sie ist übersät von Zigarrenstummeln und ausgespuckten Missetaten. Und die Gasse heißt so, weil Ramos dort., als er noch Streifenpolizist war, den Ganoven, die sich für harte Jungs hielten, seine Lektionen erteilte.
»Ihr seid nicht hart«, pflegte er ihnen zu sagen. »Wenn einer hart ist, bin ich es.«
Dann zeigte er ihnen, wie hart er war. Und damit sie es nicht vergaßen, konnten sie die Erinnerung daran noch Jahre später im Spiegel betrachten.
Sechs Bösewichter haben versucht, ihn umzubringen. Ramos ging zu allen sechs Beerdigungen, nur für den Fall, dass sich die Hinterbliebenen an ihm rächen wollten. Keiner tat es. Seine Uzi nennt er »mi esposa« - meine Angetraute. Er ist zweiunddreißig Jahre alt.
Nach ein paar Stunden hat er die drei Polizisten gefunden, die Ernie Hidalgo festgenommen haben. Einer von ihnen ist der Polizeichef der Provinz Jalisco.
Ramos sagt zu Keller: »Wir können es auf die schnelle Tour machen oder auf die langsame.«
Ramos zieht zwei Zigarren aus der Hemdtasche, bietet Keller eine an und zuckt die Schultern, als Keller abwinkt. Er nimmt sich viel Zeit für seine Zigarre, rollt sie sorgfältig zwischen den Fingern, damit sie gleichmäßig brennt, dann nimmt er einen langen Zug und mustert Keller mit hochgezogenen schwarzen Augenbrauen.
Die Theologen haben recht, denkt Keller. Wir werden, was wir hassen.
Dann sagt er: »Die schnelle Tour.«
Ramos darauf: »Bin bald wieder da.«
»Nein«, sagt Keller. »Ich will dabei sein.«
»Das ist die Antwort eines Mannes«, sagt Ramos. »Aber ich will keine Zeugen.«
Ramos bringt den Polizeichef von Jalisco und die zwei Federales in einen Kellerraum.
»Ich hab nicht die Zeit, mich mit euch rumzuärgern, Jungs«, sagt Ramos. »Das Problem ist: Im Moment habt ihr mehr Angst vor Miguel Ángel Barrera als vor mir. Das werden wir jetzt ändern.«
»Bitte«, sagt der Polizeichef. »Wir sind alle Polizisten.«
»Nein, ich bin Polizist«, sagt Ramos und zieht sich schwarze, gepanzerte Handschuhe an. »Der Mann, den ihr gekidnappt habt, ist Polizist. Du bist ein Stück Scheiße.«
Er hält die Hände mit den Handschuhen hoch, damit sie sich einen Eindruck verschaffen können.
»Ich will mir nicht die Hände verletzen«, sagt Ramos.
Der Polizeichef sagt: »Wir können uns doch auch so einigen.«
»Nein«, sagt Ramos. »Können wir nicht.«
Er wendet sich an den größeren, jüngeren Bundespolizisten.
»Nimm die Hände hoch. Verteidige dich.«
Der Polizist reißt verschreckt die Augen auf. Schüttelt den Kopf, hebt die Hände nicht.
Ramos zuckt die Schultern. »Wie du willst.«
Er täuscht einen rechten Kinnhaken an und rammt ihm drei harte Linke in die Rippen. Knochen knirschen unter dem Handschuh, der Polizist will in die Knie gehen, doch Ramos hält ihn mit der linken Hand aufrecht und verpasst ihm drei weitere Hiebe mit der Rechten. Dann wirft er ihn gegen die Wand, dreht ihn um und bearbeitet seine Nieren mit beiden Fäusten, packt ihn beim Nacken, presst ihn mit dem Gesicht gegen die Wand und sagt: »Du hast deinem Land Schande gemacht. Schlimmer noch: Du hast meinem Land Schande gemacht.« Darauf zieht er ihn am Gürtel von der Wand weg und stößt ihn mit Wucht quer durchs Zimmer gegen die andere Wand. Mit einem dumpfen Knall trifft sein Kopf auf Beton. Dies wiederholt Ramos mehrere Male, bevor er den Mann zu Boden sacken lässt.
Ramos setzt sich auf einen dreibeinigen Hocker und zündet sich eine Zigarre an, während die beiden anderen auf ihren bewusstlosen Freund starren, der mit zuckenden Beinen auf dem Bauch liegt.
An den Wänden klebt sein Blut.
»jetzt«, sagt Ramos, »habt ihr mehr Angst vor mir als vor Barrera, jetzt können wir anfangen. Wo ist der Amerikaner?« Sie erzählen ihm alles, was sie wissen.
»Sie haben ihn an Gúero Méndez und Raúl Barrera ausgeliefert«, berichtet Ramos an Keller. »Und an einen Doktor Alvarez, woraus ich schließe, dass Ihr Freund wahrscheinlich noch am Leben ist.«
»Wieso?«
»Alvarez hat für den DFS gearbeitet, als Verhörspezialist. Hidalgo muss Informationen haben, an die sie herankommen wollen.«
»Nein«, sagt Keller. »Die hat er nicht.«
Sein Magen krampft sich zusammen. Sie foltern Ernie, weil sie wissen wollen, wer Chupar ist. Und es gibt keinen Chupar.
»Heraus mit der Sprache«, sagt Tío. Ernie stöhnt. »Ich weiß es nicht.«
Tío nickt Alvarez zu. Der Doktor, der Ofenhandschuhe trägt, greift nach der weißglühenden Eisenstange, um sie -
»O mein Gott!«, schreit Ernie. Seine Augen weiten sich vor Entsetzen, und sein Kopf sinkt auf den Tisch, an dem sie ihn festgeschnallt haben. Sein Herzschlag, der eben noch raste, verlangsamt sich bedrohlich.
Der Doktor legt die Ofenhandschuhe beiseite und greift nach einer Spritze Lidocain, die er in Ernies Arm injiziert. Das Mittel wird ihn bei Bewusstsein halten, so dass er den Schmerz spürt. Und es hält sein Herz am Laufen. Wenig später hebt Ernie den Kopf und reißt die Augen auf.
»Wir lassen dich nicht sterben«, sagt Tío. »Und jetzt sprich. Sag mir, wer Chupar ist.«
Ich weiß, dass Keller nach mir sucht, denkt Ernie.
Dass er Himmel und Erde in Bewegung setzt.
»Ich weiß nicht«, keucht er, »wer Chupar ist.«
Der Doktor greift wieder nach der Eisenstange.
Und Ernie brüllt. »O mein Goooooott!«
Keller zündet die Kerze an, verfolgt, wie die Flamme kräftiger wird, dem Himmel zustrebt.
Er kniet vor der Bank mit den Votivkerzen und betet für Ernie. Zur Jungfrau Maria, zum heiligen Antonius, zu Christus persönlich.
Ein großer dicker Mann kommt durch den Mittelgang der Kathedrale auf ihn zu. »Padre Juan.«
Der Padre hat sich in den neun Jahren kaum verändert. Sein weißes Haar ist ein bisschen dünner, sein Bauch ein bisschen dicker geworden, aber seine grauen Augen haben die gleiche Kraft wie früher.
»Und ich dachte, du bist nicht gläubig«, sagt Parada.
»Man tut, was man kann.«
Parada nickt. »Wie kann ich dir helfen?«
»Du kennst doch die Barreras.«
»Ich habe sie getauft«, antwortet Parada. »Bei mir waren sie zur Erstkommunion, zur Firmung.« Und ich habe Adán und Lucia getraut, denkt er im Stillen. Habe ihr Baby im Arm gehalten.
»Sprich mit ihnen«, sagt Keller. »Ich weiß nicht, wo sie sind.«
»Ich dachte ans Radio, ans Fernsehen. Sie respektieren dich. Auf dich hören sie.«
»Ich weiß nicht«, sagt Parada. »Aber ich kann's versuchen.«
»Geht das sofort?«
»Natürlich«, sagt Parada. »Aber ich kann dir vorher die Beichte abnehmen.«
»Dafür ist jetzt keine Zeit.«
Sie fahren zum Sender, und Parada spricht seine Botschaft »An die Entführer des amerikanischen Polizisten«. Er fleht sie an, im Namen des Vaters, des Sohnes, der Jungfrau Maria und aller Heiligen, den Mann unversehrt freizugeben. Ermahnt sie, ihr Gewissen zu prüfen, und zieht dann, zu Kellers Überraschung, seine höchste Trumpfkarte - er droht, sie zu exkommunizieren, wenn sie dem Mann etwas antun.
Verurteilt sie kraft seines Amtes zum ewigen Höllenfeuer - und erinnert sie noch einmal an Gottes Barmherzigkeit.
Gebt den Mann frei und kehrt zurück zu Gott.
Seine Freiheit ist eure Freiheit.
»Sie haben mir eine Adresse genannt«, sagt Ramos gerade.
»Was?«, fragt Keller. Er ist zurück im Büro und hört Paradas Aufruf im Radio.
»Ich sagte, sie haben mir eine Adresse genannt«, wiederholt Ramos. Er hängt sich die Uzi über die Schulter. »Fahren wir.«
Ein Haus irgendwo in der Vorstadt. Ramos kommt mit zwei Broncos, die vollgestopft sind mit DFS-Spezialisten. Die Männer springen heraus. Gewehrfeuer - lange, zerhackte Salven aus den Fenstern. Ramos' Leute werfen sich zu Boden und erwidern sie mit kurzen Feuerstößen. Die Schüsse hören auf. Gedeckt von ihren Leuten, rennen Ramos und zwei andere mit einem Rammsporn auf die Haustür zu und brechen sie auf. Gleich hinter Ramos folgt Keller.
Ernie ist nicht zu sehen. Er schaut in die beiden Zimmer des kleinen Häuschens, aber hier liegen nur zwei tote Gomeros an den Fenstern, jeder mit einem Einschussloch in der Stirn. Ein Verletzter sitzt an die Wand gelehnt, ein weiterer neben ihm, mit erhobenen Händen.
Ramos hält ihm die Pistole an den Kopf.
»Donde?«, fragt er. Wo?
»No se.«
Keller zuckt zusammen, als Ramos abdrückt und Gehirnmasse an die Wand spritzt. »Wieso?«, schreit Keller.
Ramos hört ihn nicht. Er nimmt sich den Verletzten vor, hält ihm die Pistole an die Schläfe.
»Dónde?«
»Sinaloa.«
»Donde?«
»Un rancho de Gúero Méndez.«
»Como lo encuentro?«
Der Gomero schreit. »No sel No sé! No sé! Por favor! Por el amor de Dios!«
Keller packt Ramos beim Handgelenk. »Nicht!«
Ramos schaut ihn an, als wäre er der Nächste. Dann senkt er die Pistole. »Wir müssen diese Farm finden, bevor sie ihn von dort wegbringen. Lass mich diesen Hund erschießen, damit er nicht plaudert.«
Der Gomero bricht in Schluchzer aus. »Por el amor de Dios!«
»Du hast keinen Gott, du elendes Stück Dreck«, sagt Ramos und ohrfeigt ihn. »Te voy a mandar pa'l carajo!«
Ich jag dich zur Hölle.
»Nein«, sagt Keller.
»Wenn die Federales rauskriegen, dass er geplaudert hat, bringen sie Hidalgo woanders hin, bevor wir ihn finden.«
Wenn wir ihn finden, denkt Keller. Eine Farm in Sinaloa? Das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber den Mann zu erschießen macht die Sache nicht besser.
»Festnehmen und isolieren«, schlägt Keller vor.
»Ay Dios! Qué chingan que eres!«, brüllt Ramos. Mein Gott, du nervst mich!
Aber er befiehlt einem der Leute, den Gomero irgendwo hinzubringen und weiter zu verhören. »Aber lass ihn mit keinem anderen reden, sonst stopf ich ihm deine Eier ins Maul!«
Er wirf einen Blick auf die toten Gomeros auf dem Fußboden.
»Und schafft den Müll raus.«
Adán Barrera hört Paradas Aufruf im Radio.
Des Bischofs vertraute Stimme mischt sich in das rhythmische Stöhnen von Hidalgo.
Dann der Bannfluch der Exkommunikation.
»Scheiß-Aberglaube«, sagt Gúero.
»Das war ein Fehler«, sagt Adán.
Eine Riesendummheit. Eine gewaltige Fehlkalkulation. Die Amerikaner reagieren extremer als befürchtet, machen ihren ganzen wirtschaftlichen und politischen Einfluss in Mexico City geltend. Sie haben die Grenzen geschlossen, Tausende Lastwagen liegen auf den Straßen fest, tonnenweise verfault die frische Ware in der Hitze, die Schäden sind unabsehbar. Und die Yankees drohen damit, Schulden einzufordern, erpressen Mexiko mit dem Weltwährungsfonds und provozieren eine Währungskrise, die dem Peso den Garaus machen kann. Was dazu führt, dass sich selbst unsere gut geschmierten Freunde in Mexico City gegen uns wenden - nur zu verständlich. Polizei, Armee und DFS beugen sich dem amerikanischen Druck und machen Jagd auf alle Kartellmitglieder, deren sie habhaft werden können, stürmen Häuser und Bauernhöfe ... ein DFS-Oberst hat schon einen Verdächtigen zu Tode geprügelt und drei weitere erschossen, heißt es gerüchtweise, also sind für diesen einen Amerikaner schon vier Mexikaner gestorben, und niemanden scheint das zu kümmern - es sind ja nur Mexikaner.
Also ist die Entführung ein gewaltiger Fehler, zumal sie nichts bringt. Sie wissen immer noch nicht, wer Chupar ist.
Der Amerikaner weiß es auch nicht. So viel ist klar.
Er hätte es verraten. Das Knochenkitzeln hätte er nicht durchgestanden, nicht die Elektroden, nicht die Eisenstange. Und jetzt liegt er stöhnend im Schlafzimmer, das zur Folterkammer gemacht wurde, und selbst der Doktor wirft das Handtuch und sagt, mehr kann er nicht aus ihm rausholen. Währenddessen sind mir die Yankees schon auf den Fersen, zusammen mit ihren mexikanischen Lakaien, und sogar mein alter Pfarrer schickt mich zur Hölle.
Gebt den Mann frei und kehrt zurück zu Gott. Seine Freiheit ist eure Freiheit. Vielleicht, denkt Adán. Vielleicht hat er recht.
Ernies Welt hat sich auf zwei Punkte reduziert.
Hier der Schmerz, da die Abwesenheit von Schmerz, mehr ist nicht.
Wenn das Leben Schmerz bedeutet, ist es schlimm.
Wenn der Tod Schmerzfreiheit bedeutet, ist es gut.
Er versucht zu sterben. Ein Tropf mit Kochsalzlösung erhält ihn am Leben. Wenn er einzuschlafen droht, spritzen sie ihm Lidocain. Sie überwachen seinen Herzschlag, seinen Puls, seine Temperatur, sie sorgen dafür, dass er am Leben bleibt, dass der Schmerz bleibt.
Immer dieselben Fragen: Wer ist Chupar? Was hat er dir erzählt? Welche Namen hat er genannt? Welche Politiker? Wer ist Chupar?
Und immer dieselben Antworten: Ich weiß es nicht. Ich hab alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Er hat keine Namen genannt, ich weiß es nicht.
Gefolgt von mehr Schmerzen, medizinischer Behandlung und wieder Schmerzen.
Dann eine neue Frage.
Völlig unvermittelt eine neue Frage und ein neues Wort.
Was ist Kerberos? Was weißt du über Kerberos? Hat Chupar mit dir über Kerberos geredet? Was hat er gesagt?
Ich weiß es nicht. Nein, hat er nicht. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott.
Was ist mit Keller? Hat er über Kerberos gesprochen? Hat er das Wort erwähnt? Hast du ihn mit anderen über Kerberos sprechen hören?
Kerberos, Kerberos, Kerberos...
Du kennst also das Wort.
Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Gott, hilf mir. Gott, hilf mir. Bitte lieber Gott, hilf mir.
Der Doktor geht hinaus, lässt ihn allein mit dem Schmerz und der Frage Wo ist Gott, wo ist Arthur? Wo sind Jesus, Maria, der Heilige Geist? Maria, sei mir gnädig.
Die Gnade kommt in Gestalt des Doktors.
Das war Rauls Idee.
»Scheiße, dieses Gestöhne macht mich fix und fertig«, hat er zum Doktor gesagt. »Kannst du ihm nicht das Maul stopfen?«
»Ich könnte ihm was geben.«
»Gib ihm was«, sagt Adán. Auch ihm geht das Stöhnen an die Nieren. Und wenn sie ihn wirklich freilassen, dann im bestmöglichen Zustand. Sein Zustand ist zwar alles andere als gut, aber besser als tot. Und Adán hat eine Idee, wie sie den Yankee zurückgeben und dafür kriegen können, was sie wollen.
Sie müssen sich nur mit Keller kurzschließen.
»Heroin?«, fragt der Doktor.
»Du bist der Arzt«, sagt Raúl.
Heroin, denkt Adán. Einheimische Ware. Mexican Mud. Welche Ironie.
»Setz ihm einen Schuss«, sagt er zum Doktor. Ernie spürt die Nadel im Arm. Der Einstich, das Brennen und dann etwas anderes - die reine Seligkeit. Die Abwesenheit von Schmerz.
Vielleicht nicht ganz. Sagen wir, das Schwinden des Schmerzes, als würde er auf einer Wolke schweben, hoch oben über dem Schmerz. Der Beobachter und der Beobachtete. Der Schmerz ist noch da, aber er ist weit weg.
Eloi, Eloi, ich danke dir.
Mutter Maria Mexican Mud Mmmmmmmmm.
Keller steht mit Ramos im Büro, sie brüten über den Karten von Sinaloa und gleichen sie mit den Geheimdienstberichten über Gúero Méndez und seine Hanffelder ab, damit sie die Suche irgendwie eingrenzen können. Im Fernsehen verkündet ein Sprecher der mexikanischen Staatsanwaltschaft mit feierlicher Stimme: »Das Wort >Drogenmafia< existiert in Mexiko nicht.«
»Der könnte für uns arbeiten«, sagt Keller.
Kann sein, dass dieses Wort in Mexiko nicht existiert, denkt er, aber dafür in den USA. Als sie die Nachricht von Ernies Verschwinden bekamen, hat Dantzler den großen Kokain-Deal auffliegen lassen - in beiden Richtungen.
Adán Barrera ist ihnen zwar durch die Lappen gegangen, als sie sein Drogendepot in San Diego stürmten, aber die Beute ist gigantisch. An der Ostküste hat er ebenfalls einen Volltreffer gelandet und einen Jimmy »Big Peaches« Piccone verhaftet, einen Capo der Cimino-Familie. Das FBI in New York hat ihm alle verfügbaren Überwachungsfotos geschickt, und Keller blättert sie gerade durch, als er etwas sieht, was ihm das Blut gefrieren lässt.
Das Fotos ist offensichtlich vor irgendeinem Mafia-Lokal entstanden, da steht der dicke Jimmy Piccone zusammen mit seinem ebenso dicken kleinen Bruder und ein paar anderen schweren Jungs, und dann steht da noch einer.
Sal Scachi.
Keller wählt Dantzlers Nummer.
»Ja, das ist Salvatore Scachi«, bestätigt Dantzler. »Eine wichtige Figur im Cimino-Clan.«
»Gehört er zur Piccone-Crew?«
»Offenbar gehört er zu keiner Crew«, sagt Dantzler. »Ein Mafioso ohne Geschäftsbereich. Er untersteht Calabrese direkt. Und, halt dich fest, Art. Der Kerl war Oberst der US-Army.« Tod und Teufel, denkt Keller.
»Und noch was, Art. Dieser Piccone alias Jimmy Peaches. Das FBI zapft ihn seit Monaten an. Er plaudert wie ein Wasserfall. Quatscht eine Menge Zeug.«
»Kokain?«
»Logo«, sagt Dantzler. »Und Waffen. Scheint, dass seine Crew dick im Geschäft ist. Sie verschieben geklaute Armeebestände.«
Keller lässt das noch auf sich wirken, da klingelt das andere Telefon. Shag geht sofort ran und ruft ihn an den Apparat, es ist dringend.
Keller bricht das Gespräch mit Dantzler ab und nimmt den anderen Hörer.
»Wir müssen reden.« Es ist Adán.
»Woher weiß ich, dass ihr ihn habt?«
»In seinem Ehering steht Eres toda mi vida.«
Du bist mein ganzes Leben.
»Woher weiß ich, dass er noch lebt?«
»Sollen wir ihn für dich schreien lassen?«
»Nein«, sagt Keller. »Nenn mir den Ort.«
»Die Kathedrale«, sagt Adán. »Padre Juan garantiert uns beiden freies Geleit. Wenn ich einen Cop sehe, ist dein Mann tot.«
Im Hintergrund hört Keller neben Ernies Stöhnen etwas anderes, was ihn noch mehr entsetzt.
»Was weißt du über Kerberos?«
Keller kniet sich in den Beichtstuhl.
Ein Vorhang wird beiseitegeschoben. Das Gesicht hinter dem Gitter kann er nicht erkennen, was vermutlich der Sinn dieses gotteslästerlichen Versteckspiels ist.
»Wir haben dich gewarnt und gewarnt und gewarnt«, sagt Adán. »Und du hast nicht auf uns gehört.«
»Ist er am Leben?«
»Er ist am Leben«, sagt Adán. »Es hängt von dir ab, ob er am Leben bleibt.«
»Wenn er stirbt, bringe ich dich um.«
»Wer ist Chupar?«
Keller ist gefasst auf diese Frage. Wenn er Adán erzählt, dass es keinen Chupar gibt, ist Ernie ein toter Mann. Er muss auf Zeit spielen, also sagt er: »Gebt erst Hidalgo frei.«
»Das wird nicht passieren.«
»Dann haben wir nichts miteinander zu bereden«, sagt Keller, obwohl sein Herzschlag stockt.
Er steht langsam auf, als Adán sagt: »Du musst mir etwas bieten, Keller. Irgendwas, was ich mitnehmen kann.«
Keller kniet wieder hin. Vergib mir, Vater, wenn ich sündige.
»Ich stelle alle Ermittlungen gegen die Federación ein«, sagt er. »Ich verlasse das Land, ich verlasse die DEA.«
Schließlich ist es das, was alle von mir wollen, denkt er. Seine Chefs, die Regierung, seine eigene Frau. Wenn ich diesen dummen Teufelkreis gegen das Leben von Ernie eintauschen kann ...
»Du verlässt Mexiko?«, fragt Adán.
»Ja.«
»Und lässt unsere Familie in Ruhe?« Nachdem du meine Tochter verkrüppelt hast.
»Ja.«
»Woher weiß ich, dass du Wort hältst?«
»Ich schwöre bei Gott.«
»Das reicht mir nicht.« Stimmt, das reicht nicht.
»Ich nehme das Geld«, sagt Keller. »Du eröffnest ein Konto für mich, und ich hebe das Geld ab. Dann lässt du Ernie frei. Sobald er frei ist, sage ich dir, wer Chupar ist.«
»Und verlässt das Land.«
»Ich bleibe keine Sekunde länger als nötig.«
Keller wartet eine Ewigkeit, bis Adán die Sache durchdacht hat. Während er wartet, betet er im Stillen zu Gott und zum Teufel, dass Adán auf den Deal eingeht.
»Hunderttausend«, sagt Adán. »Sie werden telegraphisch an die First Georgetown Bank, Grand Cayman, überwiesen. Ich gebe dir die Kontodaten durch. Du hebst siebzigtausend ab, telegraphisch. Sobald wir die Bestätigung für die Transaktion haben, lassen wir deinen Mann laufen. Und mit dem nächsten Flugzeug verschwindet ihr aus Mexiko. Und noch was, Keller: Komm nie wieder zurück.«
Der Vorhang schließt sich.
Die Wogen steigen höher und höher und zerkrachen auf seinem Körper.
Wogen des Schmerzes.
Ernie braucht mehr Drogen.
Er hört die Tür aufgehen.
Bringen sie neue Drogen?
Oder neue Schmerzen?
Gúero blickt hinab auf den amerikanischen Cop. Seine vielen Wunden sind entzündet und vereitert. Sein Gesicht ist zugeschwollen von den Schlägen. Seine Hände, Füße und Genitalien sind verbrannt von den Elektroden, er liegt in seinem eigenen Dreck, der Gestank ist nicht zu ertragen.
Macht ihn sauber, hat Adán befohlen. Aber wer ist Adán, dass er hier Befehle erteilt? Ich habe schon Leute umgelegt, da hat er noch Bluejeans an Teenager verkauft. Und jetzt kommt er uns mit irgendeinem Deal, ohne Wissen und Erlaubnis von M-i, und will diesen Mann freilassen - im Austausch gegen was? Gegen die leeren Versprechungen eines anderen Yankees? Und was wird der machen, wenn er seinen misshandelten, gefolterten Landsmann sieht? Wen will Adán hier verarschen? Hidalgo kann froh sein, wenn er den Transport überlebt. Und wenn er ihn überlebt, verliert er wahrscheinlich beide Beine, vielleicht auch die Arme. Was für eine Art von Frieden glaubt sich Adán zu erkaufen mit diesem blutenden, stinkenden, faulenden Stück Fleisch?
Er hockt sich neben Hidalgo. »Wir bringen dich nach Hause«, sagt er.
»Nach Hause?«
»Si. Du darfst nach Hause. Schlaf jetzt. Wenn du aufwachst, bist du zu Hause.«
Er stößt die Nadel in Ernies Vene und drückt zu. Das Heroin braucht nur eine Sekunde, um zu wirken. Ernie zuckt, seine Beine schlagen aus. Ein Schuss Heroin, sagt man, ist wie ein Kuss Gottes.
Keller schaut hinab auf Ernies Körper.
Ernie liegt zusammengekrümmt in einer schwarzen Plastikplane am Rand einer Straße in Badiraguato, nackt, mit verbundenen Augen. Getrocknetes Blut klebt an der schwarzglänzenden Folie. Keller sieht die offenen Wunden, die der Eispickel verursacht hat, die Verbrennungen durch die Elektroden, die Spuren der analen Vergewaltigungen, die Einstiche an seinen Armen.
Was habe ich getan?, denkt Keller. Warum muss ein anderer dafür büßen?
Es tut mir leid, Ernie. Es tut mir so unendlich leid.
Und ich zahle es ihnen heim. So wahr mir Gott helfe.
Es wimmelt hier von Polizei. Als Erste kamen die Provinzpolizisten und taten, was sie konnten, um alles niederzutrampeln, alle Spuren zu beseitigen - Reifenprofile, Fußspuren, Fingerabdrücke, jeden Hinweis auf die Täter, die diesen Mord begangen haben. Inzwischen haben die Federales den Fundort unter ihre Kontrolle gebracht und suchen alles noch einmal ab, um sicherzugehen, dass nicht die kleinste Spur übersehen wurde.
Der Comandante wendet sich an Keller: »Keine Sorge, Señor, wir werden nicht ruhen, bis wir herausgefunden haben, wer diese abscheuliche Tat begangen hat.«
»Wir wissen, wer es war«, sagt Keller. »Miguel Angel Barrera.«
Shag Wallace rastet aus. »Verdammt noch mal! Drei Ihrer Leute haben ihn entführt!«
Keller zieht ihn weg. Er drückt ihn gegen das Auto, als ein jeep angerast kommt.
Ramos springt aus dem Jeep, geht zu Keller und sagt: »Wir haben ihn gefunden.«
»Wen?«
»Barrera«, sagt Ramos. »Wir müssen sofort los.«
»Wo ist er?«
»El Salvador.«
»Woher -«
»Offensichtlich hat die kleine Freundin von M-i Heimweh«, sagt Ramos. »Sie hat Mama und Papa angerufen.«
El Salvador
Februar 1985
El Salvador, »Der Erlöser«, ist ein Kleinstaat an der mittelamerikanischen Pazifikküste. Keine Bananenrepublik wie sein östlicher Nachbar Honduras, denkt Keller, sondern eine Kaffeerepublik, deren Plantagenarbeiter als so fleißig gelten, dass man sie die »Deutschen Mittelamerikas« nennt.
Viel hatten sie nie von ihrer harten Arbeit. Die sogenannten Vierzig Familien, gerade mal zwei Prozent der Bevölkerung, besaßen so gut wie alle Anbauflächen, meist in Gestalt großer Fincas. Je mehr Land für den Kaffeeanbau genutzt wurde, umso weniger blieb für die Ernährung, und um die Mitte des 19. Jahrhunderts machte sich unter den Campesinos der Hunger breit.
Keller schaut auf die grüne Landschaft hinab. Aus der Luft sieht alles so friedlich aus, geradezu idyllisch, aber er weiß, dass dort unten gemordet wird. Und das in großem Stil.
Es begann in den frühen achtziger Jahren, als sich viele Campesinos den Gewerkschaften anschlossen oder der FLMN, der Nationalen Befreiungsfront Marti, die unter der Führung von Studenten und Geistlichen für Landreformen und Bürgerrechte eintrat. Die Vierzig Familien reagierten mit der Bildung einer rechtsgerichteten Miliz, genannt ORDEN - das Akronym ergibt das spanische Wort für »Ordnung« -, doch die Ordnung, die sie meinten, war ihre alte Herrschaft.
ORDEN, mehrheitlich aus aktiven salvadorianischen Armeeoffizieren zusammengesetzt, machte sich sofort an die Arbeit. Campesinos, Arbeiter, Schüler, Geistliche verschwanden, ihre Leichen fanden sich irgendwo an Straßenrändern, ihre Köpfe auch auf Schulhöfen - zur Abschreckung für die Bevölkerung.
Die USA, der Doktrin des Kalten Kriegs folgend, zogen mit. Viele ORDEN-Offiziere wurden in der berüchtigten »School of the Americas« ausgebildet. Um FLMN-Guerillas, Bauern, Studenten und Pfarrer zur Strecke zu bringen, benutzte die salvadorianische Armee Bell-Hubschrauber, C47-Transportflugzeuge, Mi6-Gewehre und M6o-Maschinengewehre - alles aus US-Beständen. Es starben viele Guerillas, aber auch Hunderte Schüler, Lehrer, Bauern, Fabrikarbeiter und Geistliche.
Auch die Guerillas waren keine Engel, denkt Keller. Auch sie haben gemordet, haben sich durch Entführungen finanziert. Aber ihre Taten verblassen vor den Verbrechen der gut gerüsteten Armee und ihrer Doppelgängerorganisation ORDEN.
Fünfundsiebzigtausend Tote, denkt Keller, als das Flugzeug in dem Land niedergeht, das zu seinem eigenen Massengrab geworden ist. Eine Million Flüchtlinge, eine weitere Million Obdachlose. Bei einer Bevölkerung von nur fünfeinhalb Millionen.
Die Lobby des Sheraton strahlt vor Sauberkeit.
Gutgekleidete Gäste relaxen in der klimatisierten Lounge oder in der kühlen, dunklen Bar. Hier wirkt alles gepflegt und adrett - man trägt luftiges Leinen, weiße Kleider und Jacketts, passend zum Tropenklima.
Alles sehr nett hier, denkt Keller. Und so amerikanisch.
Überall sieht man Amerikaner. Trinken Bier an der Bar, schlürfen Cola im Coffeeshop, und die meisten von ihnen sind Militärberater. Sie sind in Zivil, bevorzugen aber einen unverkennbar militärischen Look - seitlich geschorene Köpfe, Polohemden, Jeans und Tennisschuhe, auf Hochglanz polierte braune Armeehalbschuhe.
Seit die Sandinisten in Nicaragua an der Macht sind, verwandelt sich das nur um die Ecke gelegene El Salvador zunehmend in ein amerikanisches Militärgetto. Angeblich sind die Amerikaner hier, um die salvadorianische Armee in ihrem Krieg gegen die Guerilla zu beraten, aber sie sollen auch sicherstellen, dass El Salvador nicht der nächste Dominostein wird, der in Mittelamerika umkippt. Also haben wir hier amerikanische Soldaten, die die Salvadorianer beraten, und amerikanische Soldaten, die die Contras beraten, und dazu noch die Spione.
Die Typen von der Firma unterscheiden sich deutlich von den Militärs in Freizeitkluft. Zum einen sind sie besser gekleidet - tragen Maßanzüge mit offenen Hemden ohne Krawatte anstelle der Sportklamotten aus dem Army-Shop -, ihre Frisuren sind gestylt, die Haare ein bisschen lang, ganz nach der neuesten Latino-Mode, an den Füßen tragen sie teure Churchills und Bancrofts. Wenn man einen Spion in Tenniskleidung sieht, denkt Keller, spielt er wirklich Tennis.
Es gibt also hier Militärs und Spione, dann die Botschaftstypen, die entweder nichts von beidem oder beides sind. Sie setzen sich zusammen aus den eigentlichen Diplomaten und Konsularbeamten, die sich um profane Dinge kümmern - Visa, verlorene Pässe, Kinder von Althippies, die wegen Landstreicherei und/oder Drogenmissbrauch verhaftet wurden. Dazu kommen die Kulturattaches, die Sekretäre und Schreibkräfte, dann die Militärattaches, die genauso aussehen wie die Militärberater, nur besser gekleidet sind, und schließlich die Botschaftsangestellten, die nur zum Schein bei der Botschaft arbeiten, in Wirklichkeit aber Spione sind. Sie hocken im Gebäude der Botschaft, hören die Radiosender von Managua ab und sind bestens darauf trainiert, einen kubanischen Akzent - oder besser noch, einen russischen Akzent zu identifizieren. Oder sie »bearbeiten die Straße«, wie sie es nennen, treffen ihre Informanten an Orten wie der Sheraton-Bar, um zu erschnüffeln, welcher Oberst eventuell den nächsten Putsch vorbereitet - und ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist.
Und neben den Militärs, den Spionen, den Botschaftsangehörigen und den Botschaftsspionen gibt es noch die Geschäftsleute.
Kaffeehändler, Baumwollhändler, Zuckerhändler. Die Kaffeehändler sehen aus, als würden sie hierher gehören. Was auch in Ordnung ist, denkt Keller. Ihre Familien betreiben dieses Geschäft seit Generationen. Mit ihrer Gelassenheit erwecken sie den Anschein, als wären sie die eigentlichen Herren hier - die Bar gehört ihnen und den salvadorianischen Kaffeepflanzern, mit denen sie auf der Terrasse lunchen. Die Baumwoll- und Zuckerhändler dagegen sehen aus wie typische amerikanische Handelsreisende. Sie sind hier noch nicht heimisch geworden und wirken ein wenig verunsichert ohne ihre gewohnten Krawatten.
Es gibt also eine Menge Amerikaner in San Salvador, dazu eine Menge reiche Salvadorianer. Die weniger reichen Salvadorianer gehören entweder zum Hotelpersonal oder zur Geheimpolizei.
Geheimpolizei, denkt Keller, was für ein Paradox. Das einzig Geheimnisvolle an den Geheimpolizisten ist, wie sie es schaffen, so sehr aufzufallen. Ihre billigen Klamotten sind schlechte Imitationen dessen, was die Oberschicht trägt, sie versuchen, wie Geschäftsleute auszusehen, doch sie haben die braunen, wettergegerbten Gesichter von Campesinos. Kein Mitglied der Vierzig Familien würde sich, ob geheim oder nicht, bei der Polizei verdingen, daher wirken diese Kerle, die das Kommen und Gehen im Sheraton überwachen, wie Bauern, die zur Hochzeit ihres städtischen Cousins eingeladen sind.
Aber die Geheimpolizei soll ja gar nicht unsichtbar sein, sagt sich Keller, sie soll auffallen. Alle sollen wissen, dass der Große Bruder sie beobachtet und alles registriert.
Ramos findet den Polizisten, nach dem er gesucht hat. Sie ziehen sich zurück, um ihren Deal auszuhandeln. Eine Stunde später sind Keller und Ramos auf dem Weg zu dem Anwesen, wo sich Tío mit seiner Lolita versteckt.
Die Fahrt durch die Vorstädte von San Salvador ist lang und deprimierend. Das Land hat die höchste Bevölkerungsdichte Mittelamerikas, und die Bevölkerung wächst immer weiter, wie es scheint. Da, wo die Straße etwas breiter wird, wird sie von Hütten und Verkaufsständen gesäumt - zusammengenagelt aus Pappe, Wellblech oder Sperrholz oder einfach nur aus Zweigen -, und sie bieten alles feil, was sich Leute, die wenig oder gar nichts haben, leisten können. Verkäufer laufen dem Jeep entgegen, als sie den Gringo auf dem Fahrersitz entdecken. Kinder drängen sich heran, betteln um Nahrung, Geld, alles. Keller muss weiter.
Er muss zu diesem Anwesen durchkommen, bevor Tío wieder verschwindet.
In El Salvador verschwinden ständig Leute.
Manchmal ein paar hundert in einer Woche. Werden von den Todesschwadronen aufgegriffen und verschwinden. Wer zu viele Fragen stellt, verschwindet ebenfalls.
Die Drittwelt-Slums sind alle gleich, denkt Keller. Überall dieser Schlamm oder Staub, je nach Klima und Jahreszeit, überall der Gestank der Holzkohlenfeuer und offenen Kloaken, überall der herzzerreißende Anblick von Hungerkindern mit aufgetriebenen Bäuchen und riesigen Kulleraugen.
Das ist Welten entfernt von Guadalajara, wo ein breiter und relativ wohlhabender Mittelstand die Kluft zwischen Arm und Reich überbrückt. In San Salvador gibt es das nicht, sagt er sich, hier stoßen die Slums direkt an die glitzernden Hochhäuser - wie die Hütten der mittelalterlichen Bauern an die Burgmauern. Nur dass die Burgmauern jetzt von privaten Wachdiensten mit automatischen Gewehren und Maschinenpistolen beschützt werden. Und in der Nacht verlassen die Wachmänner die Burgen, schwärmen aus über die Dörfer - im Jeep, nicht zu Pferde - und schlachten die Bauern ab, lassen die Toten mitten auf den Kreuzungen oder Marktplätzen liegen, vergewaltigen und töten Frauen, erschießen Kinder vor den Augen ihrer Eltern.
Damit die Überlebenden wissen, wo ihr Platz ist.
Ein Mörderland, denkt Keller.
El Salvador.
Der Erlöser - welch ein Hohn.
Das Anwesen liegt in einem Jacarandenhain, dreihundert Meter vom Strand entfernt.
Hinter der stacheldrahtbewehrten Mauer ein Bungalow und Nebengebäude für die Bediensteten. Ein kräftiges Holztor und ein Pförtnerhäuschen sichern die Zufahrt.
Keller und Ramos hocken dicht an der Mauer, dreißig Meter vom Tor entfernt.
Im Schatten des Vollmonds.
Ein Dutzend salvadorianische Einsatzkräfte sind im Abstand um die Mauer postiert.
Erst nach turbulenten Verhandlungen haben sich die Salvadorianer zur Kooperation bereit erklärt, aber nun ist alles geregelt: Sie können sich Barrera holen, ihn in die US-Botschaft bringen und nach New Orleans ausfliegen, wo man ihn wegen Mordes und Verschwörung in Verbindung mit illegaler Verbreitung von Drogen vor Gericht stellen wird.
Ein verschreckter Immobilienhändler, mitten in der Nacht aus dem Bett geholt und in sein Büro gebracht, übergibt dem Einsatzkommando den Grundriss des Anwesens. Der Mann wird isoliert, bis der Einsatz vorüber ist. Keller und Ramos nehmen sich den Grundriss vor und entwerfen einen Plan. Alles muss sehr schnell gehen - bevor Barreras Freunde in der mexikanischen Regierung Wind von der Sache kriegen -, und es muss reibungslos ablaufen. Ohne Aufsehen und Krawall und vor allem ohne salvadorianische Opfer.
Keller schaut auf die Uhr - noch drei Minuten bis fünf.
Die sanfte Brise ist erfüllt vom Duft der Jacaranden - wie in Guadalajara, sagt sich Keller. Überm Mauerrand sieht er die Baumwipfel, die purpurroten Blätter schimmern silbern im Mondlicht. Von ferne hört er das leise Rauschen der Brandung.
Die reinste Liebesidylle, denkt er.
Ein parfümierter Garten.
Das Paradies.
Hoffen wir, dass er diesmal für immer aus dem Paradies vertrieben wird, denkt Keller. Hoffen wir, dass er jäh aus seinen seligen Träumen gerissen wird. Keller malt sich aus, dass Tío mit nacktem Hintern in den bereitstehenden Transporter verschleppt wird, obwohl das eine sehr vulgäre Phantasie ist. Aber je mehr Demütigung, desto besser.
Er hört Schritte nahen, ein Wachmann leuchtet die Mauer mit der Taschenlampe ab. Keller verharrt still, dicht an die Mauer gepresst.
Der Lichtkegel trifft ihn genau in die Augen.
Der Wachmann greift nach der Pistole, doch schon zieht sich eine Stoffschlinge um seinen Hals. Ramos hebt ihn an der Schlinge hoch, bis seine Augen und seine Zunge herausquellen, und lässt ihn bewusstlos zu Boden sinken.
»Der wird wieder«, sagt Ramos.
Keller ist erleichtert. Ein toter Zivilist würde den heiklen Deal mit den Salvadorianern sofort zunichte machen.
Keller schaut erneut auf die Uhr, es wird gerade fünf. Und das Einsatzkommando muss eine Elitetruppe sein, denn auf die Sekunde genau hört er den dumpfen Knall, mit dem das Tor aufgesprengt wird.
Ramos wirft ihm einen Blick zu.
»Deine Waffe.«
»Was?«
»Es ist besser, du nimmst sie in die Hand.«
Keller holt die Pistole aus dem Schulterhalfter und rennt hinter Ramos her, durch das weggesprengte Tor auf das Grundstück. Vorbei an den erschrockenen Bediensteten, die schon am Boden liegen, in Schach gehalten von Mi6-Gewehren. Die Lage des Bungalows hat er in der Aufregung ganz vergessen, also folgt er Ramos, der mit flinken, aber entspannten Schritten vor ihm herläuft und seine Uzi in Hüfthöhe schwenkt.
Auf der Mauer hocken Scharfschützen wie große Krähen, die Gewehre aufs Grundstück gerichtet, bereit, jeden niederzumähen, der zu fliehen versucht. Plötzlich steht er vor der Haustür des Bungalows. Ramos zerrt ihn beiseite und drückt ihn zu Boden, während es ein zweites Mal knallt und die Tür unter Splittern und Krachen aus den Angeln birst.
Ramos feuert ein halbes Magazin in die klaffende Öffnung.
Und geht hinein.
Keller dicht hinter ihm.
Das Schlafzimmer, überlegt er krampfhaft. Wo war das Schlafzimmer?
Pilar richtet sich auf und schreit, als sie durch die Tür kommen.
Zieht die Decke über die Brust und schreit weiter.
Tío - und Keller kann es nicht glauben, es ist absurd - versteckt sich unter der Decke. Er hat die Decke über den Kopf gezogen wie ein Kind, das auf die Vogel-Strauß-Taktik baut. Keller reißt die Decke weg, packt ihn beim Nacken und schleudert ihn aufs Parkett.
Tío ist nicht nackt, er trägt schwarzseidene Boxershorts, die Kellers Bein streifen, als er das Knie in Tíos Kreuz stemmt, sein Kinn nach oben reißt, bis ihm fast der Nackenwirbel bricht, und ihm die Pistole an die rechte Schläfe drückt.
»Tut ihm nichts!« schreit Pilar. »Das hab ich nicht gewollt!«
Tío befreit sein Kinn aus Kellers Umklammerung, reckt den Kopf und starrt das Mädchen an. Voller Hass. Und er sagt nur ein einziges Wort: »Chocho.«
Fotze.
Das Mädchen wird bleich vor Entsetzen.
Keller stößt Tío mit dem Gesicht auf den Boden, das Blut aus der gebrochenen Nase spritzt aufs polierte Parkett.
»Mach schon, wir müssen uns beeilen«, sagt Ramos.
Keller will eine Handfessel vom Gürtel lösen.
»Keine Handfesseln«, sagt Ramos mit unverhohlenem Ärger.
Keller blinzelt verwirrt, dann begreift er. Man erschießt keinen Mann auf der Flucht, wenn er Handfesseln trägt.
»Willst du's hier machen oder draußen?«, fragt Ramos.
Das erwartet er jetzt von mir, denkt Keller. Dass ich Barrera erschieße. Er denkt, ich bin nur deshalb mitgekommen, weil ich ihn eigenhändig erschießen will. Das erwarten jetzt alle von mir, wird ihm klar. Alle DEA-Leute einschließlich Shag - Shag besonders - erwarten, dass er der alten Regel gehorcht: Ein Polizistenmörder wird nicht verhaftet, ein Polizistenmörder stirbt immer auf der Flucht.
Mein Gott. Erwarten die das wirklich von mir?
Tío zumindest tut es. Mit aufreizend ruhiger Stimme sagt er: »Me maravilla que todavía estoy vivo.«
Ich wundere mich, dass ich noch lebe.
Wundere dich nicht zu sehr, denkt Keller und entsichert die Pistole.
»Date prisa«, sagt Ramos. Beeil dich.
Keller zögert. Ramos zündet sich eine Zigarre an. Zwei Soldaten stehen dabei und fragen sich, warum der Gringo so lange zögert. Traut er sich nicht?
Also war der Plan, Tío festzusetzen und in die Botschaft zu bringen, nur eine Finte, denkt Keller. Eine Scharade für die Diplomaten. Ich soll jetzt abdrücken, und alle werden schwören, dass sich Barrera der Festnahme widersetzt hat. Dass er eine Waffe gezogen hat. Dass ich ihn erschießen musste. Und niemand wird die Sache allzu gründlich untersuchen.
»Date prisa.«
Diesmal sagt es Tío, und er klingt angeödet, fast gelangweilt. »Date prisa, sobrino.« Mach schon, Neffe.
Keller packt ihn beim Schopf und reißt ihn hoch. Er muss an Ernie denken, seinen verstümmelten, gefolterten Körper am Straßenrand.
Und flüstert Tío ins Ohr: »Vete al demonio, Tio.« Fahr zur Hölle, Onkel.
»Da treffen wir uns wieder«, antwortet Tío. »Sie wollten dich, Arturo. Ich hab sie überredet, Hidalgo zu nehmen, aus alter Verbundenheit. Ich bin nicht wie du, ich achte meine Verwandten. Ernie Hidalgo ist für dich gestorben. Und jetzt mach schon. Sei ein Mann.«
Kellers Finger krümmt sich um den Abzug. Er ist schwer. Schwerer, als er dachte. Tío grinst zu ihm hoch. Keller spürt den Atem des Bluthunds. Er reißt Tío hoch, stellt ihn auf die Beine. Der grinst ihn an, voller Verachtung. »Was machst du da?«, fragt Ramos.
»Das, was geplant war«, sagt Keller. Er steckt die Pistole weg und legt Tío Handfesseln an. »Gehen wir.«
»Ich mach's für dich, wenn du nicht den Nerv hast«, sagt Ramos.
»Doch, hab ich«, sagt Keller. »Vamonos.«
Einer der Soldaten will Tío eine schwarze Kapuze überziehen. Keller hält ihn zurück und sagt zu Tío: »Todesspritze oder Gaskammer, Tío. Kannst dich schon mal entscheiden.«
Tío grinst.
Grinst ihm ins Gesicht. »Kapuze über«, befiehlt Keller.
Der Soldat zieht ihm die Kapuze über den Kopf und bindet sie zu. Keller packt Tíos auf dem Rücken gefesselte Arme und schiebt ihn hinaus.
Durch den parfümierten Garten.
Nie dufteten die Jacaranden so süß. Widerlich süß, denkt Keller. Wie der Weihrauch in der Kirche, in seiner Kindheit. Erst war der Geruch angenehm, dann wurde ihm ein bisschen übel davon.
So fühlt er sich jetzt auch, während er Tío Richtung Tor schiebt, zur Straße hinaus, wo der Transporter wartet. Nur dass der Transporter inzwischen weg ist und sich zwanzig Gewehrläufe auf ihn richten.
Nicht auf Tío.
Auf ihn, Art Keller.
Reguläre salvadorianische Soldaten und neben ihnen ein Yankee in Zivil, mit glänzenden schwarzen Schuhen. Sal Scachi.
»Keller, ich sagte dir doch, das nächste Mal schieße ich.« Keller blickt sich um und sieht die Scharfschützen auf der Mauer.
»Es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit bei der salvadorianischen Regierung«, sagt Scachi. »Die haben wir geklärt. Und tut mir leid, mein Junge, wir können ihn dir nicht überlassen.«
Während sich Keller noch fragt, wer »wir« sind, nickt Scachi, und zwei salvadorianische Soldaten nehmen Tío die Kapuze ab. Kein Wunder, dass er so ekelhaft gegrinst hat, denkt Keller. Er hat gewusst, dass die Kavallerie nahte.
Ein paar andere Soldaten bringen Pilar heraus. Sie trägt jetzt ein Negligé, das mehr zeigt, als es verhüllt, und die Soldaten gaffen sie unverhohlen an. Als sie an Tío vorbeigeführt wird, schluchzt sie: »Es tut mir leid«.
Tío spuckt ihr ins Gesicht. Die Soldaten halten ihr die Arme auf den Rücken, sie kann die Spucke nicht abwischen.
»Das vergesse ich dir nicht«, sagt Tío.
Die Soldaten führen Pilar zu einem wartenden Transporter.
Tío dreht sich zu Keller um. »Dich vergesse ich auch nicht.«
»Schon gut, schon gut«, sagt Scachi. »Niemand vergisst hier keinen. Don Miguel, ziehen wir was Ordentliches an und verschwinden wir von hier. Und was euch betrifft, Keller und Ramos, die Polizei würde euch liebend gern ins Gefängnis stecken, aber wir haben ihnen gut zugeredet, sie belassen es bei der Ausweisung. Eine Militärmaschine erwartet euch. Wenn also diese kleine Pyjama-Party vorbei ist -«
»Kerberos«, sagt Keller.
Scachi packt ihn beim Arm und zerrt ihn beiseite. »Was zum Teufel hast du da gesagt?«
»Kerberos«, wiederholt Keller. Er ist überzeugt, jetzt hat er die Sache durchschaut. »Ilopongo Airport, Sal? Hangar 4?«
Scachi starrt ihn an, dann sagt er: »Keller, du hast dir gerade einen Spitzenplatz im Olymp der Arschlöcher gesichert.«
Fünf Minuten später sitzt Keller neben Scachi auf dem Beifahrersitz.
»Ich schwöre bei Gott«, sagt Scachi, »wenn es nach mir ginge, würde ich dir sofort eine Kugel in den Kopf schießen.«
Auf dem Ilopongo Airport herrscht reger Betrieb. Militärmaschinen, Hubschrauber, Transportflugzeuge überall, jede Menge Bodenpersonal.
Scachi steuert den Jeep zu einer Reihe von Leichtbauhallen, die fortlaufend nummeriert sind. Das Tor von Hangar 4 gleitet zur Seite, und Scachi fährt hinein.
Hinter dem Jeep schließt sich das Tor.
Auch im Hangar ist eine Menge los. Ein paar Dutzend Männer, manche in Kampfanzügen, andere in Tarnkleidung, aber alle bewaffnet, entladen ein SETCO-Flugzeug. Drei weitere stehen beieinander und reden. Immer wenn man Männer reden sieht, während die anderen arbeiten, denkt Keller, handelt es sich um die Bosse.
Eins der Gesichter kennt er schon.
David Núñez, Ramón Mettes Partner bei der SETCO, Exilkubaner, Schweinebucht-Veteran.
Núñez unterbricht sein Gespräch und geht hinüber zu den aufgestapelten Kisten. Auf seinen Befehl hebelt ein Arbeiter eine der Kisten auf. Keller verfolgt, wie Núñez einen Granatwerfer heraushebt, mit andächtigen Bewegungen, als hielte er ein Heiligtum in den Händen. Verbitterte Menschen gehen anders mit Waffen um als andere, denkt Keller. Die Waffen sind irgendwie an ihre Instinkte gekoppelt, mit ihrem Kopf, ihrem Bauch verdrahtet. Und Núñez hat diesen Blick - er ist verliebt in den Granatwerfer. Sein Stolz und seine Männlichkeit sind am Strand der Schweinebucht geblieben, und die Waffe verkörpert sein Hoffen auf Vergeltung.
Das ist die alte Miami-Connection, denkt Keller, die sich neu aufgestellt hat. Sie schleust das Kokain aus Kolumbien jetzt über Mexiko in die USA. Und die Mafia zahlt mit Waffen für die Contras.
Das mexikanische Trampolin.
Scachi springt aus dem Jeep und geht auf einen jungen Amerikaner zu, einen Offizier in Zivil, wie es aussieht.
Den kenne ich doch, denkt Keller. Aber woher?
Dann meldet sich die Erinnerung zurück. Scheiße, denkt Keller, mit dem habe ich doch Nachteinsätze in Vietnam gemacht. Operation Phoenix. Wie zum Teufel hieß der gleich? Der war Captain, Captain bei den Special Forces ... Craig, genau.
Scott Craig.
John Hobbs hat sich die alte Mannschaft geholt.
Scachi verhandelt mit Craig, zeigt mit dem Daumen auf Keller. Keller winkt und lächelt. Craig geht ans Funkgerät, und dort findet eine weitere Absprache statt. Im Hintergrund stapeln sich Kokain-Pakete bis zur Decke.
Nach einer Weile kommen Scachi und Craig auf ihn zu.
»Das wolltest du doch sehen, Keller«, sagt Scachi. »Bist du jetzt glücklich?«
»Klar doch. Ich sterbe vor Glück.«
»Die Scherze werden dir vergehen«, sagt Scachi.
Craig mustert Keller mit einem vernichtenden Blick.
Aber der Blick funktioniert nicht. Craig sieht aus wie ein Pfadfinder, denkt Keller. Kindergesicht, kurzes Haar, nett und harmlos. Ein Pfadfinder, der ums Abzeichen »Dope gegen Waffen« kämpft.
»Die Frage ist«, sagt Craig zu Keller, »ob du teamfähig bist.« Das wäre neu, denkt Keller.
Und Scachi denkt offenbar das Gleiche. »Keller ist eher der Cowboytyp«, sagt er. »Allein in der weiten Prärieeeee...«
»Kein guter Ort«, sagt Craig. »... vom Winde verweht sein Grab.«
»Ich habe alle Ermittlungen in einem Schließfach deponiert«, lügt Keller. »Wenn mir was passiert, geht das Material an die Washington Post.«
»Der alte Bluff«, sagt Scachi.
»Willst du's drauf ankommen lassen?«
Scachi dreht sich weg und geht hinüber zum Funkgerät. Kommt wenig später zurück und befiehlt: »Zieht ihm die Kapuze über!«
Keller weiß, er liegt auf der offenen Ladefläche eines Autos, eines Jeeps wahrscheinlich, nach dem Geholpere zu urteilen. Wo immer sie ihn hinbringen, es muss weit entfernt sein, denn ihm ist, als ginge es schon seit Stunden so. Jedenfalls fühlt es sich so an, aber er weiß es nicht genau, weil er seine Uhr nicht sieht und auch sonst nichts, und jetzt begreift er, wozu eine solche Kapuze gut ist. Sie soll einschüchtern, verunsichern, desorientieren. Dass er nicht sehen, aber hören kann, stürzt ihn von einer Angst in die nächste, jedes Geräusch wird zum Auslöser für neue Schreckensphantasien.
Der Jeep hält, und Keller erwartet das metallische Scharren eines Gewehrbolzens, das Entsichern einer Pistole oder - schlimmer noch - das Zischen einer Machete, die erst die Luft durchschneidet, dann -
Er hört die Gangschaltung, der Jeep macht einen Sprung vorwärts und fährt weiter. Jetzt fängt Keller an zu zittern. Seine Beine zucken unkontrolliert, er kann das nicht stoppen, und er kann nicht verhindern, dass ihm die Bilder von Ernies geschundenem Leib vor Augen treten. Er kann nicht verhindern, dass er denken muss: Tut mir nicht an, was ihr ihm angetan habt, oder, in logischer Konsequenz: Foltert lieber ihn als mich.
Er schämt sich, kommt sich vor wie ein Schuft. Wenn es hart auf hart kommt, wenn das Schrecklichste bevorsteht, möchte er, dass sie es lieber einem anderen antun als ihm. Er könnte nicht für Ernie einstehen, selbst wenn er wollte.
Er versucht, sich an das Bußgebet zu erinnern, das ihm die Nonnen in der Grundschule eingetrichtert haben - wenn du ohne geistlichen Beistand sterben musst, kannst du trotzdem in den Himmel kommen, wenn du ganz aufrichtig das Bußgebet sprichst. Daran erinnert er sich, aber nicht an das verdammte Bußgebet selbst.
Der Jeep hält, der Motor tuckert im Leerlauf.
Hände packen Keller bei den Armen, er wird aus dem Jeep gehoben. Er spürt Laub unter den Füßen, stolpert über eine Ranke, aber die Arme halten ihn fest. Er begreift, dass sie ihn in den Dschungel führen. Dann drücken ihn die Arme nach unten, in die Knie. Viel Kraft ist dafür nicht nötig - seine Knie fühlen sich an wie Butter.
»Kapuze ab.«
Keller kennt den knappen Befehlston. Das ist die Stimme von John Hobbs, Regionalchef der CIA.
Sie befinden sich in einer Art Militärbasis, einem Trainingscamp, wie es aussieht, mitten im Dschungel. Rechts quälen sich Rekruten in Tarnanzügen über die Hindernisbahn - mehr schlecht als recht. Links sieht er ein schmales Rollfeld, wie aus dem Dschungel herausgeschnitten. Und direkt vor sich das schmale, markante Gesicht von lohn Hobbs, sein dichtes weißes Haar, die hellblauen Augen, das verächtliche Lächeln. »Handfesseln auch.«
Keller spürt, wie frisches Blut durch seine Handgelenke strömt. Dann das schmerzhafte Prickeln in den Fingern. Mit einer Handbewegung fordert ihn Hobbs auf, ihm zu folgen. Sie betreten ein Zelt mit ein paar Klappstühlen, Tisch und Pritsche.
»Setzen Sie sich, Arthur.«
»Ich stehe lieber noch eine Weile.«
Hobbs zuckt die Schultern. »Arthur, Sie sollten bedenken, dass wir Sie längst aufgegeben hätten, wenn Sie nicht zur >Familie< gehören würden. Also, was soll dieser Unsinn mit dem Schließfach?«
Jetzt weiß Keller, dass es geklappt hat, dass sein letztes Stoßgebet ins Schwarze getroffen hat. Wäre der Drogenumschlagplatz in Hangar 4 nur das Werk von Abtrünnigen, hätten sie ihn gleich auf der Straße liquidiert. Keller wiederholt seine Drohung.
Hobbs starrt ihn bohrend an. »Was wissen Sie über Red Cloud?«, fragt er.
Was zum Teufel ist Red Cloud?, fragt sich Keller.
»Ich weiß nur über Kerberos Bescheid«, sagt er. »Und was ich weiß, reicht aus, um Sie lebenslang hinter Gitter zu bringen.«
»Ich stimme mit Ihrer Analyse überein«, sagt Hobbs. »Wie stehen wir also zueinander?«
»Wie zwei, die sich gegenseitig an der Gurgel haben«, sagt Keller. »Wir können beide nicht loslassen.«
»Gehen wir ein Stück.«
Sie laufen durchs Camp, vorbei an der Hindernisbahn, dem Schießstand, den Dschungellichtungen, wo Rekruten mit ihren Ausbildern Nahkampftaktik üben.
»Das gesamte Trainingscamp«, sagt Hobbs, »hat Miguel Angel Barrera finanziert.«
»Donnerwetter.«
»Barrera weiß, worum es geht.«
»Und worum geht es?«
Hobbs führt ihn einen schmalen Pfad hinauf zu einer Hügelkuppe und zeigt auf die endlose Dschungellandschaft, die sich unter ihnen erstreckt.
»Was sehen Sie hier?«, fragt Hobbs.
Keller zuckt die Schultern. »Regenwald.«
»Was ich hier sehe«, sagt Hobbs, »ist die Kamelnase. Sie kennen doch das alte arabische Sprichwort: Wenn das Kamel die Nase ins Zelt steckt, ist es schon drin. Das da unten ist Nicaragua, die kommunistische Kamelnase im mittelamerikanischen Zelt. Nicht auf einer Insel wie Kuba, die wir mit der Navy isolieren können, sondern auf dem amerikanischen Festland. Sind Sie geographisch bewandert?«
»Geht so.«
»Dann werden Sie wissen, dass die nicaraguanische Südgrenze, an der wir uns hier befinden, nur ein paar hundert Meilen vom Panama-Kanal entfernt ist. Im Norden grenzt Nicaragua an das labile Honduras und an das noch labilere El Salvador, und beide Länder kämpfen gegen kommunistische Aufstände. Ebenso Guatemala. Guatemala wäre der nächste Dominostein. Wenn Sie sich gut auskennen, werden Sie wissen, dass zwischen Guatemala und den südlichen Regionen von Mexiko nur ein wenig bergiger Dschungel liegen. Das sind Armutsregionen, bevölkert von landlosen Bauern, den willigen Opfern der kommunistischen Propaganda. Und wenn Mexiko den Kommunisten in die Hände fällt, was dann, Arthur? Kuba ist schon gefährlich genug. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass sich die Vereinigten Staaten eine zweitausend Meilen lange Grenze mit einem sowjetischen Satellitenstaat teilen müssen. Stellen Sie sich sowjetische Langstreckenraketen in Jalisco, Durango und Baja California vor.«
»Und Sie meinen, als Nächstes ist Texas dran?«
»Nein, sie werden nach Westeuropa vorstoßen«, sagt Hobbs. »Weil sie wissen, dass selbst die Vereinigten Staaten nicht die militärische Stärke und die Mittel besitzen, neben der mexikanischen Zweitausendmeilengrenze auch noch die Fulda-Lücke zu verteidigen.«
»Das ist doch Irrsinn.«
»Wirklich?«, entgegnet Hobbs. »Die Sandinisten exportieren bereits Waffen für die FLMN nach El Salvador. Aber so weit müssen Sie gar nicht denken. Nicaragua ist in der Hand der Russen und reicht von Küste zu Küste. Stellen Sie sich sowjetische U-Boote auf der Pazifik-Seite vor, im Golf von Fonseca, oder auf der Atlantik-Seite, im Golf von Mexiko. Die können den ganzen Golf und die ganze Karibik zum sowjetischen Hoheitsgebiet machen. Denken Sie daran, wie schwer es war, die Raketensilos in Kuba zu entdecken. In den Bergen von Nicaragua sind die noch schwerer aufzuspüren. Von dort schaffen es die Mittelstreckenraketen ohne weiteres bis nach Miami, New Orleans oder Houston, und uns bleibt kaum Zeit für den Gegenschlag. Ganz zu schweigen von der Bedrohung durch U-Boot-gestützte Mittelstreckenraketen, die irgendwo im Golf von Fonseca oder in der Karibik abgeschossen werden. Wir können die Russen in Nicaragua nicht dulden. So einfach ist das. Die Contras sind bereit, den Job zu erledigen, oder wollen Sie lieber unsere amerikanischen Jungs im Dschungel kämpfen und sterben sehen, Arthur? Sie haben die Wahl.«
»Und wofür soll ich mich entscheiden? Für Drogen schmuggelnde Contras? Exilkubanische Terroristen? Salvadorianische Todesschwadrone, die Frauen und Kinder, Priester und Nonnen ermorden?«
»Ich weiß, sie sind brutal, heimtückisch und bösartig«, sagt Hobbs. »Nur die Kommunisten sind schlimmer.«
»Schauen Sie auf den Globus«, redet Hobbs weiter. »In Vietnam sind wir davongelaufen, und die Kommunisten haben genau die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Sie haben Kambodscha erobert, im Vorbeigehen. Und wir haben nichts unternommen. Sie sind in Afghanistan einmarschiert, und wir haben wieder nichts getan, außer ein paar Sportler aus den Wettkämpfen abgezogen. Das war Afghanistan, als Nächstes kommt Pakistan, dann Indien, und dann ist Feierabend, Arthur - dann ist ganz Asien rot. Mozambique, Angola, Äthiopien, Irak, Syrien - alles sowjetische Marionetten. Und wir rühren keinen Finger. Wunderbar, sagen die sich. Wollen wir doch mal sehen, ob sie auch bei Mittelamerika stillhalten. Als Nächstes kassieren sie Nicaragua, und was ist unsere Antwort? Das Boland-Amendment. Keine Unterstützung der Contras.«
»Das ist geltendes Recht.«
»Das ist Selbstmord«, sagt Hobbs. »Nur Idioten oder der Kongress kapieren nicht, was es bedeutet, eine sowjetische Marionette im Herzen Mittelamerikas zu dulden. Diese Dummheit spottet jeder Beschreibung. Wir mussten einfach handeln, Arthur.«
»Also zeichnet die CIA dafür verantwortlich, dass -«
»Die CIA zeichnet für gar nichts verantwortlich«, sagt Hobbs. »Das versuche ich Ihnen doch gerade zu erklären, Arthur. Hinter Kerberos steht unser oberster Chef.«
»Ronald Reagan -«
»- ist wie Churchill. In einem kritischen Moment der Geschichte hat er die Tatsachen klar erkannt und sich entschlossen, zu handeln.«
»Wollen Sie mir erzählen -«
»Über Details ist er natürlich nicht informiert«, sagt Hobbs. »Er hat uns nur befohlen, die kommunistische Flut in Mittelamerika einzudämmen und das Sandinistenregime zu stürzen, mit allen dafür nötigen Mitteln. Ich werde Ihnen das Wort für Wort vorlesen, Arthur. Direktive Nummer drei des Nationalen Sicherheitsrats überträgt dem Vizepräsidenten die Vollmacht für die Bekämpfung der in Lateinamerika operierenden kommunistische Terroristen. In dieser Funktion hat der Vizepräsident die TIWG gegründet - die Arbeitsgruppe Terrorismus mit Sitz in El Salvador, Honduras und Costa Rica, die wiederum die NHAO gegründet hat - die Aktion Humanitäre Hilfe -, welche im Einklang mit dem Boland-Amendment dazu dient, nicaraguanische Flüchtlinge, also die Contras, humanitär zu unterstützen. Operation Kerberos läuft nicht über die Firma - da liegen Sie falsch -, sondern direkt über das Büro des Vizepräsidenten. Scachi untersteht mir direkt, und ich unterstehe dem Vizepräsidenten.«
»Warum erzählen Sie mir das?«
»Ich appelliere an Ihren Patriotismus.«
»Das Land, dem ich diene, verbündet sich nicht mit Verbrechern, die unsere eigenen Leute zu Tode foltern.«
»Reden wir doch mal über Ihren Pragmatismus«, sagt Hobbs. Er holt Papiere aus der Tasche. »Bankauszüge. Überweisungen auf Ihre Konten auf den Cayman-Inseln, in Costa Rica, in Panama ... alle von Miguel Ángel Barrera.«
»Davon weiß ich nichts.«
»Auszahlungsbelege«, sagt Hobbs. »Mit Ihrer Unterschrift.«
»Das war ein Deal, zu dem ich gezwungen war.«
»Das kleinere Übel«, sagt Hobbs. »Genau. Ich verstehe Ihr Dilemma vollkommen. Und jetzt bitte ich Sie, unser Dilemma zu verstehen. Sie wahren Ihr Geheimnis, wir wahren unseres.«
»Fick dich.«
Keller dreht sich um und läuft den Weg zurück. »Keller, wenn Sie denken, dass wir Sie einfach so laufen lassen -«
Keller hält den Mittelfinger hoch und läuft weiter.
»Wir müssen zu irgendeiner Übereinkunft kommen.«
Keller schüttelt den Kopf. Die können sich ihre Dominotheorie sonstwohin stopfen, sagt er sich. Kann mir Hobbs etwas bieten, was Ernies Tod aufwiegen würde?
Nichts kann er mir bieten. Nicht das Geringste kann er einem Mann bieten, der alles verloren hat - seine Familie, seinen Job, seinen Freund, seine Hoffnung, sein Vertrauen, den Glauben an sein Land. Es gibt nichts, was ihm noch etwas bedeutet.
Wirklich nicht?
Doch, eins gibt es noch. Keller begreift, dass Kerberos kein Wachhund ist, sondern ein Höllenhund. Ein geifernder, zähnefletschender Bluthund, der ihn hineinlockt in die Unterwelt.
Und er kann nicht widerstehen.
6 Erschüttert in den Grundfesten
... Und schob die Riegel von massivem Eisen
Und festen Felsen ohne Mühe weg.
Die Höllentore flogen plötzlich auf
Mit ungestümem Prallen und Geräusch;
In ihren Angeln kracht ein dumpfer Donner,
Dass tief der Hölle Grund erzitterte.
John Milton, Das verlorene Paradies
Mexico City
19. September 1985
Jemand rüttelt am Bett.
Das Rütteln mischt sich in ihre Träume, dann wird sie wach und merkt: Das Bett wackelt wirklich.
Nora schreckt hoch und schaut auf den Wecker, aber es ist schwer, die Ziffern zu erkennen, weil sie vibrieren, sich fast verflüssigen vor ihren Augen. Sie hält den Wecker fest - es ist acht Uhr achtzehn. Dann merkt sie, dass es der Nachttisch ist, der wackelt, dass alles wackelt - der Tisch, die Lampen, der Sessel, das Bett.
Ihr Zimmer befindet sich im siebenten Stock des Regis Hotel, einer hübschen alten Sehenswürdigkeit auf der Avenida Juárez nahe dem Alameda-Park im Herzen der Stadt. Sie wohnt hier als Gast eines Ministers, er hat sie eingeladen, um mit ihr den Unabhängigkeitstag zu feiern, und jetzt, drei Tage danach, ist sie immer noch hier. Der Minister fährt abends nach Hause zu seiner Frau. An den Nachmittagen kommt er zu ihr ins Regis, um seine Unabhängigkeit zu feiern.
Nora denkt, sie schläft vielleicht noch, das Ganze ist ein Traum, dann schwanken die Wände.
Bin ich seekrank?, fragt sie sich. Ihr wird schwindlig und übel, und es kommt noch schlimmer, als sie aus dem Bett steigt und nicht stehen kann, weil der Fußboden unter ihr zu wogen scheint.
Ein Blick in den großen Spiegel sagt ihr, dass sie nicht krank aussieht. Es ist nur so, dass ihr Kopf im Spiegel wackelt, bis sich der Spiegel krümmt und in Scherben fällt.
Sie nimmt die Arme hoch, um ihre Augen vor den Splittern zu schützen. Dann hört sie das laute Prasseln von Regen, aber das ist kein Regen, das ist Schutt aus den oberen Stockwerken. Und jetzt rutscht der Fußboden unter ihr weg wie die beweglichen Metallplatten auf dem Rummelplatz, nur ist das hier kein Rummel, das ist ernst.
Könnte sie das Hotel von draußen sehen, würde sie noch mehr erschrecken. Es scheint zu flattern wie eine Fahne im Wind und biegt sich durch, bis es tatsächlich mit dem Nachbarhaus zusammenstößt. Doch sie kann es hören. Sie hört das dumpfe Krachen, dann stürzt die Wand hinter ihrem Bett ein, sie reißt die Tür auf und rennt in den Flur.
Draußen bebt sich Mexico City zu Tode.
Die Stadt ist auf dem Grund eines ausgetrockneten Sees errichtet, auf weichem Boden, unter dem die große tektonische Cocos-Platte ständig ihre Lage verändert. Die Stadt und ihr weicher, lockerer Untergrund liegen gerade mal zweihundert Meilen vom Rand der Cocos-Platte und einer der weltgrößten tektonischen Verwerfungen entfernt - dem Mittelamerikanischen Graben, der unter dem Pazifik verläuft und sich vom mexikanischen Seebad Puerto Vallarta bis nach Panama erstreckt.
Seit jähren schon kommt es zu kleineren Erbeben an den nördlichen und südlichen Rändern der Platte, aber nicht in der Mitte, nicht in der Nähe von Mexico City, weshalb die Geologen von einer »seismischen Lücke« sprechen. Die Geologen vergleichen das mit einer Kette von Knallfröschen, die an beiden Enden explodieren, aber nicht in der Mitte. Früher oder später, sagen sie, wird auch die Mitte Feuer fangen und explodieren.
Es beginnt dreißig Kilometer unter der Erdoberfläche. Seit urdenklichen Zeiten will sich die Cocos-Platte absenken, unter den Rand der Platte, die sich östlich von ihr befindet, und an diesem Morgen endlich gelingt es ihr. Vierzig Meilen von der Küste entfernt, zweihundertvierzig Meilen westlich von Mexico City, bricht die Erdkruste auf und sendet ein gewaltiges Beben durch die Lithosphäre.
Wäre die Stadt dem Epizentrum näher gewesen, hätte sie es vielleicht besser ausgehalten. Die Hochhäuser hätten die schnellen Erschütterungen und Vibrationen in der Nähe des Epizentrums vielleicht überlebt. Die Gebäude wären in die Höhe gesprungen und hätten Risse bekommen, aber sie wären vielleicht stehen geblieben.
Doch wenn sich das Beben vom Ursprung entfernt, zerstreut sich seine Energie, und das macht es wider alle Erwartung noch gefährlicher - wegen des weichen Untergrunds. Das Beben verläuft sich in langen, langsamen Wellenbewegungen - in einer Serie von Riesenwellen, wenn man so will, die das Seebett durchlaufen, auf dem die Stadt erbaut ist. Der Untergrund wird zu einer Schale mit Götterspeise, und die Götterspeise beginnt zu schwappen und mit ihr die Gebäude, die sich nun hin und her bewegen statt auf und ab - und das ist das Problem.
Jede Etage der Hochhäuser neigt sich weiter zur Seite als die Etage darunter. Die kopflastig gewordenen Gebäude schlagen förmlich aus, stoßen die Köpfe zusammen und schwingen wieder zurück. Zwei lange Minuten schwanken sie hin und her, dann brechen sie einfach zusammen.
Betonplatten krachen auf die Straßen, Scheiben bersten, riesige, zerklüftete Glasscherben zischen durch die Luft wie Geschosse. Innenwände stürzen ein, mit ihnen die tragenden Stützen, Dach-Swimmingpools ergießen ihre Wasserfluten über die darunterliegenden Dächer und bringen sie zum Einsturz.
Manche Hochhäuser knicken über dem vierten oder fünften Stockwerk einfach ein und kippen Beton, Steine und Stahl von drei, acht oder gar zwölf Etagen auf die Straßen, reißen Menschen mit in die Tiefe und begraben sie unter dem Schutt.
Ein Haus nach dem anderen - zweihundertfünfzig in vier Minuten - wird von den Wellen erfasst. Die Regierung wird im wahrsten Sinne des Wortes gestürzt - die Flottenverwaltung, die Handelsabteilung, das Verkehrsministerium - alles bricht in sich zusammen. Das Touristenzentrum ein einziger Trümmerhaufen - Hotel Monte Carlo, Hotel Romano, Hotel Versailles, das Roma, das Bristol, das Ejecutivo, das Palacio, das Reforma, das Inter-Continental und das Regis -, alles verschwindet. Die obere Hälfte des Hotel Caribe bricht ab wie ein Streichholz, kippt Matratzen, Koffer, Vorhänge und Gäste auf die Straße. Ganze Viertel werden praktisch vom Erdboden verschluckt - Colonia Roma, Colonia Doctores, Unidad Aragón und die Wohnanlage Tlatelolco, die von einem zwanzigstöckigen Wohnhaus zermalmt wird. Mit einer besonders grausamen Volte zerstört das Beben auch das Allgemeine Krankenhaus und das Juárez-Krankenhaus, tötet und verschüttet Kranke und die dringend benötigten Ärzte und Schwestern.
Nora weiß nichts von alldem. Sie rennt auf den Flur, wo sich herausgefallene Zimmertüren ineinander verkanten wie die Karten eines einstürzenden Kartenhauses. Eine Frau rennt vor ihr her und drückt auf den Fahrstuhlknopf.
»Nein!«, schreit Nora.
Die Frau dreht sich um, mit angstgeweiteten Augen. »Nicht den Fahrstuhl«, sagt Nora. »Zur Treppe.« Die Frau starrt sie wortlos an.
Nora versucht es auf Spanisch, aber die Wörter fallen ihr nicht ein.
Plötzlich öffnet sich die Fahrstuhltür, und Wasser strömt heraus - wie in einem grotesken Horrorfilm. Die Frau dreht sich zu Nora um, lacht und sagt »agua«.
»Vamos«, sagt Nora. »Vamónos, wie auch immer. Kommen Sie!«
Sie nimmt die Frau bei der Hand und will sie durch den Flur ziehen, aber die Frau rührt sich nicht von der Stelle. Sie entzieht ihr die Hand und drückt wieder und wieder auf den Fahrstuhlknopf.
Nora lässt sie stehen und findet die Tür zum Treppenhaus. Der Boden wogt und wellt sich unter ihren Füßen. Im Treppenhaus kommt sie sich vor wie in einem schwankenden Schacht. Sie wird von einer Seite zur anderen geworfen, während sie die Stufen hinabrennt. Vor ihr sind jetzt Leute und hinter ihr auch, die Treppe bevölkert sich. Geräusche, entsetzliche Geräusche hallen im Treppenschacht wider: Krachen, Bersten, das Ächzen eines Hauses, das zerrissen wird - und Schreie -, Schreie von Frauen, die gellenden Schreie von Kindern. Sie sucht Halt am Geländer, aber das bewegt sich auch.
Von Treppenabsatz zu Treppenabsatz versucht sie, die Etagen zu zählen, dann gibt sie es auf. Sind es drei, vier oder fünf? Sie weiß, dass sie sieben schaffen muss. Idiotischerweise weiß sie nicht, wie die in Mexiko gezählt werden. Fangen sie mit dem Erdgeschoss an zu zählen oder mit dem ersten Stock?
Egal, nichts wie runter, sagt sie sich und wird von einer schrecklichen Schlingerbewegung gegen die linke Wand geworfen. Sie hält die Balance, fasst wieder Tritt. Einfach weiterrennen, die Treppe runter, raus hier, bevor alles über dir zusammenbricht.
Aus irgendeinem Grund muss sie an die steilen Treppen des Montmartre denken, man kann auch die Seilbahn benutzen, sie läuft aber, weil es gut für die Wadenmuskeln ist und auch, weil es ihr Spaß macht und sie sich dann zur Belohnung eine Chocolat chaud in dem drolligen Café am Fuß der Treppen genehmigt. Da will ich wieder hin, denkt sie, im Straßencafe sitzen, mich vom Kellner anlächeln lassen, die Leute beobachten, die lustige Kathedrale Sacre Coeur dort oben sehen, die aussieht wie aus Zucker gesponnen.
Denk an so was, denk an so was, nicht daran, in dieser Falle zu sterben, dieser schwankenden, von Menschen vollgestopften Todesfalle. Gott, wird das heiß hier drinnen, mein Gott, schrei nicht so, das nützt nichts, halt lieber die Klappe, ah, endlich ein Luftzug, jetzt stauen sich die Leute vor ihr, dann bricht der Stau auf, und sie wird mit einem ganzen Pulk in die Lobby gespült.
Kronleuchter fallen von der Decke wie faule Früchte und zerkrachen auf dem Kachelboden. Sie läuft über Scherben zu den Drehtüren, die sind total verstopft, sie muss gar nicht pressen, schieben, weil andere hinter ihr nachschieben. Wieder ein frischer Lufthauch, wunderbar, sie sieht trübes Sonnenlicht, ist schon fast draußen -
Da bricht das Hotel über ihr zusammen.
Er liest gerade die Messe, als es geschieht.
Zehn Meilen vom Epizentrum entfernt, in der Kathedrale von Ciudad Guzmán, hebt Erzbischof Parada die Hostie in die Höhe und spricht das Gebet. Es gehört zu den Annehmlichkeiten und Privilegien des Erzbischofs der Erzdiözese Guadalajara, dass er hier in dieser kleinen Stadt gelegentlich die Messe lesen kann. Er liebt die klassische churriguereske Bauweise der Kathedrale, die Verschmelzung des spanischen Barock mit den heidnischen Motiven der Maya und Azteken, wie es sie nur in Mexiko gibt. Zwei barocke Türme mit präkolumbianischen Turmhauben flankieren die große, mit bunten Kachelmustern verzierte Kuppel. Auch jetzt, während er den Blick auf den Retablo hinterm Altar richtet, sieht er die vergoldeten Schnitzereien - europäische Putten neben landestypischen Früchten, Blumen und Vögeln.
Diese Farbenfülle, diese Liebe zur Natur, diese Lebenslust ist es, was ihn an der mexikanischen Spielart des Katholizismus so sehr begeistert, die unbekümmerte Vermischung heidnischer Symbolik mit einem innigen, unerschütterlichen Christusglauben. Das ist nicht die trockene, nüchterne Religion des europäischen Intellektualismus mit ihrem Hass auf alles Natürliche. Nein, die Mexikaner besitzen die angeborene Weisheit, die seelische Spannweite - wie soll man sagen -, um diese und auch die nächste Welt mit einer einzigen Umarmung zu vereinen.
Das ist ganz hübsch formuliert, denkt er und dreht sich zur Gemeinde um. Vielleicht kann ich das in meine nächste Predigt einbauen.
Obwohl heute Donnerstag ist, sind ziemlich viele Leute da - weil er aus Guadalajara gekommen ist, um die Messe zu zelebrieren. Und ich bin selbstsüchtig genug, mich darüber zu freuen, denkt er. Es stimmt, er ist ein enorm beliebter Erzbischof - er geht auf die Menschen zu, teilt ihre Sorgen, ihre Freuden, ihre Mahlzeiten. Die Mahlzeiten besonders, denkt er. Wohin er auch kommt, und er kommt überallhin, kennt man seinen Appetit, und er kennt ihre Scherze: »Stellt einen breiten Stuhl an den Kopf der Tafel, Erzbischof Juan kommt zum Essen!«
Er legt der vor ihm knienden Frau eine Hostie auf die Zunge.
Da fängt der Boden unter ihm an zu hüpfen.
Genau so fühlt es sich an. Wie ein Stoß von unten. Dann noch einer und noch einer, bis sich alle Stöße zu einer Serie von Erschütterungen vereinen.
Er spürt etwas Nasses auf dem Ärmel. Blickt nach unten und sieht den Wein aus dem Kelch hüpfen, den der Messknabe neben ihm in der Hand hält. Er legt dem Knaben den Arm um die Schulter.
»Immer unter den Rundbögen lang«, sagt er, »und dann raus. Geht jetzt alle, aber ganz ruhig.«
Der Knabe steigt die Altarstufen hinab.
Parada wartet. Er wird hier stehen bleiben und warten, bis sich die Kirche geleert hat. Nur die Ruhe bewahren, sagt er sich. Bist du ruhig, sind sie es auch. Wenn es zur Panik kommt, treten sie sich gegenseitig tot.
Also bleibt er und schaut umher.
Die geschnitzten Tiere erwachen zum Leben.
Sie rütteln und schütteln sich.
Nicken hektisch mit den Köpfen, wie zur Bestätigung. Aber was bestätigen sie?, fragt er sich. Draußen wackeln die zwei Türme.
Sie sind aus Sandstein errichtet, wunderschön verziert von Künstlern dieser Gegend. So viel Liebe wurde in die Ornamente hineingelegt, so viel Sorgfalt. Aber sie stehen in der Stadt Guzmán, in der Provinz Jalisco. Der Name Jalisco geht auf die taraskanischen Ureinwohner zurück und bedeutet »sandige Gegend«. Die Steine, aus denen die Türme gebaut wurden, sind hart und eben, aber der Mörtel ist bröcklig wie der Sand von Jalisco.
Er widerstand dem Wind und dem Regen, auch der Zeit, aber einem Beben der Stärke 7,8, das von einer tektonischen Verschiebung in dreißig Kilometern Tiefe und nur fünfzehn Kilometern Entfernung ausgeht, widersteht er nicht.
Während also die Gemeinde geordnet die Kirche verlässt, beginnen die Türme zu wackeln, und die losen Steine stürzen hinab auf die Urenkel der Männer, die sie einst errichtet haben. Die Türme durchschlagen die kachelverzierte Kuppel und begraben fünfundzwanzig Kirchgänger unter sich.
Weil die Kirche an diesem Morgen gut besucht war.
Aus Liebe zu Erzbischof Juan.
Der vorm Altar steht, unversehrt, gebannt vor Schock und Entsetzen, während die Menschen vor ihm von einer Wolke aus gelbem Staub verschluckt werden.
Die Hostie hält er noch in der Hand.
Den Leib Christi.
Nora wird aus den Trümmern geborgen.
Ein Stahlträger hat ihr das Leben gerettet. Er fiel diagonal auf ein Stück Mauer und hielt einen anderen Träger davon ab, sie zu zerquetschen. Hinterließ einen kleinen Hohlraum und ein bisschen Luft unter dem Schutt des Hotel Regis, so dass sie wenigstens atmen kann.
Nicht, dass sie viel davon hat, denn die Luft besteht vor allem aus Staub.
Sie würgt, sie hustet, sie sieht nichts, aber sie kann hören. Sind Minuten vergangen oder Stunden? Sie weiß es nicht, und sie fragt sich, ob sie jetzt tot ist. Ob sie in der Hölle gelandet ist, eingezwängt in ein enges, heißes, dunkles Loch voller Staub. Ich bin tot, denkt sie, tot und begraben. Von irgendwo kommen Schreie und Stöhnen, sie fragt sich, ob das nun immer so weitergeht. Ob das die Ewigkeit ist. Die Hölle, in der eine Hure landet.
Sie hat gerade so viel Platz, dass sie den Kopf auf die Arme legen kann. Vielleicht kann ich so schlafen, denkt sie. Die Ewigkeit durchschlafen. Aber sie hat Schmerzen, ihr linker Arm ist blutverklebt, dann fällt ihr der zerborstene Spiegel ein, mit den Scherben, die auf sie niedergeprasselt sind. Ich bin nicht tot, denkt sie, und betastet das feuchte Blut. Menschen, die bluten, sind nicht tot.
Ich bin nicht tot. Ich bin lebendig begraben.
Dann kommt die Panik.
Sie fängt an zu hecheln und weiß, dass sie zu viel Sauerstoff verbraucht, aber sie kann es nicht ändern. Der Gedanke, lebend begraben zu sein - ihr fällt diese alberne Geschichte von Poe ein, die sie aus der Schule kennt. Die Kratzspuren unterm Sargdeckel ...
Sie möchte schreien.
Sinnlos, sagt sie sich, schade um die Luft. Dann schreit sie einfach nur »Hilfe!«
Wieder und wieder. So laut sie kann. Irgendwann Sirenen, Schritte im Geröll über ihr. »Hilfe!«
Ein Klopfen, dann: »Donde estas?«
»Direkt hier!«, schreit sie, überlegt kurz, dann: »Aquú« Jetzt hört und spürt sie, wie über ihr Schutt weggeräumt wird. Kommandos, Warnungen. Sie streckt die Hand nach oben, so weit sie kann. Eine Sekunde später die unglaubliche Wärme einer Hand, die nach ihr greift. Sie fühlt sich hochgezogen, herausgezogen, und dann, wundersamerweise, steht sie im Freien. Na ja, so gut wie. Über ihr ragt noch eine Art Gewölbe. Wände und Säulen neigen sich in irren Winkeln. Wie in einem Ruinenmuseum.
Ein Bergungsarbeiter stützt sie, betrachtet sie neugierig.
Dann riecht sie etwas, einen widerlich süßen Geruch. Mein Gott, was ist das?
Ein Funke bringt das Gas zur Explosion.
Nora hört einen scharfen Knall, ein dumpfes Dröhnen, das ihr Herz stocken lässt, und sie schlägt der Länge nach hin. Als sie aufblickt, ist überall Feuer. Als würde die Luft brennen, sich als Feuerwalze auf sie zubewegen.
Die Männer schreien. »Vamonos! Ahorita!«
Schnell weg!
Einer packt sie wieder am Arm und schiebt sie vor sich her, sie rennen. Flammen überall, brennende Trümmerteile fallen herab, sie hört knisternde Geräusche, es riecht verbrannt, ein Mann schlägt ihr auf den Kopf, und sie merkt, dass ihre Haare brennen, aber sie spürt es nicht. Der Ärmel des Mannes fängt Feuer, er schiebt sie trotzdem weiter, und plötzlich sind sie unter freiem Himmel, sie will sich fallen lassen, aber der Mann erlaubt es nicht, er stößt sie weiter vor sich her, denn hinter ihnen stürzen die Überreste des Hotel Regis in sich zusammen.
Zwei andere Männer schaffen es nicht. Sie zählen zu den 128 Helden, die beim Versuch, Verschüttete zu retten, ihr Leben ließen.
Nora weiß das noch nicht, als sie über die Avenida Benito Juárez stolpert, in die relative Sicherheit des Alameda-Parks. Sie sinkt in die Knie, während ihr eine Verkehrspolizistin einen Mantel über den Kopf wirft und das Feuer erstickt.
Nora schaut zurück. Das Hotel Regis ist ein brennender Trümmerhaufen. Das Kaufhaus Salinas y Rocha nebenan sieht aus wie mittendurch geschnitten. Rote, grüne, weiße Wimpel, die Dekorationen des Unabhängigkeitstags, flattern über der entkernten Hülse des Gebäudes. Soweit ihr Blick die Staubwolken durchdringt, sind die Häuser eingestürzt oder geborsten, die Straßen übersät mit riesigen Trümmerstücken, Beton und Stahlträgern.
Und überall Menschen.
Sie knien im Park und beten.
Der Himmel ist schwarz von Rauch und Staub.
Die Sonne ist verfinstert, und ringsum hört Nora den gleichen Satz: »El fin del mundo.«
Der Weltuntergang.
Noras rechte Kopfhälfte ist schwarz verschmort, ihr linker Arm blutet und ist voller winziger Glassplitter. Und während der Schock abklingt, setzen die Schmerzen ein.
Parada kniet über den Toten.
Verabreicht ihnen posthum die Sterbesakramente.
Eine lange Reihe von Toten hat er noch vor sich. Fünfundzwanzig Leichen, notdürftig verhüllt mit Decken, Tischtüchern, Handtüchern - allem, was sich fand. Sie liegen aufgereiht vor der eingestürzten Kathedrale, während Verzweifelte in den Trümmern nach ihren Angehörigen suchen, unter den alten Steinen wühlen, in der Hoffnung auf Lebenszeichen.
Unablässig murmelt Parada die lateinischen Gebetsformeln, aber in seinem Herzen ...
Etwas ist in ihm zerbrochen, zerrissen wie die Erde bei diesem Beben. Ein Grabenbruch hat sich zwischen mir und Gott aufgetan, denkt er.
Das kann er den Leuten nicht sagen - es wäre grausam. Sie erwarten von ihm, dass er die Seelen ihrer Angehörigen gen Himmel schickt. Er darf sie nicht enttäuschen, nicht jetzt, auch später nicht. Die Menschen brauchen Hoffnung, und die darf ich ihnen nicht nehmen. Ich bin nicht so grausam wie Du, denkt er.
Also spricht er seine Gebete. Salbt die Toten mit Öl und fährt mit den Sakramenten fort.
Von hinten naht ein Priester. »Padre Juan?«
»Sie sehen doch, ich hab zu tun.«
»Sie werden gebraucht, in Mexico City.«
»Ich werde hier gebraucht.«
»Es gibt Anweisungen, Padre Juan.«
»Anweisungen von wem?«
»Vom päpstlichen Nuntius«, sagt der Priester. »Es werden alle einbestellt, damit die Hilfe organisiert werden kann. Sie haben schon Erfahrungen damit, daher -«
»Ich habe hier Dutzende von Toten zu -«
»Es gibt Tausende von Toten in Mexico City.«
»Tausende?«
»Genaue Zahlen haben wir nicht«, sagt der Priester. »Und Zehntausende Obdachlose.«
Das ist ein Argument, denkt Parada. Die Lebenden gehen vor. »Sobald ich hier fertig bin«, sagt er.
Sie lässt sich nicht helfen.
Eine Menge Leute versuchen es - Polizisten, Sanitäter -, aber Nora will sich nicht verarzten lassen.
»Ihr Arm, Señorita, Ihr Kopf -«
»Unsinn«, sagt sie. »Vielen hier geht es viel schlechter.« Mir tut alles weh, denkt sie, aber es geht mir gut. Komisch, sagt sie sich, gestern hätte ich noch gedacht, das ist ein Widerspruch. Ihr Arm tut weh, ihr Kopf tut weh, ihr Gesicht fühlt sich an wie nach einem schlimmen Sonnenbrand, aber es geht ihr gut.
Sie ist voller Kraft. Schmerzen?
Ach was! Hier sterben Menschen. Sie will keine Hilfe, sie will helfen.
Also setzt sie sich hin und polkt vorsichtig die Glassplitter aus ihrem Arm, dann spült sie ihn an einem geborstenen Wasserrohr ab. Reißt einen Ärmel von dem Leinenpyjama ab, den sie noch immer trägt (und ist froh, dass sie lieber Leinen trägt anstelle der feinen Seide), umwickelt ihren Arm. Dann reißt sie den anderen Ärmel ab und bindet sich Mund und Nase zu, um sich vor dem Staub und dem Rauch zu schützen - und dem Geruch ...
Dem Geruch des Todes.
Wer ihn nicht kennt, hat keine Vorstellung davon. Doch wer ihm ausgeliefert war, vergisst ihn nie wieder.
Sie zieht den Knoten fester und macht sich auf die Suche nach irgendwelchen passenden Schuhen. Das ist nicht allzu schwer, denn das Warenhaus hat seinen Inhalt praktisch auf die Straße gekippt. Dass sie sich ein Paar Flipflops aneignet, wertet sie nicht als Plünderei (geplündert wird hier nicht - trotz der verbreiteten Armut unter der Stadtbevölkerung). Sie schließt sich einem Helfertrupp an, der in den Trümmern des Hotels nach Überlebenden sucht. Es gibt Hunderte von diesen Trupps, Tausende freiwillige Helfer, die sich überall in der Stadt durch die eingestürzten Häuser arbeiten, mit Schaufeln, Spitzhacken, Eisenstangen und bloßen Händen, um zu den Verschütteten vorzustoßen. Sie tragen die Toten und Verletzten hinaus, in Decken, Laken, Duschvorhängen, und tun alles, um den hoffnungslos überforderten Rettungsteams zu helfen. Andere Freiwillige sind damit beschäftigt, die Straßen freizuräumen, befahrbar zu machen für Krankenwagen und Feuerwehren. Feuerwehrhubschrauber seilen Männer über brennenden Gebäuden ab, damit sie Menschen retten können, die von unten nicht zu erreichen sind.
Aus den Radiolautsprechern tönen die Namen der Toten und der Überlebenden - eine endlose Litanei, begleitet von Klagelauten und Freudengeheul.
Es gibt noch andere Geräusche. Stöhnen, Jammern, Beten, Schreien, Hilferufe - Stimmen, die aus den Ruinen kommen. Die Stimmen der Verschütteten.
Also suchen die Helfer weiter, stumm und erschöpft. Neben Nora arbeitet ein Trupp Pfadfindermädchen - kaum älter als neun Jahre, denkt Nora beim Anblick ihrer ernsten, entschlossenen Mienen. So jung - und tragen schon das Gewicht der Welt. Auch die Pfadfinderjungen, Fußballmannschaften, Bridgeclubs oder Einzelpersonen wie Nora schließen sich zusammen.
Ärzte und Krankenschwestern, die wenigen, die nach dem Einsturz der Krankenhäuser noch im Einsatz sind, durchsuchen die Trümmer mit Stethoskopen, versenken sie in die Hohlräume, um nach Lebenszeichen zu forschen. Wenn sie so weit sind, bitten die Helfer lautstark um Ruhe, Motoren und Martinshörner werden abgeschaltet, alle werden still. Dann kann es sein, dass der Arzt lächelt oder nickt, und die Mannschaften rücken an, um schnell, aber behutsam Schutt, Steine, Beton und Stahlträger beiseitezuräumen - manchmal mit dem Ergebnis, dass tatsächlich ein Mensch lebend aus den Trümmern geborgen wird, oft aber geht es traurig aus - sie kommen nicht schnell genug voran und finden nur noch einen leblosen Körper.
So oder so, sie arbeiten weiter.
Den ganzen Tag und die ganze Nacht.
In der Nacht legt Nora eine Pause ein. Bei der Rettungsstelle im Park bekommt sie eine Tasse Tee und eine Scheibe Brot. Der Park ist voll von Menschen, die obdachlos geworden sind, und solchen, die aus Angst vor Nachbeben lieber draußen übernachten. Er ähnelt jetzt einem gewaltigen Flüchtlingslager - was er ja auch ist, denkt Nora.
Befremdend daran ist nur die Stille. Die Radios sind leise gedreht, die Menschen flüstern ihre Gebete, sprechen mit gedämpfter Stimme, wenn sie mit ihren Kindern reden. Es gibt keinen Streit, kein Gedränge, keinen Kampf um die knappen Vorräte. Die Leute stehen geduldig Schlange, bringen den Alten und Kindern zu essen, helfen anderen beim Wasserschleppen, beim Aufbauen von Zelten und Unterständen, beim Graben von Latrinen. Leute, die noch eine Wohnung haben, bringen Decken, Töpfe, Pfannen, Essen, Kleidung.
Eine Frau bringt Nora Jeans und ein Flanellhemd.
»Nehmen Sie.«
»Das kann ich nicht annehmen.«
»Es wird kalt.« Nora nimmt die Sachen. »Danke. Gracias.«
Hinter einem Baum zieht sie sich um. Niemals haben sich Sachen so gut angefühlt. Das Flanell schmiegt sich wärmend an ihre Haut. Sie hat ganze Schränke voller Sachen zu Hause, denkt sie, das meiste davon nur ein- oder zweimal getragen. Jetzt würde sie einiges geben für ein Paar Socken. Sie hat gewusst, dass die Stadt sehr hoch liegt, aber jetzt in der Kälte der Nacht spürt sie es auch. Sie fragt sich, wie es den Menschen unter den Trümmern ergeht, ob auch sie die Kälte spüren.
Nachdem sie sich gestärkt hat, bindet sie sich das Tuch wieder vor und geht zurück zur Ruine ihres Hotels. Kniet sich neben einen Mann mittleren Alters und hilft ihm beim Wegräumen von Schutt.
Parada durchschreitet die Hölle.
Überall wüten Feuer. Frisch genährt aus zerbrochenen Gasleitungen, erhellen sie die stygische Finsternis jenseits der ausgebrannten Ruinen. Der beißende Rauch, der würgende Gestank nach Verwesung, nach verbranntem Fleisch, auch nach Fäkalien, denn die Kanalisation ist verstopft.
Es wird immer schlimmer, während er weitergeht und auf Kinder trifft, die umherirren und weinend nach ihren Eltern rufen. Manche in Unterwäsche oder Schlafsachen, andere in Schuluniform. Im Vorbeigehen sammelt er sie ein. Einen kleinen Jungen trägt er auf dem Arm, ein Mädchen hält er bei der Hand, und das Mädchen hält ein anderes Kind an der Hand, das wieder ein anderes Kind an der Hand hält - und so geht es weiter.
Als er zum Alameda-Park kommt, hat er mehr als zwanzig Kinder um sich versammelt. Er sucht nach dem Zelt der katholischen Rettungsstelle.
Dort fragt er einen Monsignore: »Haben Sie Antonucci gesehen?«
Kardinal Antonucci meint er, den päpstlichen Nuntius, den höchsten Vertreter des Papstes in Mexiko.
»Der liest die Messe in der Kathedrale.«
»Die Stadt braucht jetzt keine Messe«, sagt Parada. »Wir brauchen Strom und Wasser, Lebensmittel, Blutkonserven und Blutplasma.«
»Die geistlichen Belange der Gemeinde -«
»Si, si, si, si«, sagt Parada und läuft weiter. Er muss nachdenken, seine Gedanken ordnen. Es gibt so viel zu organisieren, so viele Menschen mit so vielen Nöten. Er holt seine Zigarettenschachtel heraus und will sich eine anstecken.
Eine scharfe Stimme aus dem Dunklen lässt ihn zusammenzucken. Eine Frauenstimme. »Machen Sie das Feuer aus! Sind Sie verrückt?«
Er pustet das Streichholz aus. Knipst seine Taschenlampe an und leuchtet die Frau an. Ein wirklich hübsches Gesicht, trotz Ruß und Staub.
»Die Gasleitungen«, sagt sie. »Wollen Sie uns in die Luft sprengen?«
»Es brennt doch überall«, sagt er.
»Wollen Sie, dass es hier auch brennt?«
»Nein, sicher nicht«, sagt Parada. »Sie sind Amerikanerin.«
»Ja.«
»Da sind Sie aber schnell gewesen.«
»Ich war schon hier, als es losging«, sagt sie.
»Ah.«
Er mustert sie von oben bis unten. Etwas längst Vergessenes regt sich in ihm. Die Frau ist klein, aber sie hat etwas von einer Kriegerin. Sie will kämpfen, weiß nur nicht, wogegen und wie.
Genauso wie ich, denkt er und streckt ihr die Hand entgegen.
»Juan Parada.«
»Nora.«
Einfach Nora. Kein Nachname. »Wohnen Sie in Mexico City, Nora?«
»Nein, ich bin geschäftlich hier.«
»Welche Art von Geschäft?«
Sie blickt ihm direkt in die Augen. »Ich bin ein Callgirl.«
»Bitte? Ich verstehe nicht -«
»Eine Prostituierte.«
»Ah.«
»Und Sie?«
Er lächelt. »Ich bin Priester.«
»Sie sind nicht gekleidet wie ein Priester.«
»Und Sie nicht wie eine Prostituierte«, erwidert er. »Eigentlich ist es noch viel schlimmer. Ich bin Bischof. Erzbischof.«
»Ist das etwas Besseres als Bischof?«
»Wenn Sie nach dem Rang urteilen«, sagt er. »Als Pfarrer war ich glücklicher.«
»Warum werden Sie es dann nicht wieder?«
Wieder lächelt er. »Ich wette, Sie sind ein sehr erfolgreiches Callgirl.«
»Stimmt«, sagt Nora. »Und ich wette, Sie sind ein sehr erfolgreicher Erzbischof.«
»Eigentlich denke ich eher ans Aufhören.«
»Warum?«
»Ich weiß nicht, ob ich noch glaube.«
Nora zuckt die Schultern. »Dann tun Sie so.«
»Ich soll nur so tun?«
»Es ist ganz leicht«, sagt sie. »So mach ich's auch immer.«
»Ah. Ohhh, ich verstehe.« Parada spürt, dass er rot wird. »Aber warum soll ich so tun?«
»Wegen der Macht«, sagt Nora. Und weil er so verwirrt reagiert, fügt sie hinzu: »Ein Erzbischof hat doch ziemlich viel Macht, oder?«
»In mancher Hinsicht schon.«
Nora nickt. »Ich schlafe mit vielen mächtigen Männern. Und wenn die befehlen, wird es befolgt.«
»Und?«
»Und?« Sie zeigt mit dem Kopf auf den Park. »Dort gibt es eine Menge zu tun.«
»Aha.«
Kinder sagen die Wahrheit, denkt Parada. Von Prostituierten ganz zu schweigen.
»War schön, mit Ihnen zu reden«, sagt er. »Wir sollten in Verbindung bleiben.«
»Eine Hure und ein Bischof?«
»Sie kennen offenbar die Bibel nicht«, sagt Parada. »Neues Testament. Maria Magdalena. Schon mal gehört?«
»Nein.«
»Jedenfalls steht unserer Freundschaft nichts im Wege«, sagt er und fügt hastig hinzu: »Ich meine, dieser Art von Freundschaft. Ich habe ein Gelübde abgelegt... ich meine einfach, es wäre schön, wenn wir Freunde würden.«
»Das finde ich auch.«
Er zieht eine Karte aus der Tasche. »Rufen Sie mich an, wenn sich die Dinge beruhigt haben?«
»Klar, mache ich.«
»Gut. Dann will ich mal weiter. Ich hab zu tun.«
»Ich auch.«
Er kehrt zurück ins katholische Rettungszelt.
»Notieren Sie die Namen dieser Kinder«, befiehlt er einem Padre. »Dann vergleichen Sie die Namen mit den Listen der Toten, Vermissten und Überlebenden. Irgendwo muss es auch eine Suchliste für Kinder geben.«
»Wer sind Sie denn?«, fragt der Padre.
»Ich bin der Erzbischof von Guadalajara«, sagt er. »Nun setzen Sie sich mal in Bewegung. Und suchen Sie jemanden, der den Kindern Essen und Decken gibt.«
»Ja, Euer Hochwürden.«
»Und ich brauche ein Auto.«
»Hochwürden?«
»Ein Auto«, sagt Parada. »Das mich zur Nuntiatur bringt.« Die päpstliche Nuntiatur, Antonuccis Residenz, liegt im Süden der Stadt, weit von den zerstörten Vierteln entfernt. Dort wird es Elektrizität geben, die Lampen werden brennen und, wichtiger noch, die Telefone werden funktionieren.
»Viele Straßen sind blockiert, Euer Hochwürden.«
»Und viele sind frei«, sagt Parada. »Sie sind ja immer noch hier!«
Zwei Stunden später, als der päpstliche Nuntius Kardinal Girolamo Antonucci in die Residenz zurückkehrt, findet er seine Bediensteten in Aufruhr und Erzbischof Parada in seinem Büro. Er hat die Füße auf dem Schreibtisch gelagert, zieht an einer Zigarette und brüllt Befehle ins Telefon.
Als Antonucci eintritt, blickt er auf.
»Können Sie uns noch etwas Kaffee besorgen?«, fragt er. »Das wird eine lange Nacht.« Und ein langer Tag.
Sündige Genüsse.
Heißer, starker Kaffee. Ofenfrisches Brot.
Und Gott sei Dank ist Antonucci Italiener und raucht, denkt Parada, während er den sündigsten seiner Genüsse in die Lunge einsaugt.
Er schaut seinen Rauchwolken nach und hört Antonucci zu, der die Tasse abstellt und zum Innenminister sagt: »Ich habe mit Seiner Heiligkeit persönlich gesprochen, und er hat mich gebeten, der Regierung seines geliebten mexikanischen Volkes zu versichern, dass der Vatikan stets bereit ist, jede erdenkliche Hilfe zu gewähren, ungeachtet des Umstands, dass wir noch immer nicht in den Genuss regulärer diplomatischer Beziehungen zur mexikanischen Regierung gelangt sind.«
Antonucci sieht aus wie ein Vogel, denkt Parada.
Wie ein winziges Vögelchen mit einem neckischen kleinen Schnabel.
Vor acht Fahren hat Rom ihn nach Mexiko entsandt, auf dass er die Regierung nach über hundert Jahren antiklerikaler Politik in den Schoß der katholischen Kirche zurückführe. 1856 hatte die Ley Lerdo die riesigen kirchlichen Besitzungen enteignet und verkauft. Die revolutionäre Verfassung von 1857 hatte die mexikanische Kirche entmachtet, und der Vatikan vergalt es mit der Exkommunizierung aller Mexikaner, die den Eid auf die Verfassung leisteten.
Seitdem herrscht zwischen dem Vatikan und der mexikanischen Regierung ein labiler Waffenstillstand. Reguläre Beziehungen wurden nicht wiederaufgenommen, aber selbst die rabiatesten Sozialisten der PRI - der Partido Revolucionario Institucional, unter deren pseudodemokratischer Herrschaft Mexiko seit 1917 regiert wird, wagten es nicht, die Kirche in diesem bäuerlichen Land gänzlich zu verbieten. Sie beließen es bei kleineren Störmanövern wie dem Verbot klerikaler Trachten, aber meist einigten sich beide Seiten zähneknirschend auf eine gemeinsame Linie.
Es war aber immer das Ziel des Vatikans geblieben, seinen regulären Status in Mexiko wiederherzustellen, und als Kirchenpolitiker des erzkonservativen Flügels predigt Antonucci den mexikanischen Bischöfen unablässig, »dass wir die gläubigen Mexikaner nicht an den gottlosen Kommunismus verlieren dürfen«.
Da ist es nur natürlich, dass Antonucci im Erdbeben eine willkommene Gelegenheit sieht, denkt Parada. Dass er den Tod Zehntausender Gläubiger als gottgegebenes Mittel versteht, die mexikanische Regierung in die Knie zu zwingen.
Die Not zwingt die Regierung, eine Menge Kröten zu schlucken. Sie wird sich dazu herablassen müssen, Hilfe von den Amerikanern anzunehmen, und sie wird auch vor der Kirche zu Kreuze kriechen - das Geld liegt schon bereit.
Und wir werden es ihnen geben.
Geld, das wir von den Gläubigen nehmen, den reichen und den armen, seit Jahrhunderten. Unversteuerte Kollektegroschen, gewinnbringend investiert. Doch das Land, das am Boden liegt, denkt Parada, muss einen Preis dafür bezahlen, wenn es das Geld zurückhaben will, das ihm zuvor genommen wurde.
Christus würde weinen.
Geldwechsler im Tempel?
Wir sind die Geldwechsler im Tempel.
»Sie brauchen Geld«, sagt Antonucci zum Innenminister. »Sie brauchen es schnell, und es wird Ihnen schwerfallen, Kredite zu bekommen, da es um die Kreditwürdigkeit Ihrer Regierung nicht zum Besten steht.«
»Wir geben Staatsanleihen aus.«
»Wer soll die kaufen?«, fragt Antonucci mit einem selbstgefälligen Lächeln. »Mit Ihrer Verzinsung können Sie niemanden locken. Schon die bestehenden Schulden können Sie nicht bedienen, geschweige denn zurückzahlen. Wir müssen es wissen, wir besitzen stapelweise mexikanische Papiere.«
»Die Gebäude sind versichert«, sagt der Minister.
»Unterversichert«, entgegnet Antonucci. »Ihr eigenes Ministerium duldet den Missstand, dass sämtliche Hotels unterversichert sind, weil es glaubt, damit den Tourismus zu fördern. Das Gleiche bei Warenhäusern und Mietshäusern. Sogar die Regierungsgebäude, die zerstört wurden, sind stark unterversichert. Ein skandalöser Zustand, könnte man sagen. Während also der Vatikan durch Ihre Regierung offiziell geächtet wird, haben die Finanzinstitute eine etwas bessere Meinung von uns. Im Bankenjargon nennt man das, glaube ich, AAA.«
Machiavelli kann nur ein Italiener gewesen sein, denkt Parada.
Wenn diese Erpressungsnummer nicht so niederträchtig und zynisch wäre, müsste man sie bewundern.
Aber für solche Gedanken ist jetzt nicht die Zeit, daher sagt Parada: »Lassen wir den alten Mist, kommen wir zur Sache. Wir sind gern bereit, jede erdenkliche Hilfe zu leisten, finanzielle und materielle, und das auf informeller Basis. Im Gegenzug erlauben Sie unseren Geistlichen, das Kreuz zu tragen und alle Hilfsgüter deutlich als Gaben der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche zu kennzeichnen. Sie übernehmen die Garantie, dass die nächste gewählte Regierung in den ersten dreißig Tagen ihres Amtsantritts ernst gemeinte Verhandlungen zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Kirche und Staat aufnehmen wird.«
»Das ist 1988«, protestiert Antonucci. »Bis dahin sind es fast noch drei Jahre!«
»Rechnen kann ich auch«, sagt Parada und wendet sich wieder an den Minister.
»Wäre das ein Deal?« Ja, das wäre einer.
»Was erlauben Sie sich?«, ruft Antonucci, nachdem der Minister gegangen ist. »Sie können doch hier nicht einfach die Verhandlungen übernehmen. Ich hatte ihn schon an der Leine.«
»Ist das Ihre Aufgabe?«, fragt Parada. »Leute, die in Not sind, an die Leine zu nehmen?«
»Sie haben nicht die Vollmachten, zu -«
»Krieg ich jetzt was mit der Peitsche?«, fragt Parada. »Dann beeilen Sie sich bitte, ich habe zu tun.«
»Sie scheinen zu ignorieren, dass ich Ihr direkter Vorgesetzter bin.«
»Was man nicht anerkennt, kann man nicht ignorieren«, sagt Parada. »Sie sind nicht mein Vorgesetzter. Sie sind ein Politiker, den Rom hierhergeschickt hat, um Politik zu machen.«
»Das Beben war ein Fingerzeit Gottes -«, sagt Antonucci.
»Ich glaube, ich höre nicht recht!«
»- der uns die Gelegenheit bietet, die Seelen von Millionen Mexikanern zu retten.«
»Retten Sie nicht die Seelen, retten Sie die Menschen!«, brüllt ihn Parada an.
»Das ist schiere Ketzerei!«
»Sei's drum!«
Es sind nicht nur die Erdbebenopfer, denkt Parada. Es sind die Millionen, die in Armut leben. Die tatsächlich ungezählten Millionen, die in den Slums von Mexico City leben, die Menschen, die auf den Müllhalden von Tijuana hausen, die landlosen Bauern von Chiapas, die in Wirklichkeit Fronarbeiter sind.
»Für die sogenannte Befreiungstheologie finden Sie bei mir keine Unterstützung«, sagt Antonucci.
»Ist mir egal. Rechenschaft lege ich nicht vor Ihnen ab, sondern vor Gott.«
»Ich kann Sie in einen kleinen feuerländischen Sprengel versetzen lassen. Ein Anruf genügt.«
Parada nimmt den Hörer auf und reicht ihn Antonucci.
»Bitte schön«, sagt er. »Als Gemeindepfarrer am Ende der Welt, das wäre mein Traum. Warum zögern Sie? Dann rufe ich an Ihrer Stelle an. Ich zwinge Sie, Farbe zu bekennen. Ich rufe in Rom an, und dann erzähle ich der Presse in allen Einzelheiten, warum ich versetzt wurde.«
Antonucci bekommt rote Flecken im Gesicht. Der kleine Vogel regt sich auf, denkt Parada. Ich hab ihm das hübsche Gefieder zerzaust. Aber Antonucci beherrscht sich, er wahrt die Fassung und sogar sein selbstgefälliges Lächeln, während er den Hörer wieder auflegt.
»Gute Entscheidung«, sagt Parada mit einer Dreistigkeit, die ihm selbst schon unheimlich wird. »Ich werde diese Hilfsaktion leiten. Ich wasche das Kirchengeld, damit die mexikanische Regierung ihr Gesicht wahren kann, und sorge dafür, dass die Kirche in Mexiko wieder Fuß fasst.«
»Welche Gegenleistung erwarten Sie dafür?«, fragt Antonucci.
»Dass mich der Vatikan zum Kardinal ernennt.«
Denn um Gutes zu tun, braucht man die notwendige Macht.
»Jetzt agieren Sie selbst wie ein Politiker«, sagt Antonucci.
Sehr wahr, denkt Parada.
So soll es sein.
»Also haben wir eine Übereinkunft«, sagt Parada. Jetzt hat sich der Vogel in einen Kater verwandelt, denkt er im Stillen. Einen Kater, der glaubt, er hat den Kanarienvogel gefressen. Antonucci glaubt, ich habe meine Seele verkauft, um Kardinal zu werden. Ein solcher Handel leuchtet ihm ein.
Sei's drum. Soll er's glauben.
Einfach so tun, hatte die hübsche amerikanische Prostituierte gesagt.
Sie hat recht - es ist ganz leicht.
Tijuana
1985
Adán Barrera denkt über den Deal nach, den er gerade mit der PRI gemacht hat.
Eigentlich war es ganz einfach, denkt er. Du gehst mit einer Aktentasche voll Geld zum Frühstück und verlässt den Tisch ohne die Aktentasche. Sie bleibt einfach stehen, wird gar nicht erwähnt, eine stumme Übereinkunft: Obwohl die Amerikaner heftig Druck machen, darf Tío aus dem honduranischen Exil zurückkehren.
Und sich zur Ruhe setzen.
Tío wird nach Guadalajara zurückgehen, seine legalen Geschäfte fortsetzen. Das ist die eine Seite der Übereinkunft. Die andere Seite bedeutet, dass García Ábrego die langersehnte Nachfolge als el patrón antritt. Und vielleicht ist das gar nicht schlecht. Mit Tíos Gesundheit steht es nicht zum Besten, und seit ihn dieses Miststück verraten hat, ist er, offen gesagt, nicht mehr ganz der Alte. Er hat dieses Mädchen weiß Gott innig geliebt, er wollte sie heiraten - und dann das!
Ábrego wird also die Führung der Federación übernehmen, von seiner Region aus, dem Golf von Mexiko. El Verde behält Sonora, Gúero Méndez die Provinz Baja California.
Und die mexikanische Regierung schaut weg.
Dem Erdbeben sei Dank.
Die Regierung braucht Geld für den Wiederaufbau, und im Moment gibt es nur zwei Geldgeber - den Vatikan und die Drogenbarone. Die Kirche hat bereits gezahlt, wie Adán weiß, er wird ebenfalls zahlen. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, und die Regierung wird sich daran halten.
Darüber hinaus wird die Federación kräftig investieren, um sicherzustellen, dass die Regierungspartei, die PRI, die kommenden Wahlen gewinnt, so wie alle Wahlen seit der Revolution. Und gegenwärtig ist Adán dabei, Ábrego bei den Vorbereitungen zu einem Wohltätigkeitsbankett zu helfen, das fünfundzwanzig Millionen Dollar einbringen soll und zu dem alle Drogenbarone und Geschäftsleute Mexikos beitragen werden.
Wenn sie weiter Geschäfte machen wollen.
Und Geschäfte haben wir bitter nötig, denkt Adán. Das Hidalgo-Debakel hat uns gewaltig geschadet. Jetzt ist Arturo zwar aus dem Lande, und die Dinge beruhigen sich, aber es muss eine Menge Geld hereingeholt werden. Und seit unsere Beziehungen nach Mexico City wieder auf festen Füßen stehen, können wir in bewährter Manier weitermachen.
Mit anderen Worten, ich muss Gúero die Baja California abjagen.
Es ist Tíos Idee gewesen, dass sich seine Neffen in Tijuana einnisten sollen.
Wie Kuckuckseier.
Sie sollen langsam wachsen, an Macht und Einfluss gewinnen, um dann Gúero aus dem Nest zu werfen. Und Gúero ist sowieso selten in der Stadt. Er versucht, die Region von seiner Ranch aus zu kontrollieren, überlässt das Tagesgeschäft seinen treuesten Untergebenen, Juan Esparagoza und Tito Mical zum Beispiel.
Und Adán und Raúl Barrera.
Tío hat den Vorschlag gemacht, dass sich Adán und Raúl bei den Sprösslingen der besseren Gesellschaft von Tijuana beliebt machen sollen. »Hängt euch rein in diese Freundschaften, macht euch unentbehrlich, damit Sie euch nicht wegmobben können, ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden.« Macht es langsam, macht es behutsam, damit Gúero nichts davon merkt, aber macht es.
»Fangt mit den Kindern an«, hat er geraten. »Die Alten tun alles, wenn es um den Schutz ihrer Kinder geht.«
Also haben Adán und Raúl eine Charme-Offensive gestartet. Haben sich teuer eingekauft in das Reichenviertel Colonia Hipódromo, und plötzlich sieht man sie überall. Wohin man auch kommt, trifft man auf Raúl Barrera. Geht man in den Club, ist Raúl schon da und übernimmt die Rechnung. Fährt man an den Strand, ist Raúl schon dort und übt mit einem Karate. Will man sich beim Pferderennen amüsieren, ist Raúl schon da und setzt gerade Unsummen auf hochriskante Wetten. Geht man in die Disco, ersäuft Raúl den ganzen Laden in Dom Pérignon. Er schart eine treue Gefolgschaft um sich, die neunzehn- und zwanzigjährigen Söhne von Bankern, Anwälten, Ärzten und Regierungsbeamten. Es dauert nicht lange, und sie treffen sich regelmäßig unter der großen alten Eiche. Parken ihre Autos an der Mauer und quatschen Blödsinn mit Raúl.
Die Eiche heißt einfach nur el arbol, der Baum, und jeder, der mitreden will, treibt sich dort rum.
Auch Fabián Martínez.
Fabián ist der typische Mädchenschwarm.
Aber er sieht nicht aus wie sein Namensvetter, ein abgehalfterter Schlagersänger, sondern wie ein junger, hispanischer Tony Curtis. Fabián ist ein hübscher Junge, und er weiß es. Er hört es seit seinem sechsten Lebensjahr, und jeder Blick in den Spiegel kann es ihm bestätigen. Er ist hochgewachsen, hat einen kupferfarbenen Teint und einen breiten, sinnlichen Mund. Sein üppiges schwarzes Haar trägt er glatt zurückgekämmt. Seine Zähne sind - nach langjähriger, teurer Gebisskorrektur - strahlend weiß, und sein Lächeln ist verführerisch.
Er weiß es und macht eifrig Gebrauch davon.
Eines Abends, als Fabián mit den anderen abhängt, hört er einen sagen: »Wie wär's, wenn wir mal einen umlegen?«
Fabián wechselt einen Blick mit seinem Kumpel Alejandro.
Das ist einfach nur cool.
Könnte direkt von Scarface sein.
Dabei sieht Raúl Barrera gar nicht aus wie Al Pacino. Raúl ist groß und athletisch gebaut, mit massigen breiten Schultern und einer Halsmuskulatur, wie man sie vom Karate-Training kriegt. Heute trägt er eine Lederjacke und eine Basecap von den San Diego Padres. Sein Schmuck allerdings, der könnte von Al Pacino sein. Raúl ist behängt wie ein Weihnachtsbaum - dicke Goldketten am Hals und am Handgelenk: die unvermeidliche goldene Rolex.
Eigentlich, denkt Fabián, sieht Rauls großer Bruder eher wie Al Pacino aus, aber da hört die Ähnlichkeit mit Scarface auch schon auf. Fabián hat Adán Barrera erst ein paarmal getroffen - in einem Nachtclub mit Ramón, bei einem Boxkampf und dann im El Big, dem Hamburger-Lokal auf der Avenida Revolución. Adán sieht nicht aus wie ein Drogenbaron, eher wie ein Buchhalter. Kein Nerzmantel, kein Schmuck, immer ruhig, mit leiser Stimme. Wenn man nicht auf ihn aufmerksam gemacht wird, merkt man gar nicht, dass er da ist.
Raúl hingegen, der ist nicht zu übersehen.
Steht an seinen knallroten Porsche Targa gelehnt und redet ganz locker davon, jemanden umzulegen.
Irgendeinen.
»Habt ihr eine Rechnung offen?«, fragt Raúl. »Wen wollt ihr weggepustet haben?«
Fabián und Alejandro wechseln wieder einen Blick.
Sie sind cuates - Freunde - fast seit ihrer Geburt, mit nur wenigen Wochen Abstand sind sie in derselben Klinik geboren - im Scripps Hospital von San Diego. Das war gegen Ende der sechziger Jahre so üblich in der Oberschicht von Tijuana. Zur Entbindung fuhr man über die Grenze nach San Diego, damit die Kinder in den Genuss der doppelten Staatsbürgerschaft kamen. Daher sind Fabián, Alejandro und die meisten ihrer cuates in den Staaten geboren, im schicken Hipódromo-Viertel hoch über der Innenstadt von Tijuana zusammen in den Kindergarten und in die Vorschule gegangen. Und bevor sie in die fünfte oder sechste Klasse kamen, zogen ihre Mütter mit ihnen nach San Diego, damit sie dort die Schule fortsetzten, Englisch lernten, bikulturell aufwuchsen und die Kontakte knüpften, die für ihre spätere Karriere so wichtig werden würden. Ihre Eltern wussten genau: Tijuana und San Diego sind zwar durch eine Grenze getrennt, wirtschaftlich aber eng verflochten.
Fabián, Alejandro und ihre Freunde besuchten die katholische, nur für Knaben bestimmte Augustine High School in San Diego, ihre Schwestern gingen zu Our Lady of Peace. (Nach einem kurzen Blick auf die öffentlichen Schulen von San Diego beschlossen die Eltern, dass ihre Kinder so bikulturell auch wieder nicht werden sollten.) Also verbrachten sie die Wochen bei den Patres und die Wochenenden zu Hause in Tijuana, feierten ihre Partys im Country Club oder fuhren nach Rosarita und Ensenada an den Strand. Oder blieben manchmal auch in San Diego und machten das, was auch die amerikanischen Teenager am Wochenende machen - Klamotten kaufen, ins Kino gehen, an den Strand fahren, Partys bei den Freunden feiern, deren Eltern gerade verreist sind (ein Vorzug reicher Eltern ist es, dass sie das Geld haben, öfter mal zu verreisen), und natürlich saufen, vögeln, kiffen.
Diese Jungs hatten Geld in der Tasche und Markenklamotten auf dem Leib - schon in den unteren Klassen. Fabián, Alejandro und ihre Gang waren immer nach der neuesten Mode gekleidet, haben in den teuersten Shops eingekauft. Auch hier in Tijuana, wo sie jetzt das College besuchen, haben sie das Taschengeld, sich mit den schärfsten Klamotten einzudecken. Wenn sie nicht gerade in der Disco rumhängen oder hier unter el arbol, sind sie meistens shoppen. Aufs Shoppen verwenden sie bedeutend mehr Zeit als aufs Pauken, so viel ist sicher.
Denn dumm sind sie beide nicht.
Fabián ist sogar ausgesprochen clever. Er könnte die Betriebswirtschaftsvorlesung im Schlaf absolvieren - was sie die meiste Zeit auch tun. Fabián rechnet den Zinseszins im Kopf aus, bevor die anderen auch nur die Zahlen eingetippt haben. Er könnte ein guter Student sein.
Aber wozu? Es gehört nicht zum Konzept.
Das Konzept geht so: Du geht in den Staaten zur Schule, kommst zurück, holst dir einen ehrenhaften Abgang vom College, dein Papa steckt dich ins Geschäft, und mit den Connections, die du dir diesseits und jenseits der Grenze aufgebaut hast, machst du das große Geld.
Ein Konzept fürs Leben.
Aber dass die Barrera-Brüder in die Stadt ziehen würden, war in diesem Konzept nicht vorgesehen. Nirgends stand geschrieben, dass Adán und Raúl Barrera ins Hipódromo-Viertel ziehen und ein großes weißes Landhaus mieten würden.
Fabián hat Raúl in der Disco kennengelernt. Er sitzt am Tisch mit ein paar anderen cuates, als dieser irre Typ reinkommt - superlanger Nerzmantel, hellgrüne Cowboystiefel, schwarzer Cowboyhut.
Fabián stößt Alejandro mit dem Ellbogen: »Guck dir das mal an.«
Sie denken, das ist ein Witz, nur dass der Witz zu ihnen rüberguckt, nach dem Kellner brüllt und dreißig Flaschen Champagner bestellt.
Dreißig Flaschen Champagner.
Und nicht die billige Scheiße, sondern Dom.
Bezahlt in Cash.
Dann fragt er in die Runde: »Wer feiert mit mir?« Alle, wie sich rausstellt. Diese Party geht auf Raúl Barreras Rechnung. Es ist die Party. Und Punkt.
Dann eines Tages ist er nicht einfach nur da, sondern er lässt die Puppen tanzen.
Sie sitzen also eines Tages um ihren Baum, rauchen Gras, üben ein bisschen Karate, als Raúl plötzlich Felizardo erwähnt.
»Der Boxer?«, fragt Fabián. Cesar Felizardo - so etwa der größte Held Mexikos.
»Nein, der Bauer«, antwortet Raúl. Er demonstriert einen Spinning Back-Kick und sagt zu Fabián: »Klar, der Boxer. Tritt nächste Woche gegen Pérez an. Hier in der Stadt.«
»Ist doch längst ausverkauft«, sagt Fabián.
»Für dich vielleicht«, sagt Raúl.
»Für dich etwa nicht?«
»Er kommt aus meiner Stadt«, sagt Raúl. »Culiacan. Ich hab ihn gemanagt - ist ein alter Kumpel von mir. Wenn ihr wollt - ich besorge euch Karten.«
Klar wollen sie, und sie kriegen die Karten. Plätze direkt am Ring. Der Kampf dauert nicht lange, Felizardo schlägt Pérez k. o. in der dritten Runde, aber trotzdem - eine heiße Sache. Noch heißer wird es, als Raúl sie hinterher mitnimmt in die Garderobe. Und dann stehen sie tatsächlich vor Felizardo. Er redet mit ihnen, als wären sie alle seine alten Kumpels.
Mit Ausnahme von Adán, wie Fabián bemerkt. Ihm gegenüber verhält sich Felizardo anders. Es hat etwas Unterwürfiges, wie er mit ihm redet. Und Adán bleibt nicht lange, kommt nur mal kurz rein, gratuliert dem Boxer unauffällig und verschwindet wieder.
Aber in den paar Minuten seiner Anwesenheit halten sich die anderen zurück.
Fabián hat längst begriffen, dass es was bringt, wenn man sich mit den Barreras gutstellt.
Nicht nur Tribünenplätze beim Fußball (Raúl spendiert die Tickets) oder Logenplätze beim Spiel der Padres (Raúl spendiert die Tickets), sondern sogar Flüge nach Las Vegas, wo sie einen Monat später im Mirage wohnen, ihr ganzes Geld verjubeln und miterleben dürfen, wie Felizardo sechs Runden lang Rodolfo Aguilar verdrischt, um dann mit einem ganzen Rudel Edelnutten in Rauls Suite zu feiern und am nächsten Tag nach Hause zu fliegen - verkatert, halbtot gefickt und glücklich.
Er hat auch begriffen, dass alles viel schneller geht, wenn man sich mit den Barreras gutstellt. Dass man bei ihnen im Handumdrehen bekommt, wofür man anderenfalls jahrelang in Papas Büro schuften müsste.
Man hört so Sachen über sie - dass es Drogengeld ist, mit dem sie rumwerfen (wer hätte das gedacht?) -, aber das meiste, was man hört, handelt von Raúl. Eine der Geschichten, die man sich zuflüstert, geht so:
Er sitzt in seinem Auto vorm Haus, aus seiner Anlage dröhnt Bandera-Musik, mit voll aufgedrehten Bässen, so dass ein Nachbar rauskommt und an die Scheibe klopft.
Raúl lässt die Scheibe runter. »Was ist?«
»Können Sie das leiser stellen?«, brüllt der Nachbar, um die Musik zu übertönen. »Ich höre das sogar im Haus. Bei mir klirren die Scheiben!«
Raúl beschließt, ihn ein bisschen zu verarschen.
»Wie bitte?«, brüllt er zurück. »Ich kann nichts hören.«
Der Mann ist nicht in der Stimmung, sich verarschen zu lassen. Auch er ist ein Macho. Also brüllt er weiter. »Die Musik! Dreh leiser! Das ist verdammt noch mal zu laut!«
Raúl zieht die Pistole aus der Jacke, schiebt sie dem Mann zwischen die Rippen und drückt ab.
»Jetzt ist es nicht mehr zu laut, oder?«
Die Leiche des Nachbarn verschwindet, und keiner wagt mehr, sich über Rauls Musik zu beschweren.
Fabián und Alejandro halten die Geschichte für Blödsinn, die riecht zu sehr nach Scarface, aber jetzt steht Raúl da, zertritt genüsslich eine Schabe und verkündet: »Wie wär's, wenn wir einen umlegen?« Als würde er einen Spaziergang zur Eisdiele vorschlagen.
»Kommt schon«, sagt Raúl, »ihr habt doch sicher irgendwo eine Rechung offen.«
Fabián wechselt einen dritten Blick mit Alejandro und sagt: »Also gut...«
Fabián hat von seinem Vater einen Mazda Miata, und Alejandros Eltern haben mit einem Lexus dagegengehalten. Vor ein paar Tagen haben sie sich mal wieder ein Rennen geliefert, und Fabián war gerade auf der Überholspur, als ihm ein anderes Auto entgegenkam. Fabián konnte zwar noch ausweichen, aber um ein Haar hätte es geknallt. Zufällig arbeitet der Fahrer des anderen Autos im selben Bürogebäude wie Fabians Vater, daher kennt er das Auto, und er beschwert sich bei Fabians Vater. Der kriegt einen Mordswutanfall und streicht ihm den Miata für sechs Monate, und jetzt hat Fabián nichts mehr unterm Hintern.
Fabián erzählt Raúl von seinem Kummer.
Ist ja nur Spaß. Der Schwachsinn, den man sich so beim Kiffen erzählt.
Bis - eine Woche später - der Mann verschwunden ist.
Es ist einer der seltenen Abende, wo Fabians Vater zum Essen nach Hause kommt, und er erzählt, dass ein Mann aus seinem Bürogebäude spurlos verschwunden ist, wie vom Erdboden verschluckt. Fabián entschuldigt sich kurz, geht ins Bad und spritzt sich kaltes Wasser ins Gesicht.
Später am Abend trifft er Alejandro im Club, und bei dröhnender Musik bereden sie die Sache.
»Scheiße«, sagt Fabián. »Meinst du, der hat das tatsächlich gemacht?«
»Keine Ahnung«, sagt Alejandro. Dann blickt er Fabián an, fängt an zu lachen und sagt: »Nieeeemals!«
Aber der Mann taucht nicht wieder auf. Raúl verliert kein Wort darüber. Und Fabián ist total am Boden. Das war doch nur ein Witz, er wollte doch nur auf Rauls Gequatsche einsteigen, und deshalb musste ein Mann krepieren?
Und wie fühlst du dich jetzt? fragt er sich, als wäre er sein eigener Coach.
Die Antwort überrascht ihn selbst.
Er fühlt sich beschissen, er fühlt sich schuldig, und -
- er fühlt sich gut.
Es ist die Macht.
Du schnippst nur mit dem Finger, und - Adiós, Motherfucker. Das ist wie Sex, nur besser.
Zwei Wochen später rafft er seinen ganzen Mut zusammen und redet mit Raúl übers Geschäft. Sie steigen in Rauls roten Porsche und machen eine Fahrt.
»Wie komme ich da rein?«, fragt Fabián.
»Wo rein?«
»La pista secreta«, sagt Fabián. »Ich hab nicht viel Geld. Ich meine, Geld für mich.«
»Geld brauchst du keins«, sagt Raúl. »Was denn?«
»Hast du eine Green Card?«
»Klar.«
»Das ist deine Grundausstattung.«
Und mehr war nicht nötig. Zwei Wochen später stellt ihm Raúl einen Ford Explorer hin und sagt, er soll ihn über die Grenze fahren, nach Otay Mesa. Nennt ihm Uhrzeit und die Wartespur, die er am Kontrollpunkt benutzen soll. Fabián hat eine höllische Angst, aber es ist eine prickelnde Angst, ein Adrenalin-Kick. Er passiert die Grenze, als wäre sie gar nicht da, der Mann winkt ihn einfach durch. Fährt zu der Adresse, die Raúl ihm genannt hat, dort steigen zwei Typen in den Explorer ein, er steigt um in das andere Auto und fährt zurück nach Tijuana.
Raúl blättert ihm zehntausend Dollar hin. Cash.
Fabián holt Alejandro mit ins Geschäft. Sie sind schließlich cuates.
Ein paar Fahrten machen sie zusammen, dann übernimmt Alejandro seine eigenen Touren. Es läuft wie geschmiert, sie machen Kohle, aber -
»- ich finde, nicht genug«, sagt er eines Tages zu Alejandro.
»Ich bin zufrieden.«
»Richtig Kohle verdient man mit Coke.« Er geht zu Raúl und sagt, er möchte aufsteigen. »Das ist cool«, sagt Raúl. »Aufwärtsmobilität ist das Gebot der Stunde.«
Er erklärt Fabián, wie es läuft, und bringt ihn sogar zu den Kolumbianern. Sitzt dabei, während sie einen hübschen Standardvertrag aushandeln - Fabián übernimmt fünfzig Kilo Kokain, die vor Rosarito von einem Fischkutter geworfen werden. Er bringt es über die Grenze für tausend Dollar pro Kilo. Zehn Prozent davon gehen allerdings an Raúl, als Schutzgebühr.
Rumms.
Fünfundvierzig Riesen, einfach so.
Fabián macht noch zwei weitere Deals und kauft sich einen Mercedes.
Nach dem Motto: Den Miata kannst du behalten, Daddy. Stell den japanischen Rasenmäher in die Garage und pass auf ihn auf. Vor allem: Nerv mich nicht wegen meiner Zensuren, den Marketing-Kurs hab ich schon bestanden. Ich bin längst Broker, Dad, und zerbrich dir nicht den Kopf, wie du mich in deiner Firma unterbringst, denn das Letzte, was ich will, ist ein J-O-B.
Und so was wie Lohnsteuer könnte ich mir gar nicht leisten.
Fabián und Erfolg bei Mädchen? Jetzt legt er erst richtig los.
Denn Fabián hat G-E-L-D.
Er ist einundzwanzig und lebt wie ein Fürst.
Die anderen Jungs sehen das, die Söhne der Anwälte, Ärzte und Immobilienmakler. Sie sehen das und wollen auch mitmachen. Und es dauert nicht lange, da sind die meisten, die vorher mit Raúl unter dem Baum standen, Karate übten und kifften, ins Geschäft eingestiegen. Sie fahren für ihn über die Grenze, oder sie machen ihre eigenen Deals und liefern Prozente an ihn ab.
Jetzt stecken sie drin - bis zum Stehkragen. Sie sind die kommende Machtelite von Tijuana.
Bald hat die Truppe einen Spitznamen.
Die Juniors.
Und Fabián wird so was wie der Juniorchef.
Eines Abends, als er in Rosarito abhängt, kriegt er sich mit einem Boxer in die Haare. Dem Boxer Eric Casavales und seinem etwas älteren Promoter José Miranda. Eric ist ein ziemlich guter Boxer, aber an dem Abend hat er zu viel geladen, und er unterschätzt den Yuppie-Schnösel, mit dem er da aneinandergeraten ist. Drinks werden verschüttet, Hemden bekleckert, Worte gewechselt. Lachend zieht Casavales seine Pistole und richtet sie auf Fabián, bevor ihn José daran hindern kann.
Dann stakst Casavales lachend davon, und er lacht immer noch über das erschrockene Gesicht des Yuppie-Schnösels, als Fabián von seinem Mercedes zurückkommt, wo er seine eigene Pistole aus dem Handschuhfach genommen hat, sie vor ihrem Auto stehen sieht und beide - Casavales und Miranda - kurzerhand erschießt.
Fabián wirft die Pistole in den Ozean, geht zu seinem Mercedes und fährt zurück nach Tijuana. Und fühlt sich prächtig. Wie gut er das hingekriegt hat.
Das ist die eine Version der Geschichte. Die andere - die man sich im El Big erzählt - geht anders. Dort erzählt man sich, dass die Begegnung mit dem Boxer kein Zufall war, dass Miranda einen Kampf blockierte, den Cesar Felizardo brauchte, um weiterzukommen, und dass Miranda den Platz nicht räumen wollte, auch nachdem ihm Adán Barrera ein sehr großzügiges Angebot gemacht hatte. Niemand kennt den wahren Grund, aber Casavales und Miranda sind tot, und ein paar Monate später steigt Felizardo in den Ring und gewinnt die Meisterschaft im Leichtgewicht.
Fabián streitet ab, die beiden umgelegt zu haben, egal aus welchen Gründen, aber je mehr er leugnet, umso glaubwürdiger werden die Geschichten.
Raúl verpasst ihm sogar einen Spitznamen.
El Tiburón.
Der Hai.
Adán bearbeitet nicht die Kids, er bearbeitet die Erwachsenen.
Lucia mit ihrem geschulten Geschmack ist ihm eine große Hilfe dabei. Sie besorgt ihm einem guten Schneider, kauft ihm teure Anzüge, vornehm zurückhaltende Garderobe. (Adán will auch Raúl zu einem Geschmackswandel bewegen, aber der dreht eher noch auf, bereichert seine Cowboykluft um einen superlangen Nerzmantel.) Lucia besucht mit ihm die französischen Restaurants, private Partys und Clubs in den besseren Vierteln.
Und natürlich gehen sie zur Kirche. Jeden Sonntagvormittag findet man sie in der Messe. Sie legen dicke Schecks in die Kollekte, spenden großzügig für Bauvorhaben, für die Waisenkasse, für die Priesterversorgungskasse. Sie laden Padre Rivera zum Dinner ein, veranstalten Grillpartys, stellen sich als Taufpaten für eine wachsende Zahl junger Familien zur Verfügung. Sie sind ein junges, aufstrebendes Paar in Tijuana, wie es viele gibt - er ein ruhiger, seriöser Geschäftsmann mit erst einem Restaurant, dann mit zweien, dann mit fünfen, sie die ihm zur Seite stehende Ehefrau.
Lucia besucht das Fitnessstudio, geht mit anderen jungen Ehefrauen zum Lunch, fährt zum Shoppen nach San Diego. Darin sieht sie ihre Pflicht als Ehefrau eines Geschäftsmanns, aber mehr auch nicht, denn sie muss sich um ihr krankes Kind kümmern - die anderen Frauen haben Verständnis dafür. Sie ist viel zu Hause, und sie widmet sich der Kirchenarbeit.
Inzwischen ist sie schon Patin für ein halbes Dutzend Babys. Doch sie scheint zu einem starren Lächeln verurteilt, wenn sie das gesunde Kind anderer Leute übers Taufbecken hält.
Ist Adán nicht zu Hause, arbeitet er im Büro, oder er sitzt in einem seiner Restaurants, trinkt Kaffee und erledigt die Buchführung. Er wirkt wie ein junger Buchhalter, ein Zahlenjongleur. Und wer die Zahlenkolonnen sieht, die er mit Bleistift in sein gelbes Kontorbuch schreibt, würde niemals glauben, dass es um x Kilo Kokain geht - multipliziert mit den Lieferkosten der Kolumbianer, minus Transportkosten, Schutzgelder, Löhne und anderer Nebenkosten, Gúeros zehn Prozent, Tíos zehn Prozent. Natürlich befasst er sich auch mit prosaischen Dingen, etwa den Kosten der Rinderlenden, Leinenservietten, Putzmittel und dergleichen für die fünf Restaurants, die er jetzt besitzt, aber die meiste Zeit beanspruchen die komplizierteren Berechnungen, die sich mit dem Transport von Tonnen kolumbianischen Kokains befassen, und auch ein bisschen Heroin ist dabei, damit sie diesen Markt nicht aus den Augen verlieren.
Selten, wenn überhaupt, bekommt er die Drogen, die Lieferanten oder die Abnehmer zu sehen. Adán hat nur mit Geld zu tun - er zählt es, verbucht es, wäscht es. Aber er sammelt es nicht ein - das ist Rauls Geschäft.
Und Raúl kümmert sich hervorragend um sein Geschäft.
Nehmen wir den Fall der zwei Geldboten, die zweihunderttausend Barrera-Dollars über die Grenze nach Mexiko bringen sollten und immer weiter Richtung Monterrey fuhren statt nach Tijuana. Aber die mexikanischen Landstraßen können sehr lang werden, und natürlich werden die zwei Ausreißer bei Chihuahua von der Polizei aufgegriffen und so lange festgehalten, bis Raúl eintrifft.
Raúl ist nicht erfreut.
Er hat die Hände des einen Boten unter die Schlagschere gelegt und fragt ihn nun: »Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass du keine langen Finger machen sollst?«
»Doch!«, schreit der Bote mit schreckgeweiteten Augen.
»Du hättest auf sie hören sollen«, sagt Raúl. Mit seinem ganzen Gewicht legt er sich auf den Griff der Schlagschere und trennt dem Boten beide Hände ab. Die Polizisten beeilen sich, ihn ins Krankenhaus zu bringen, denn Raúl hat ihnen unmissverständlich klargemacht, dass der Mann am Leben bleiben muss, um fortan als menschliches Warnsignal umherzulaufen.
Der andere Bote schafft es bis nach Monterrey, doch er liegt gefesselt und geknebelt im Kofferraum des Autos, das Raúl zu einem leeren Parkplatz fährt, mit Benzin übergießt und anzündet. Dann bringt er das Geld selbst nach Tijuana, geht mit Adán zum Lunch und hinterher zu einem Fußballspiel.
Es vergeht sehr viel Zeit, bis wieder jemand versucht, lange Finger zu machen.
Adán hat mit diesen dreckigen Geschichten nichts zu tun. Er ist Geschäftsmann, er ist zuständig für Import/Export - für den Export von Drogen und den Import von Geld. Dann für die Verwertung des Geldes, die ein Problem darstellt. Es ist eins der Probleme, von denen ein Geschäftsmann gar nicht genug bekommen kann, nämlich: Wohin mit dem vielen Geld? Aber es bleibt ein Problem. Einen gewissen Teil kann Adán mit Hilfe seiner Restaurants waschen, aber auch mit fünf Restaurants kann man nicht Millionen von Dollars waschen, daher ist er ständig auf der Suche nach neuen Waschanlagen.
Aber für ihn sind das alles nur Zahlen.
Seit Jahren hat er keine Drogen gesehen.
Und kein Blut.
Adán Barrera hat noch nie getötet.
Nie mehr getan als die Faust geballt. Nein, die Dreckarbeit macht Raúl. Den scheint das nicht zu stören, ganz im Gegenteil. Und für Adán ist diese Art der Arbeitsteilung sehr angenehm. Er kann vergessen, wo das ganze Geld in Wirklichkeit herkommt.
7 Weihnachtszeit
And the tuberculosis old men
At the Nelson wheeze and cough
And someone will head south
Until this whole thing cools off ...
Tom Waits, Small Change
New York City Dezember
1985
Callan hobelt ein Brett.
In einer langen, gleichmäßigen Bewegung führt er den Hobel vom einen Ende zum anderen, dann tritt er zurück, um seine Arbeit zu begutachten.
Sieht gut aus.
Er nimmt ein Stück Sandpapier, wickelt es um einen Klotz und glättet die Kante, die er gerade geschaffen hat. Die Dinge stehen gut.
Vor allem deshalb, sagt sich Callan, weil sie so schlecht gelaufen sind.
Nehmen wir die Bilanz des großen Kokain-Deals: Null. Besser gesagt, minus Null.
Callan hat keinen Cent daran verdient. Statt das Zeug auf die Straße zu bringen, musste er mit ansehen, wie es in einem Hundezwinger verschwand. Die Polizei hatte sie wahrscheinlich die ganze Zeit im Visier gehabt, denn kaum war Peaches mit der Ware in den Zuständigkeitsbereich der New Yorker Staatsanwaltschaft gelangt, hatten sich Giulianis dressierte Drogenhunde auf die Ladung gestürzt wie Fliegen auf einen Haufen Scheiße.
Und Peaches wurde unter Anklage gestellt, wegen Drogenbesitz mit Veräußerungsabsicht.
Eine üble Sache.
Peaches wird wohl seine Midlife-Krise in Ossining verbringen, wenn er überhaupt so lange lebt. Und er muss mit einer außerirdischen Kaution aufwarten, ganz zu schweigen von den Anwaltskosten und davon, dass er in der ganzen Zeit kein Geld verdient. Daher kommt ihnen Peaches jetzt mit Sprüchen wie: Drückt mal ein paar Tausender ab, Jungs, jetzt heißt's Steuern zahlen. Callan und O-Bop haben also nicht nur ihren Einsatz beim Kokain-Deal verloren, sie müssen auch in den Peaches-Verteidigungs-Fonds einzahlen, und das frisst ihre Einnahmen aus Schutzgeldern, Erpressungsgeldern und Wucherzinsen zu einem guten Teil wieder auf.
Aber die gute Nachricht ist, dass sie nicht mit angeklagt sind. Bei all seinen Fehlern ist Peaches ein Mann, der dichthält - genauso Little Peaches. Obwohl die Polizei massenhaft Mitschnitte besitzt, auf denen Peaches mit jedem oder über jeden Mafioso des Großraums New York plaudert, kommen O-Bop oder Callan nicht auf den Bändern vor.
Was ein wahrer Segen ist, denkt Callan.
Diese Masse Kokain bringt dreißig Jahre bis Lebenslänglich, eher Letzteres.
Das also ist das Gute - aus Callans Sicht.
Es bedeutet, die Luft ist rein, und sie bleibt es auch.
Sie sind wieder im Rennen.
Aber Peaches steckt in der Klemme, genauso wie Little Peaches. Es heißt, die Feds haben Cozzo und seinen Bruder und noch ein paar andere festgesetzt und warten nur darauf, dass Big Peaches gegen sie aussagt.
Na, dann viel Glück, denkt Callan.
Peaches ist alte Schule.
So schnell packt der nicht aus.
Aber dass ihn die Feds in die Zange nehmen, ist das kleinste Problem von Peaches, denn die Feds haben auch Big Paulie Calabrese beim Wickel.
Nicht wegen der Kokain-Geschichte, sondern wegen einer Menge anderer Sachen, die unter Organisierte Kriminalität fallen, und Big Paulie schwitzt vor Angst, weil es erst ein paar Monate her ist, dass Giuliani, dieser scharfe Hund, vier andere Bosse für jeweils hundert Jahre hinter Gitter gebracht hat - und Big Paulie steht als Nächster auf der Liste.
Dieser Giuliani ist schon ein Witzbold - er kennt den alten italienischen Trinkspruch »Cent' anni« genau. Hundert Jahre sollen dir vergönnt sein. Nur, dass er's anders meint. Und Giuliani will das Quintett vollmachen, er will alle Bosse der alten Fünf Familien aus dem Verkehr ziehen, und wie es aussieht, muss auch Paulie dran glauben. Der will natürlich nicht im Gefängnis sterben und ist entsprechend nervös.
Also muss er ein bisschen Dampf ablassen und nimmt sich Peaches vor.
Wer dealt, stirbt.
Peaches beteuert seine Unschuld, die Feds haben ihn gelinkt, sagt er, nicht im Traum würde er daran denken, seinen Boss zu hintergehen und Drogengeschäfte zu machen, aber die Gerüchte über die Tonbänder wollen nicht verstummen. Peaches soll über Drogendeals geredet und auch ein paar hässliche Sachen über Paulie Calabrese gesagt haben, doch Peaches fragt immer nur: Bänder, welche Bänder? Die Feds geben die Bänder nicht an Paulie weiter, weil sie im Calabrese-Prozess nicht als Beweismittel verwendet werden, aber Calabrese weiß genau, dass sie gegen Peaches verwendet werden, also hat Peaches Kopien erhalten, und Paulie verlangt, dass er sie zu ihm hinausbringt, zu seinem Haus in Todt Hill.
Was Peaches auf jeden Fall verhindern will. Da kann er sich gleich eine Handgranate in den Arsch schieben und den Stift ziehen. Weil er auf den Bändern hässliche Sachen über Paulie erzählt. Sachen wie: Weißt du, wie die Großmutter ihr Hausmädchen fickt? Du wirst es nicht glauben, aber er benutzt dafür so ein Ding zum Aufpumpen ...
Und andere erlesene Sprüche über die Großmutter und was für ein dummes, gemeines, schlappschwänziges Arschloch Paulie ist, nicht zu erwähnen die abfälligen Bemerkungen über die Hackordnung der Cimino-Brüder - genug jedenfalls, um in Peaches den inständigen Wunsch wachzuhalten, dass Paulie diese verfluchten Bänder niemals zu hören kriegt.
Was die Lage noch komplizierter macht, ist der Umstand, dass Neill Demonte, der Cimino-Unterboss alter Schule, langsam am Krebs eingeht, und nur der Respekt vor Neill hat den Cozzo-Zweig der Familie von der offenen Rebellion abgehalten, fetzt ist nicht nur Neuis mäßigender Einfluss dahin, auch seine Stellung wird vakant, und der Cozzo-Zweig hegt gewisse Erwartungen.
Nämlich, dass Johnny Boy Cozzo und nicht Tommy Bellavia zum neuen Unterboss ernannt wird.
»Ich kusche doch nicht vor einem verkackten Chauffeur«, prahlt Peaches, als hätte er auch nur die geringste Chance, vor irgendjemand anderem zu kuschen als dem Gefängniswärter oder dem heiligen Petrus.
Callan lässt sich all das von O-Bop berichten, der einfach nicht glaubt, dass Callan aussteigen will.
»Du kannst nicht aussteigen«, sagt O-Bop.
»Warum denn nicht?«
»Wie bitte? Du denkst, du kannst einfach davonlaufen? Du denkst, da gibt es eine Tür, auf der steht Ausgang?«
»Genau das denke ich«, sagt Callan. »Wieso? Willst du mir den Weg versperren?«
»Nein, nein«, sagt O-Bop hastig. »Aber da draußen laufen Leute rum, die haben was gegen dich. Denen willst du doch nicht allein gegenübertreten.«
»Genau das will ich.«
Naja, nicht ganz allein.
Die Wahrheit ist, Callan hat sich verliebt.
Er hört mit dem Hobeln auf und geht nach Hause.
Freut sich auf Siobhan.
Getroffen hat er sie im Glocca Mora auf der 26th, Ecke Third Avenue. Er sitzt an der Bar, trinkt ein Bier und hört Joe Burke mit seiner irischen Flöte, da sieht er sie mit ein paar Freundinnen am vorderen Tisch sitzen. Ihre langen schwarzen Haare fallen ihm als Erstes auf. Dann dreht sie sich um. Er sieht ihr Gesicht, ihre grauen Augen, und ist hin und weg.
Er geht rüber an den Tisch und setzt sich dazu.
Wie sich rausstellt, heißt sie Siobhan und kommt gerade aus Belfast - aufgewachsen in der Kashmir Road.
»Mein Dad ist von Clonard Gardens«, sagt Callan. »Kevin Callan.«
»Von dem hab ich gehört«, sagt sie und dreht sich weg. »Und was?«
»Ich bin hier, um das alles loszuwerden.«
»Warum kommst du dann in diese Kneipe?«, fragt er. Jedes zweite Lied, das sie hier singen, handelt davon - von Nordirland, gestern, heute und morgen. Schon legt Joe Burke die Flöte weg, greift zum Banjo, und die Band leitet über zu »The Men behind the Wire«.
Armoured cars and tanks and guns
Came to take away our sons
But every Man will stand behind
The men behind the wire.
»Keine Ahnung«, sagt sie. »Ich dachte, hier gehen die Iren hin.«
»Es gibt andere Lokale«, sagt er. »Hast du schon gegessen?«
»Ich bin mit meinen Freundinnen hier.«
»Die nehmen wir mit. Damit hab ich kein Problem.«
»Aber ich.«
Ihr Blick besagt: Shot down in Flames. Doch dann sagt sie: »Ein andermal vielleicht.«
»Ist das eine nette Abfuhr?«, fragt er. »Oder heißt das, wir machen ein Date?«
»Donnerstagabend bin ich frei.«
Er bringt sie in ein teures Lokal, schon außerhalb von Hell's Kitchen, aber noch in seinem Revier. Kein Fetzen Tischwäsche kommt hier rein, ohne dass er oder O-Bop das abgenickt hätten, dem Feuerinspektor fällt nicht auf, dass die Hintertür verschlossen ist, der Streifenpolizist ist nur zu gern bereit, einfach vorbeizugehen, und manchmal kommen ein paar Kisten Whiskey direkt vom Lkw, ohne den ganzen Rechnungskram, also kriegt Callan den besten Tisch und eine aufmerksame Bedienung.
»Meine Güte!«, sagt Siobhan, als sie die Speisekarte überfliegt. »Kannst du dir das leisten?«
»Klar doch.«
»Was machst du denn beruflich?«, fragt sie. Eine unangenehme Frage. »Dies und das.«
Wobei »dies« Gewerkschaftsmauscheleien bedeutet, Zinswucher und Auftragsmord - und »das« Drogenhandel.
»Das muss ja einträglich sein«, sagt sie. »Dies und das.«
Jetzt steht sie auf und geht, denkt er, aber stattdessen bestellt sie ein Seezungenfilet. Callan hat keine Ahnung von Wein, deshalb war er am Nachmittag schon mal da und hat dem Sommelier Bescheid gesagt, damit er die richtige Flasche bringt - passend zu dem, was sie bestellt.
Und der Sommelier bringt die Flasche.
Auf Kosten des Hauses.
Jetzt guckt sie ihn komisch an.
»Ich erledige Sachen für sie«, erklärt Callan.
»Dies und das.«
»Genau.«
Ein paar Minuten später geht er zur Toilette, schaut nach dem Manager und sagt zu ihm: »Hör mal, ich will eine Rechnung, okay?«
»Um Gottes willen, Sean! Der Chef bringt mich um, wenn ich dir eine Rechnung schreibe.«
Denn das ist nicht der Deal. Der Deal ist, dass Sean Callan oder Stevie O'Leary, wenn sie essen kommen, keine Rechnung zu sehen kriegen, sondern dem Kellner ein dickes Trinkgeld hinlegen. So läuft das hier. Dazu gehört auch, dass sie nicht zu oft kommen, dass sie ihre Besuche auf mehrere Lokale verteilen.
Callan ist nervös - so oft passiert es nicht, dass er ein Date hat. Und wenn doch, dann geht es meistens ins Gloc oder ins Liffey, auf einen Burger oder ein Lammragout, sie besaufen sich, ziehen ab nach Hause zum Vögeln, und hinterher ist alles vergessen. In ein Lokal wie dieses geht er nur aus geschäftlichen Gründen - um Flagge zu zeigen, wie O-Bop das nennt.
»Das«, sagt sie und wischt sich die letzten Spuren der Schokoladen-Mousse von den Lippen, »war die beste Mahlzeit, die ich je hatte.«
Die Rechnung kommt, und sie ist ein Hammer.
Als Callan die Summe sieht, fragt er sich, wie der Normalbürger bei solchen Preisen überleben kann. Er zieht einen Batzen Scheine aus der Tasche und legt sie aufs Tablett. Das bringt ihm wieder einen komischen Blick von Siobhan ein.
Trotzdem ist er überrascht, als sie ihn in ihre Wohnung mitnimmt und geradewegs ins Schlafzimmer führt. Sie zieht den Pullover aus und schüttelt ihr Haar, dann greift sie nach hinten und öffnet ihren BH, streift die Schuhe ab, steigt aus den Jeans und schlüpft unter die Decke.
»Du hast noch deine Socken an«, sagt Callan.
»Weil ich kalte Füße hab«, sagt sie. »Kommst du?«
Er zieht sich aus - nur mit der Unterhose wartet er, bis er unter der Decke ist. Nachdem er mit ihrer Hilfe in ihr drin ist, kommt sie schnell, und als er so weit ist, will er einen Rückzieher machen, doch sie umklammert ihn mit den Beinen und hält ihn fest. »Ist okay. Ich nehme die Pille.«
Sie kreist nur kurz mit dem Becken, schon ist es passiert.
Am Morgen steht sie auf, um zur Beichte zu gehen. Sonst, so sagt sie, bekommt sie am Sonntag nicht die Kommunion.
»Du willst das hier beichten?«, fragt er.
»Natürlich.«
»Musst du versprechen, es nie wieder zu tun?«, fragt er, schon halb in Angst, dass sie Ja sagt.
»Den Pfarrer belüge ich nicht«, sagt sie, schon ist sie aus der Tür. Er schläft wieder ein, und als sie zu ihm ins Bett zurückkommt, greift er nach ihr, aber sie wehrt ihn ab und sagt, er muss bis morgen nach der Messe warten, denn für die Kommunion muss sie eine reine Seele haben.
Katholische Mädchen, denkt er.
Und geht mir ihr zur Mitternachtsmesse.
Es dauert nicht lange, und sie sehen sich fast täglich.
Viel zu oft, wenn es nach O-Bop geht.
Dann ziehen sie zusammen. Die Schauspielerin, bei der Siobhan zur Untermiete gewohnt hat, kommt von ihrer Tournee zurück, und Siobhan muss sich was Neues suchen, was in New York nicht leicht ist, wenn man als Kellnerin arbeitet, also schlägt Callan ihr vor, bei ihm einzuziehen.
»Ich weiß nicht«, sagt sie. »Das ist ein großer Schritt.«
»Wir schlafen sowieso fast jede Nacht zusammen.«
»Mit der Betonung auf fast.«
»Am Ende ziehst du noch nach Brooklyn.«
»Brooklyn ist okay.«
»Schon. Aber denk an die lange U-Bahnfahrt.«
»Du willst wohl wirklich, dass ich zu dir ziehe?«
»Ich will wirklich, dass du zu mir ziehst.«
Das Problem: Seine Wohnung ist ein Rattenloch. 46th, Ecke Eleventh, drei Treppen hoch, Zimmer mit Bad. Er hat ein Bett, einen Stuhl, einen Fernseher, einen Herd, den er noch nie benutzt hat, und eine Mikrowelle.
»Du verdienst so viel und wohnst in diesem Loch?«, wundert sich Peaches.
»Mehr brauche ich nicht.«
Nur dass es jetzt nicht mehr stimmt, also sucht er eine neue Wohnung.
Er denkt an die Upper West Side.
O-Bop gefällt das nicht. »Das sähe nicht gut aus«, meint er, »wenn du unser Revier verlässt.«
»Da gibt es keine guten Wohnungen mehr«, sagt er. »Alles vergeben.«
Was nicht stimmt, wie sich herausstellt. O-Bop spricht mit ein paar Hausverwaltern, ein paar Kautionen werden zurückgezahlt, und schon hat Callan vier oder fünf Wohnungen zur Auswahl. Er nimmt sich eine in der 50th, Ecke Twelfth, mit einem kleinen Balkon und Blick auf den Hudson.
Callan und Siobhan gründen einen gemeinsamen Hausstand.
Sie fängt an, Sachen zu kaufen - Decken und Bettwäsche und Kissen und Handtücher und all den Plunder, den Frauen fürs Badezimmer brauchen. Und Töpfe und Pfannen und Geschirr und Geschirrtücher und den ganzen Mist, der ihn erst zum Wahnsinn treibt, doch dann gefällt es ihm irgendwie.
»Wir können öfter zu Hause essen«, sagt sie, »und jede Menge Geld sparen.«
»Öfter zu Hause essen?«, fragt er. »Wir essen überhaupt nicht zu Hause!«
»Das meine ich ja«, sagt sie. »So was summiert sich. Wir geben ein Vermögen aus, das wir auch sparen können.«
»Sparen wofür?« Er fasst es nicht.
Peaches klärt ihn auf. »Männer leben im Jetzt. Essen jetzt, trinken jetzt, vögeln jetzt. Wir denken nicht an die nächste Mahlzeit, den nächsten Drink, den nächsten Fick - wir sind zufrieden mit dem, was jetzt ist. Frauen leben in der Zukunft - und das solltest du dir hinter die Ohren schreiben, du Harfe. Die Frau baut immer ein Nest. Egal, was sie macht, in Wirklichkeit sammelt sie immer Zweige und Blätter und all den Kram, um ein Nest zu bauen. Und das Nest ist nicht für dich, du Bauer. Das Nest ist nicht mal für sie selbst. Sondern für die Bambinos.«
Also kocht Siobhan jetzt öfter, und am Anfang missfällt ihm das - ihm fehlt die Geselligkeit, der Lärm, das Gequatsche, doch dann kommt er auf den Geschmack. Er liebt die Ruhe, schaut ihr gern zu, wenn sie isst und die Zeitung liest, trocknet gern ab.
»Wieso zum Teufel trocknest du ab?«, fragt ihn O-Bop. »Kauf doch einen Geschirrspüler.«
»Die sind teuer.«
»Nein, sind sie nicht«, sagt O-Bop. »Du gehst zu Handrigan, suchst dir einen aus, der wird schwarz geliefert, und Handrigan kassiert die Versicherung.«
»Ich trockne lieber ab.«
Aber eine Woche später, er ist gerade mit O-Bop unterwegs, Geschäfte erledigen, summt der Summer bei Siobhan zu Hause, und zwei Kerle kommen mit einer Kiste und einer Sackkarre.
»Was ist das?«, fragt Siobhan.
»Ein Geschirrspüler.«
»Wir haben keinen Geschirrspüler bestellt.«
»Hey«, sagt der eine, »wir haben das Ding eben hier hochgewuchtet, jetzt wuchten wir's nicht wieder runter. Und ich gehe nicht zu O-Bop und sage, dass ich nicht gemacht hab, was er mir gesagt hat, also sei einfach ein nettes Mädchen und lass uns rein, damit wir den Geschirrspüler anschließen können.«
Sie lässt sie rein, das Ding anschließen, aber als Callan nach Hause kommt, gibt es eine Diskussion.
»Was soll das?«, fragt sie.
»Das ist ein Geschirrspüler.«
»Ich weiß, was das ist«, sagt sie. »Ich meinte, was soll das?« Ich werde dem verdammten Stevie eine Abreibung verpassen, denkt Callan, aber er sagt: »Ein Housewarming-Präsent.«
»Das ist aber ein sehr großzügiges Housewarming-Präsent.«
»O-Bop ist ein sehr großzügiger Mensch.«
»Das Ding ist gestohlen, oder?«
»Hängt davon ab, was du mit gestohlen meinst.«
»Es geht zurück.«
»Das wäre kompliziert.«
»Was ist daran kompliziert?«
Er will ihr nicht erklären, dass Handrigan den Schaden wahrscheinlich schon gemeldet hat, den Verlust von drei oder vier Maschinen, die er zum halben Preis verscherbelt - nur eine kleine Gaunerei nebenbei. Also sagt er: »Es ist kompliziert, und fertig.«
»Ich bin nicht bescheuert, verstehst du?«
Keiner hat ihr was gesagt, aber sie merkt es einfach. Weil sie im Viertel wohnt, einkaufen geht, zur Reinigung geht, mit dem Telefonmonteur verhandelt, dem Klempner - und sie spürt die Unterwürfigkeit, mit der man ihr begegnet. Es sind die kleinen Dinge - ein paar Birnen zusätzlich, die man ihr in den Korb legt, die Kleider schon morgen fertig statt übermorgen, die seltsam höflichen Taxifahrer, Zeitungsverkäufer, die Bauleute, die weder pfeifen noch johlen.
Nachts im Bett sagt sie: »Ich bin aus Belfast weg, weil ich die Gangster satt hatte.«
Er weiß, was sie meint. Die Provos sind nicht mehr das, was sie mal waren. Inzwischen kontrollieren sie in Belfast die meisten Dinge - etwa so wie Callan und O-Bop in Hell's Kitchen. Er weiß, wovon sie redet. Er will sie bitten, bei ihm zu bleiben, aber stattdessen sagt er: »Ich versuche, auszusteigen.«
»Dann steig doch einfach aus.«
»So einfach ist das nicht, Siobhan.«
»Es ist kompliziert.«
»Allerdings, das ist es.«
Das alte Märchen, dass man einfach nur aussteigen muss, ist genau das - ein Märchen. Man kann da zwar rauskommen, aber es ist verdammt kompliziert. Du kannst nicht einfach aufstehen und weggehen. Du musst dich da rauswinden, sonst kommt es zu gefährlichen Verdächtigungen.
Und was soll ich dann tun?, denkt er.
Womit mein Geld verdienen?
Er hat nicht viel beiseitegelegt, fetzt die alte Leier der Geschäftsleute: Es kommt viel Geld rein, aber es geht auch viel raus. Die Leute verstehen das nicht - da ist Calabreses Anteil und der von Peaches, von allem, was reinkommt. Dann die Schmiergelder - die Gewerkschafter, die Bullen. Und die Crew will auch versorgt sein. Am Ende teilt er sich mit O-Bop, was übrig bleibt und immer noch eine Menge ist, aber nicht so viel, wie man glauben möchte. Und jetzt müssen sie auch noch in den Verteidigungsfonds von Big Peaches einzahlen ... Jedenfalls ist nicht genug da, dass er sich zur Ruhe setzen kann, nicht genug, um ein legales Geschäft aufzuziehen.
Und überhaupt, fragt er sich, welche Sorte Geschäft? Was zum Teufel habe ich gelernt? Ich kann nur Erpressung, ich kann draufhauen und - sagen wir's nur - andern Leuten das Licht ausknipsen.
»Was soll ich denn machen, Siobhan?«
»Egal.«
»Wie bitte? Etwa kellnern? Mit der Serviette überm Arm sehe ich mich nicht.«
Es entsteht eine dieser Schweigeminuten im Dunklen, bis sie schließlich sagt: »Dann sehe ich mich wohl nicht mehr mit dir.«
Als er am nächsten Morgen aufsteht, sitzt sie am Tisch, trinkt Tee und raucht. (So ein Mädchen aus Irland rausholen, das kannst du, denkt er, aber ...) Er setzt sich ihr gegenüber und sagt: »Ich kann nicht einfach so aussteigen. So läuft das nicht. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit.«
Sie kommt direkt auf den Punkt - etwas, was er an ihr mag. »Wie lange?«
»Ein Jahr. Was weiß ich?«
»Das ist zu lange.«
»Aber es kann so lange dauern.«
Sie nickt etliche Male, dann sagt sie: »Solange du auf den Ausgang zusteuerst.«
»Okay.«
»Ich meine, geradewegs auf den Ausgang zu.«
»Okay, ich hab verstanden.«
Und jetzt, ein paar Monate später, versucht er das O-Bop zu erklären. »Hör zu, die ganze Sache ist total verfahren. Ich weiß nicht mal, wie ich da reingeraten bin. Ich sitze in der Bar, dann kommt Eddie Friel reinmarschiert, und alles läuft aus dem Ruder. Ich mach dir keine Vorwürfe, ich mache niemandem Vorwürfe. Ich weiß nur, das Ganze muss ein Ende haben. Ich steige aus.«
Wie um einen Schlussstrich zu ziehen, packt er seine ganze Hardware in eine braune Einkaufstüte und überantwortet sie dem Hudson. Dann geht er nach Hause, um mit Siobhan zu reden. »Ich denke ans Tischlern«, sagt er. »Ladenausstattungen, Wohnungen und all das Zeug. Vielleicht bau ich dann irgendwann Schränke, Schreibtische und so was. Ich glaube, ich werde mal mit Patrick McGuigan reden, vielleicht nimmt er mich als unbezahlten Lehrling. Das Geld, das ich beiseitegelegt habe, reicht, bis ich richtige Arbeit habe.
»Klingt nach einem Plan.«
»Wir werden arme Schlucker sein.«
»Ich war immer arm«, sagt sie. »Darin bin ich gut.«
Also geht er am nächsten Morgen in McGuigans Loft in der 48th, Ecke Eleventh.
Sie waren zusammen in Sacred Heart und reden ein bisschen über die High School, dann noch ein bisschen über Hockey, und dann fragt Callan, ob er bei ihm arbeiten kann.
»Du willst mich verarschen, stimmt's?«, sagt McGuigan.
»Nein, ich meine es ernst.«
Und wie ernst er es meint. Callan schuftet wie ein Besengter, um das Handwerk zu lernen.
Kommt jeden Morgen Punkt sieben mit dem Lunchpaket in der Hand und einem eisernen Willen im Kopf. McGuigan wusste nicht, was ihn erwartete, aber dass sich Callan als Arbeitspferd entpuppte, hätte er nicht für möglich gehalten. Eher hatte er einen Saufbruder vermutet, einen Junkie, aber nicht diesen braven Burschen, der jeden Morgen pünktlich zur Arbeit kam.
Nein, dieser Bursche kam, um zu arbeiten, und er kam, um was zu lernen.
Callan merkt, dass es ihm Spaß macht, mit den Händen zu arbeiten.
Am Anfang stellt er sich an wie ein Idiot, aber dann fängt es an zu flutschen. Und McGuigan hat mit ihm Geduld, als er sieht, dass es ihm ernst ist. Nimmt sich die Zeit, ihm was beizubringen, gibt ihm kleine Sachen, die er verpfuschen kann, bis er so weit ist, dass er sie nicht mehr verpfuscht.
Und wenn Callan abends nach Hause geht, ist er müde.
Am Ende des Tages ist er körperlich erschöpft - mit Blasen an den Händen und Schmerzen in den Armen, aber innerlich fühlt er sich gut. Er ist entspannt, macht sich um nichts mehr Sorgen. Den ganzen Tag hat er nichts gemacht, was ihm in der Nacht Alpträume bescheren könnte.
Er hört auf, in die Pubs und Bars zu gehen, in denen er mit O-Bop rumhing. Er geht nicht mehr ins Liffey und nicht mehr ins Landmark. Meistens kommt er nach Hause, isst ein schnelles Abendbrot mit Siobhan, sie sehen ein bisschen fern und gehen ins Bett.
Eines Tages taucht O-Bop in der Tischlerei auf. Er steht in der Tür und guckt dumm aus der Wäsche, aber Callan beachtet ihn gar nicht, er konzentriert sich auf seine Schleifarbeit, bis sich O-Bop wegdreht und geht, und McGuigan denkt, vielleicht sollte er was sagen, aber offenbar gibt es nichts zu sagen. Sieht aus, als hätte Callan die Dinge im Griff, und McGuigan muss sich nicht mehr sorgen, wenn ihm die Westside-Boys einen Besuch abstatten.
Aber nach der Arbeit macht sich Callan auf die Suche nach O-Bop. Findet ihn 43th, Ecke Eleventh, und sie laufen zusammen rüber ans Wasser.
»Fick dich«, sagt O-Bop. »Was sollte das?«
»Das sollte dir sagen: Wenn ich arbeite, dann arbeite ich.«
»Was? Ich darf nicht mal vorbeikommen und Hallo sagen?«
»Nicht, wenn ich arbeite.«
»Willst du damit sagen, wir sind - wie sagt man? - keine Freunde mehr?«
»Wir sind immer noch Freunde.«
»Ich weiß nicht«, sagt O-Bop. »Du lässt dich nirgends mehr blicken. Ab und zu ein Bier, das müsste doch drin sein.«
»In den Bars rumhängen, das mache ich nicht mehr.«
O-Bop lacht. »Dann geh doch lieber gleich zu den Pfadfindern !«
»Lach nur.«
»Ja, ich lache.«
Sie stehen und schauen auf den Hudson. Es ist ein kalter Abend. Das Wasser sieht schwarz und hart aus.
»Na, meinetwegen musst du dir kein Bein ausreißen«, sagt O-Bop. »Macht sowieso keinen Spaß mehr mit dir, seit du hier den Proleten mimst. Ist nur so, dass die Leute schon nach dir fragen.«
»Wer fragt nach mir?«
»Die Leute.«
»Peaches?«
»Hör zu«, sagt O-Bop. »Im Moment brennt bei denen die Luft. Die stehen mächtig unter Druck und mögen keine Leute, die vielleicht vor Gericht quatschen.«
»Ich quatsche nicht. Mit niemandem.«
»Allerdings. Das sehe ich.«
Callan packt ihn an der Jacke.
»Willst du mir dumm kommen, Stevie?«
»Nein.«
Eine leichte Weinfahne.
»Mir kommst du nicht auf diese Tour, Stevie.«
»Ich sag doch nur ... verstehst du?« Callan lässt ihn los. »Ja, ich verstehe.« Er hat verstanden.
Aussteigen ist viel schwerer als einsteigen. Aber er will es, er geht einfach raus, und mit jedem Tag wird der Abstand größer. Mit jedem Tag gewöhnt er sich mehr an sein neues Leben, und ihm gefällt sein neues Leben. Aufstehen, in die Werkstatt gehen, hart arbeiten und dann nach Hause kommen, zu Siobhan. Abendessen, früh zu Bett und am nächsten Tag genau dasselbe.
Er und Siobhan, sie kommen wunderbar zurecht. Sie reden sogar von Heirat.
Doch dann stirbt Neill Demonte.
»Ich muss aber zur Beerdigung«, sagt Callan. »Warum?«, fragt Siobhan. »Um meinen Respekt zu erweisen.«
»Einem Gangster?«
Sie ist stocksauer. Sie ist wütend und hat Angst, dass er rückfällig wird. Weil er wieder mit den alten Gespenstern kämpft, nachdem er sich solche Mühe gegeben hat, da rauszukommen.
»Ich gehe hin, erweise meinen Respekt und komme zurück«, sagt er.
»Und wie war's, wenn du mir Respekt erweist?«, fragt sie. »Mir und unserer Beziehung?«
»Das tue ich doch.« Sie wirft die Arme hoch.
Er könnte es ihr erklären, aber er will sie nicht ängstigen. Dass sie sein Fehlen missdeuten würden. Dass Leute, die ihm sowieso schon misstrauen, noch misstrauischer werden würden. Dass sie die Nerven verlieren und etwas gegen ihr Misstrauen tun würden.
»Denkst du etwa, ich gehe aus Spaß?«
»Das musst du wohl, sonst könntest du ja hierbleiben.«
»Du verstehst das nicht.«
»Da hast du recht. Ich verstehe es nicht.«
Sie geht ins Schlafzimmer und knallt die Tür zu. Er hört, wie sich der Schlüssel im Schloss dreht. Erst will er die Tür eintreten, dann besinnt er sich, schlägt nur mit der Faust gegen die Wand und verlässt die Wohnung.
Es ist verdammt schwer, am Friedhof einen Parkplatz zu finden, weil so ziemlich alle Gangster der Stadt gekommen sind, gar nicht zu reden von der Polizei, die in Truppenstärke vertreten ist. Städtische Polizei, Staatspolizei, Bundespolizei. Einer von denen fotografiert Callan, aber Callan ist es egal.
Im Moment können ihm alle den Buckel runterrutschen.
Und seine Hand tut weh.
»Na, Aufruhr im Paradies?«, fragt O-Bop, als er die Hand sieht.
»Fick dich ins Knie.«
»Also, den Orden für vorbildliche Begräbnis-Etikette hast du dir schon verscherzt«, sagt O-Bop.
Dann hält er die Klappe, weil er merkt, dass Callan nicht zu Spaßen aufgelegt ist.
Sieht aus, als wären wirklich alle Gangster vertreten, die Giuliani noch nicht aus dem Verkehr gezogen hat. Da sind die Cozzo-Brüder, mit Messerformschnitt und Maßanzügen, dort die Piccones, dort Sammy Grillo und Frankie Lorenzo, Little Nick Corotti, Leonard DiMarsa und Sal Scachi. Dann der gesamte Cimino-Clan, dazu ein paar Genovese-Capos - Barney Bellomo und Dom Cirillo. Und ein paar Luccese-Leute - Tony Ducks und Little Al D'Arco. Und was vom Colombo-Clan noch übrig ist, seit Pérsico seine hundert Jahre absitzt, hat sich auch eingefunden, sogar ein paar alte Knaben vom Bonnano-Clan - Sonny Black und Lefty Ruggiero.
Alle, um Aniello Demonte ihren Respekt zu erweisen. Alle, um zu erschnüffeln, wie es nach Demontes Abgang weitergeht. Sie wissen, das hängt davon ab, wen Big Paulie Calabrese zum neuen Unterboss macht, denn mit derselben Wahrscheinlichkeit, mit der Paulie in den Bau gehen muss, wird der neue Unterboss der neue Boss. Wenn sich Paulie für Cozzo entscheidet, ist Ruhe im Karton. Doch wenn er sich anders entscheidet... warten wir's ab. Die Gangster sind also gekommen, um zu erfahren, wie der Wind weht. Alle sind sie da.
Mit einer gewichtigen Ausnahme. Big Paulie Calabrese.
Peaches kann es nicht glauben. Alles wartet, dass die große schwarze Limousine vorfährt, damit die Trauerfeier losgehen kann, aber er kommt nicht. Die Witwe ist außer sich, sie weiß nicht, was sie tun soll, und schließlich tritt Johnny Boy Cozzo vor und sagt: »Fangen wir an.«
»Die Beerdigung vom eigenen Unterboss schwänzen?«, erregt sich Peaches nach der Feier. »Das ist übel. Das ist einfach übel.«
Er dreht sich zu Callan um. »Aber schön, dich zu sehen. Wo hast du die ganze Zeit gesteckt?«
»Ich war immer da.«
»Aber nicht bei mir.«
Callan hat keine Lust auf die Nummer.
»Ihr Spaghettis könnt mich mal.«
»Du halt dein dreckiges Maul!«
»Komm schon, Jimmy«, sagt O-Bop. »Callan ist okay.«
»Also«, wendet sich Peaches wieder an Callan. »Was höre ich da? Du bist unter die Zimmerleute gegangen?«
»Stimmt.«
Peaches sagt: »Ich kenne einen, den haben sie ans Kreuz genagelt.«
»Wenn du was von mir willst, Jimmy«, sagt Callan. »Dann bring einen Leichenwagen mit. Mit dem fährst du nämlich weg.«
Cozzo geht dazwischen.
»Was soll der Scheiß?«, sagt er. »Wollt ihr den Bullen noch mehr Tonbänder liefern? >Jimmy Peaches Live-Album< oder was? Ihr Arschlöcher müsst jetzt zusammenhalten, verstanden? Gebt euch die Hand!«
Peaches streckt die Hand aus.
Callan nimmt sie, und Peaches legt seine andere Hand auf Callans Handrücken und zieht ihn näher heran. »Scheiße, Kleiner. Tut mir leid. Das muss die Anspannung sein, die Trauer.«
»Ich weiß. Geht mir genauso.«
»Ich liebe dich doch, du dummer Paddy-Arsch«, flüstert ihm Peaches ins Ohr. »Du willst aussteigen? Gut für dich. Steig aus, bau deine Schränke und Tische oder was immer und werde glücklich. Okay? Das Leben ist kurz. Du musst es genießen, solange du kannst.«
»Danke, Jimmy.«
Peaches lässt ihn los und sagt laut: »Wenn ich aus der Drogengeschichte raus bin, wird gefeiert, okay?«
»Okay.«
Callan wird mit den anderen ins Ravenite eingeladen, aber er geht nicht hin.
Er fährt nach Hause.
Sucht einen Parkplatz, geht die Treppe hoch und wartet eine Minute vor der Wohnungstür, bis er seinen Mut zusammengerafft hat, und schließt auf.
Sie ist da.
Sitzt im Sessel am Fenster und liest ein Buch. Und fängt an zu weinen, als sie ihn sieht. »Ich hatte gedacht, du kommst nicht zurück.«
»Und ich wusste nicht, ob du noch da bist.« Er beugt sich über sie und umarmt sie.
Sie hält ihn fest, mit beiden Armen. Als sie ihn wieder loslässt, sagt sie: »Ich dachte, wir könnten uns einen Weihnachtsbaum kaufen.«
Sie suchen sich einen hübschen aus. Er ist klein und ein bisschen dürr. Kein perfekter Baum, aber ihnen gefällt er. Sie legen schmalzige Weihnachtslieder auf und verbringen den restlichen Abend damit, den Baum zu schmücken. Und ahnen nichts davon, dass Big Paulie Calabrese einen neuen Unterboss ernannt hat: Tommy Bellavia.
Am nächsten Abend kommen sie zu ihm.
Callan läuft von der Arbeit nach Hause, seine Jeans und seine Schuhe sind voller Sägemehl. Es ist kalt, also hat er den Mantelkragen hochgeschlagen und die Mütze tief über die Ohren gezogen.
Er sieht und hört nichts von dem Auto, bis es neben ihm hält. Eine Scheibe senkt sich. »Steig ein.«
Man sieht keine Pistole, nichts. Ist auch nicht nötig. Callan weiß, dass er einsteigen muss, früher oder später, wenn nicht in dieses Auto, dann in ein anderes, also steigt er ein. Rutscht auf den Beifahrersitz, hebt die Arme und lässt sich von Sal Scachi den Mantel aufknöpfen, unter den Armen, im Kreuz und an den Beinen abtasten.
»Es ist also wahr«, sagt Scachi. »Du bist unter die Zivilisten gegangen.«
»Ja.«
»Ein Normalbürger«, sagt Scachi. »Was zum Teufel ist das? Sägemehl?«
»Ja, Sägemehl.«
»Mist, jetzt hab ich das Zeug am Mantel!«
Ein netter Mantel, denkt Callan. Muss einen halben Tausender gekosten haben.
Scachi biegt in den West Side Highway ein, Richtung Uptown, dann fährt er unter eine Brücke und hält.
Gute Stelle, denkt Callan, um jemandem die Kugel zu geben.
Sehr praktisch, so dicht am Wasser.
Er hört sein Herz hämmern.
Auch Scachi hört es.
»Hier brauchst du keine Angst zu haben, Kleiner.«
»Was willst du von mir, Sal?«
»Einen letzten Job«, sagt Scachi.
»Diese Art von Job mache ich nicht mehr.«
Er blickt auf den Hudson hinaus, hinüber zu den Lichtern von Jersey, wie sie nun mal sind. Vielleicht sollte ich mit Siobhan nach Jersey ziehen, denkt er, ein bisschen weg von dieser Scheiße. Dann können wir am Fluss spazieren gehen und die Lichter von New York sehen.
»Du hast keine Wahl, Kleiner«, sagt Scachi. Entweder du bist für uns, oder du bist gegen uns. Und wir können nicht dulden, dass du gegen uns bist, dafür bist du zu gefährlich, Billy the Kid Callan. Ich meine, du hast hinlänglich bewiesen, dass du einen Hang zur Rachsucht hast. Erinnerst du dich? Eddie Friel?«
Ja, ich erinnere mich, denkt Callan.
Ich erinnere mich, dass ich Angst hatte. Angst um mich und Angst um Stevie, und die Kanone ging los, als hätte ein anderer sie abgedrückt. Ich erinnere mich auch an den Ausdruck in Eddie Friels Augen, als ihm die Kugeln ins Gesicht reinkrachten.
Ich war siebzehn Jahre alt.
Und ich würde alles drum geben, hätte ich an diesem Nachmittag nicht in dieser Bar gesessen.
»Ein paar Leute müssen weg, Kleiner«, sagt Scachi. »Und es wäre ... unklug, wenn das einer von der Familie erledigt. Du verstehst.«
Ich verstehe, denkt Callan. Big Paulie will den Cozzo-Zweig der Familie wegputzen - Johnny Boy, Jimmy Peaches, Little Peaches -, aber er will auch behaupten können, dass er es nicht war. Will es auf die wilden Iren schieben. Uns liegt das Morden eben im Blut.
Und ich hab doch eine Wahl, denkt er.
Ich kann töten, oder ich kann sterben.
»Nein«, sagt er.
»Was nein?«
»Ich lege keine Leute mehr um.«
»Sieh mal -«
»Ich mach's nicht«, wiederholt Callan. »Wenn du mich erschießen willst, dann tu's.«
Mit einem Mal fühlt er sich frei, als wäre seine Seele schon entschwebt, als würde sie schon über dieser dreckigen Stadt schweben. Um die Sterne kurven.
»Du hast ein Mädchen, stimmt's?«
Rumms.
Wieder zurück auf dem Boden.
»Ihr Name ist irgendwie komisch«, sagt Scachi. »Wird nicht geschrieben, wie er gesprochen wird. Irgendwas Irisches, stimmt's? Nein, jetzt weiß ich's. Wie so ein alter Kleiderstoff, den die Mädchen früher getragen haben. Chiffon? Hieß sie so?«
Zurück in dieser dreckigen Welt.
»Glaubst du etwa«, sagt Scachi, »die lassen zu, dass sie zu Giuliani rennt und euer Bettgeflüster ausplaudert, wenn dir was passiert?«
»Sie weiß von nichts.«
»Tja. Aber wer geht schon so ein Risiko ein?«
Da kann man nichts machen, denkt Callan. Selbst wenn ich mir Sal schnappe, ihm mit seiner eigenen Kanone in die Fresse schieße, was ich durchaus könnte. Scachi ist Vollmitglied, und sie bringen mich um und Siobhan auch, so oder so.
»Wer ist es?«, fragt Callan.
Wen soll ich umlegen?
Nora wird vom Telefon geweckt.
Sie ist hundemüde, weil sie eine lange Nacht hinter sich hat.
»Möchtest du auf eine Party?«, fragt Haley.
»Ich glaube, eher nicht«, sagt Nora und wundert sich über die Frage. Dass sie als Partygirl arbeiten musste, ist lange her.
»Diese Party ist ein bisschen was anderes«, sagt Haley. »Sie wollen eine ganze Fuhre Mädchen, aber immer nur eine für einen. Sie haben ausdrücklich nach dir verlangt.«
»Eine Firmenweihnachtsfeier?«
»Könnte man sagen.«
Nora schaut auf ihren Radiowecker. Zehn Uhr fünfunddreißig. Sie muss aufstehen, ihren Kaffee trinken, Grapefruitsaft, dann ins Fitness-Studio.
»Komm schon«, sagt Haley. »Das wird amüsant. Sogar ich komme mit.«
»Wo ist es denn?«
»Das ist das andere Amüsante«, sagt Haley. Die Party steigt in New York.
»Ist ja Irrsinn, dieser Baum!«, staunt Nora.
Sie stehen an der Eisbahn der Rockefeller Plaza und besichtigen den riesigen Weihnachtsbaum. Die Plaza ist voll von Touristen. Weihnachtslieder aus allen Lautsprechern. Heilsarmee-Santas klingeln mit ihren Glocken, Straßenhändler bieten heiße Maronen an.
»Siehst du?«, sagt Haley. »Ich hab dir versprochen, es wird amüsant.«
Bis jetzt stimmt's, muss Nora zugeben.
Zu sechst, fünf Mädchen und Haley, sind sie mit dem Nachtflug erster Klasse in La Guardia gelandet und in zwei Limousinen zum Plaza Hotel befördert worden. Nora war natürlich schon mal hier, aber nicht zur Weihnachtszeit, das ist schon was Besonderes. Alles schön altmodisch dekoriert, und sie hat ein Zimmer mit Blick auf den Central Park, wo sogar die Pferdekutschen mit Stechpalmen und Weihnachtssternen geschmückt sind.
Nach einem kurzen Schläfchen hat sie geduscht, sich zurechtgemacht und ist mit Haley auf Shopping-Tour gegangen - Tiffany, Bergdorf und Saks -, auf der Haley eifrig kaufte, Nora aber meist nur schaute.
»Gib ein bisschen Geld aus«, hat Haley gesagt. »Du bist zu billig angezogen.«
»Nicht billig«, hat Nora erwidert, »nur zurückhaltend.«
Weil tausend Dollar nicht einfach tausend Dollar für sie sind. Sie sind so etwas wie die Zinsen für tausend Dollar, die sie, sagen wir, zwanzig Jahre lang angelegt hat. Für ein Apartment in Montparnasse, mit allem, was man für ein angenehmes Leben braucht. Sie hält ihr Geld zusammen, weil sie möchte, dass es für sie arbeitet. Aber dann kauft sie doch zwei Kaschmirschals - einen für sich, einen für Haley. Weil es so kalt ist und weil sie Haley ein Geschenk machen möchte.
»Hier«, sagt sie, als sie auf die Straße hinausgehen, und zieht einen kreidefarbenen Schal aus der Tasche. »Wickel dich ein.«
»Für mich?«
»Sollst dich nicht erkälten.«
»Das ist aber lieb von dir.«
Nora wickelt sich ihren eigenen Schal um den Hals und rückt ihren Kunstfellmantel und die Kunstfellmütze zurecht.
Es ist einer dieser klaren, eisig kalten Wintertage in New York, wenn der Wind durch die Canyons pfeift, die hier Avenues heißen, dass einem die Augen tränen.
Und Nora, als sie feuchte Augen bekommt, sich sagen kann, es liegt an der Kälte.
»Hast du schon den Baum gesehen?«, fragt Haley.
»Welchen Baum?«
»Den Weihnachtsbaum im Rockefeller Center.«
»Ich glaube nicht.«
»Dann komm.«
Da stehen sie nun, bestaunen den riesigen Baum, und Nora muss zugeben, dass New York sehr amüsant ist.
Sein letztes Weihnachten.
Genau das versucht Jimmy Peaches zu erklären. Aber Sal Scachi will es nicht kapieren.
»Das ist verdammt noch mal mein letztes Weihnachten, bevor ich in den Bau gehe!«
Sie benutzen öffentliche Fernsprecher, um die Bullen wenigstens diesmal außen vor zu lassen. »Und das für eine Ewigkeit, Sally. Die haben mich voll erwischt. Dreißig Jahre bis Lebenslänglich. Wenn ich das nächste Mal vögeln kann, bin ich wahrscheinlich zu alt.«
»Aber -«
»Kein Aber«, sagt Peaches. »Das ist meine Party. Und ich will ein fettes Steak. Wenn ich ins Copa gehe, dann mit einer heißen Braut. Ich will, dass Vic Damone singt, ich will die beste Nutte der Welt, und ich will ficken, dass die Fetzen fliegen.«
»Überleg doch mal, Jimmy, wie das aussieht!«
»Wenn ich ficke!«
»Nein, verdammt. Wenn du fünf Nuttén mitbringst«, sagt Scachi. Er ist mächtig sauer auf Jimmy Peaches. Der ist und bleibt ein Kindskopf. Aber gefährlich wie eine Zeitbombe. Man reißt sich den Arsch auf, um alles sauber zu organisieren, dann kommt dieser fette, geile Bock und fliegt fünf Nutten aus dem hintersten Kalifornien ein. Das hat gerade noch gefehlt. Fünf Nutten, die nichts auf der Besprechung zu suchen haben. Fünf unschuldige, unbeteiligte Zeugen.
»Was sagt John dazu?«
»John sagt, das ist meine Party.«
Und da kannst du Gift drauf nehmen, denkt Peaches. John ist alte Schule, John hat Klasse, nicht wie der alte Sack, den sie jetzt zum Boss gemacht haben. John ist mir wenigstens dankbar, weil ich in den Bau gehe wie ein Mann und alles nehme, wie es kommt, ohne irgendeinen Deal rauszuschinden, ohne irgendwelche Namen auszuplaudern, vor allem nicht seinen.
Was sagt John dazu? John zahlt die Rechnung für den ganzen Spaß.
Alles, was du willst, Jimmy. Es ist dein Abend. Und die Rechnung geht auf mich.
Jimmy will in Sparks Steak House und ins Copa - und er will diese kalifornische Nutte, Nora, die beste und knackigste, die er je hatte. Arsch wie ein reifer Pfirsich. Sie ist ihm in den vier Jahren nicht aus dem Kopf gegangen. Sie auf allen vieren und er von hinten, mit voller Wucht, dass der Pfirsich bebte.
»Okay«, sagt Scachi. »Und wenn die Nutten erst im Copa dazukommen, nach dem Sparks?«
»Vergiss es!«
»Jimmy -«
»Was?«
»Wir haben ernste Dinge zu besprechen.«
»Das weiß ich selbst.«
»Ich meine, ernster wird's nicht.«
»Genau deshalb«, sagt Peaches, »will ich ernsthaft feiern.«
»Versteh doch mal.« Scachi wird deutlicher. »Ich bin verantwortlich für die Sicherheit.«
»Dann sorg für meine Sicherheit«, sagt Peaches. »Mehr hast du nicht zu tun, Sal. Und danach kannst du's vergessen, okay?«
»Mir gefällt das nicht.«
»Dann gefällt's dir eben nicht«, sagt Peaches. »Fick dich ins Knie - und fröhliche Weihnachten.«
Kannst du haben, denkt Scachi, als er auflegt.
Fröhliche Weihnachten. Dein Päckchen liegt schon bereit.
Unter dem Baum liegen ein paar Geschenke.
Gut, dass der Baum so klein ist, so sehen sie nach mehr aus - das Geld ist knapp. Aber er hat eine neue Uhr für sie und ein silbernes Armband und ein paar von den Vanille-Duftkerzen, die sie so mag. Auch für ihn liegt etwas unter dem Baum - Sachen zum Anziehen, wie es aussieht, und die kann er brauchen. Ein neues Arbeitshemd, neue Jeans.
Ein nettes, bescheidenes Weihnachtsfest.
Sie haben sich vorgenommen, zur Mitternachtsmesse zu gehen.
Am Morgen die Geschenke zu öffnen, den Truthahn zu braten, am Nachmittag ins Kino zu gehen. Ein stilles, bescheidenes Weihnachtsfest. Aber es wird nichts draus, denkt Callan. Diesmal nicht.
Das Ende stand sowieso bevor, aber es kommt schneller als erwartet, weil sie das andere Päckchen findet, das Päckchen, das er unters Bett geschoben hat. Am Abend kommt er früher nach Hause, und da sitzt sie, die längliche Schachtel zu ihren Füßen.
Sie hat die Christbaumbeleuchtung eingeschaltet. Hinter ihr blinkt es rot, grün und weiß.
»Was ist das?«, fragt sie.
»Wie kommst du da ran?«
»Ich habe unterm Bett Staub gewischt«, sagt sie. »Was ist das?«
Es ist eine schwedische Maschinenpistole, eine 9mm Carl Gustaf, 45er Modell. Mit ausklappbarem Metallgriff und 36 Schuss. Mehr als genug für diesen Job. Die Nummer ist sauber weggefeilt. Mit eingeklapptem Griff ist das Teil ganze 56 Zentimeter lang. Wiegt acht Pfund. Er kann die Schachtel wie ein Weihnachtsgeschenk nach Midtown Manhattan tragen, dann das Ding rausnehmen und unter die Jacke stecken.
Sal hat es ihm zukommen lassen, und Callan hat es ihr nicht gesagt.
Nun fällt ihm nichts Dümmeres ein, als zu sagen: »Das solltest du nicht sehen.« Was soll er auch sonst sagen?
Sie lacht. »Ich dachte, das war ein Geschenk für mich. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich's aufgemacht habe.«
»Siobhan -«
»Du bist rückfällig geworden, stimmt's?« Graue Augen hart wie Stein. »Du machst wieder so einen Job.«
»Ich muss.«
»Warum?«
Er will es ihr erklären, aber er kann ihr nicht zumuten, dass sie diese Last ein Leben lang mit sich herumträgt. Also sagt er: »Das würdest du nicht verstehen.«
»O doch, ich verstehe das«, sagt sie. »Ich komme aus Belfast, wie du weißt, aus der Kashmir Road. Ich hab gesehen, wie meine Brüder und Onkel mit solchen Geschenkkartons aus dem Haus gingen, um Leute umzubringen. Maschinenpistolen unterm Bett - kenne ich. Deshalb bin ich dort weg - ich hatte dieses Morden satt. Und die Mörder.«
»Wie mich.«
»Ich dachte, du hättest dich geändert.«
»Hab ich auch.«
Sie zeigt auf die Schachtel.
»Ich muss«, wiederholt er.
»Warum?«, wiederholt sie ihre Frage. »Was ist so wertvoll, dass man dafür töten muss?« Du, denkt er.
Aber er bleibt stumm. Ein stummer Zeuge gegen sich selbst. »Wenn du zurückkommst, bin ich weg«, sagt sie. »Ich komme nicht zurück«, sagt er. »Ich muss eine Weile verschwinden.«
»Mein Gott! Hattest du vor, mir das zu erzählen, oder wolltest du einfach so abhauen?«
»Ich wollte dich bitten, mitzukommen.«
Es stimmt. Er hat zwei Pässe, doppelte Tickets. Holt sie aus der Tiefe der Schreibtischschublade und legt sie in den Deckel der Schachtel, zu ihren Füßen. Sie schaut nicht einmal hin.
»Einfach so?«, fragt sie.
Eine innere Stimme schreit: Sag's ihr, sag ihr, du tust es für sie, für uns beide. Vieh sie an, sie soll mitkommen. Er macht den Versuch, aber es geht nicht. Sie würde sich niemals verzeihen, dass sie mitgemacht hat. Sie würde dir niemals verzeihen.
»Ich liebe dich«, sagt er. »Ich liebe dich wie nichts auf der Welt.«
Sie steht auf, geht einen Schritt auf ihn zu und sagt: »Ich liebe dich nicht. Ich hab dich geliebt, aber jetzt nicht mehr. Ich liebe keinen Mörder.«
Er nickt. »Du hast recht.«
Er geht an ihr vorbei, steckt seinen Pass und sein Ticket in die Tasche, klappt die Schachtel zu und legt sie über die Schulter.
»Du kannst hier wohnen bleiben, wenn du willst«, sagt er. »Die Miete ist bezahlt.«
»Ich kann hier nicht bleiben.«
Aber es war eine schöne Wohnung, denkt er und schaut sich noch einmal um. Und die schönste und glücklichste Zeit seines Lebens. Hier in dieser Wohnung, mit ihr zusammen. Er steht da und sucht nach Worten, aber er findet keine.
»Geh«, sagt sie. »Bring jemanden um. Das hast du doch vor, oder?«
»Ja.«
Er geht runter auf die Straße, es regnet in Strömen. Ein kalter, eisiger Regen. Er klappt den Kragen hoch und wirft einen Blick zurück auf die Wohnung.
Da steht sie, am Fenster.
Mit gesenktem Kopf, die Hände vorm Gesicht.
Die Lichterkette hinter ihr blinkt rot, grün und weiß.
Ihr Kleid glitzert bei dieser Beleuchtung. Ein Top mit roten und grünen Pailletten. Sehr weihnachtlich, hat Haley dazu gesagt. Sehr sexy. Tres décolleté.
Und tatsächlich, Jimmy Peaches kann es nicht lassen, ihr in den Ausschnitt zu glotzen.
Ansonsten aber gibt er den perfekten Gentleman, das muss man ihm lassen. Macht sich überraschend gut in seinem stahlgrauen Armani. Selbst das schwarze Hemd mit der schwarzen Krawatte sieht gar nicht so schlimm aus. Ein bisschen mafiamäßig vielleicht, aber nicht wirklich unmöglich.
Das Gleiche gilt für das Restaurant. Sie hat irgendeinen sizilianischen Horror erwartet, aber Sparks Steak House erweist sich als Lokal von Geschmack. Es ist nicht gerade ihr Geschmack, die Eichentäfelung und die Jagdstiche nach englischer Art, aber das Ganze hat Stil und entspricht überhaupt nicht ihrer Vorstellung von einem Mafia-Nest.
Sie sind in mehreren Limousinen gekommen, und der Portier hat für die zwei Schritte, die sie bis zum langen grünen Baldachin zurücklegen mussten, den Regenschirm über sie gehalten. Sie erregen ziemliches Aufsehen, die Herrschaften von der Mafia mit ihren Bräuten am Arm. Die Gäste lassen die Gabel sinken und starren ungeniert - warum auch nicht, denkt Nora.
Die Mädchen sind phantastisch.
Haleys Spitzenkräfte, geliefert auf Bestellung.
Ausgewählt nach Haarfarbe, Aussehen, Figur.
Entspannte, liebenswerte, welterfahrene Frauen ohne einen Hauch von Hurenhaftigkeit. Elegant gekleidet, perfekt frisiert, mit vollendeten Manieren. Die Männer erröten vor Stolz, als sie mit ihnen durchs Lokal laufen. Die Frauen nicht. Sie betrachten das Bewundertwerden als ihr Geburtsrecht und zeigen keine sichtbaren Reaktionen.
Ein angemessen serviler Oberkellner weist ihnen den Weg.
Und alle verfolgen, wie die illustren Gäste im hinteren Raum verschwinden.
Nein, nicht alle.
Callan versäumt diesen Auftritt. Er steht an der Ecke Third Avenue und wartet auf sein Zeichen. Sieht die Limousinen, die sich durch das vorweihnachtliche Verkehrsgewühl arbeiten, dann rechts abbiegen in die 46th Street zu Sparks. Johnny Boy Cozzo, die Piccones und O-Bop vermutlich.
Er blickt auf die Uhr.
Es ist siebzehn Uhr dreißig - sie sind auf die Sekunde pünktlich.
Scachi ist schon da, um die ehrenwerten Herren und ihre Mädchen zu begrüßen. Er ist der Gastgeber, er hat das Treffen organisiert. Er küsst sogar Noras Hand (ohne sich einen Blick in ihren Ausschnitt zu verkneifen).
Donnerwetter, jetzt versteht er, warum Peaches ausgerechnet sie nach New York geholt hat - für seinen letzten Ritt. Sieht irrsinnig gut aus, die Frau. Eigentlich sehen sie alle irrsinnig gut aus, aber diese hier ...
Johnny Boy nimmt Scachi beiseite.
»Sal«, sagt er. »ich will dir nur kurz danken, dass du das für uns vorbereitet hast. Ich weiß, es hat dich viel Aufwand, viel Mühe gekostet. Wenn wir heute das erhoffte Resultat erzielen, retten wir vielleicht den Familienfrieden.«
»Genau das will ich erreichen, Johnny.«
»Und du bekommst deinen Platz an der Tafel.«
»Darauf bin ich nicht aus«, sagt Scachi. »Ich liebe meine Familie, das ist alles, Johnny. Ich möchte, dass sie stark und einig bleibt.«
»Das möchten wir alle, Sally.«
»Jetzt muss ich aber raus, nach dem Rechten sehen«, sagt Scachi.
»Klar«, sagt Johnny Boy. »Du kannst den Boss rufen. Der Boss kann kommen, denn die Untertanen sind versammelt.«
»Siehst du, das ist genau die Einstellung, die -«
Johnny Boy lacht. »Fröhliche Weihnachten, Sal.«
Sie umarmen sich und küssen sich auf die Wange.
»Fröhliche Weihnachten, Johnny.« Sal zieht seinen Mantel über und wendet sich zum Gehen. »Noch was, Johnny.«
»Ja?«
»Guten Rutsch.«
Scachi geht hinaus unter den Baldachin. Was für ein Wetter. Die Regenschwaden liegen schräg in der Luft und drohen sich in einen Eissturm zu verwandeln. Die Rückfahrt nach Brooklyn könnte zum Abenteuer werden.
Er klappt den Mantelkragen hoch und zieht das kleine Walkie-Talkie aus der Tasche. »Bist du da?«
»Ja«, antwortet Callan.
»Ich rufe jetzt den Boss rein«, sagt Scachi. »Die Zeit läuft.«
»Alles nach Plan?«
»Genau wie besprochen«, sagt Scachi. »Du hast zehn Minuten, Kleiner.«
Callan wirft die Schachtel in einen Papierkorb, schiebt die Maschinenpistole unter den Mantel und macht sich auf den Weg, die 46th Street hinunter.
In den Regen hinein.
Der Champagner fließt in Strömen.
Die Stimmung ist prächtig, es wird gelacht und gekichert.
»Tobt euch aus!«, ruft Peaches. »Champagner ist genügend da.«
Er geht mit der Flasche herum.
Nora hält ihm das Glas entgegen. Sie wird nichts trinken, nur ein wenig nippen, wenn angestoßen wird. Aber das Prickeln in der Nase gefällt ihr.
»Stoßen wir an«, sagt Peaches. »Hey, es gibt viel Schlimmes im Leben, aber es gibt auch viel Gutes. Also soll keiner trauern an diesem Freudentag. Das Leben ist schön. Wir haben eine Menge zu feiern.«
In dieser schönen Weihnachtszeit, denkt Nora.
Dann bricht die Hölle los.
Callan öffnet den Mantel und zückt die Maschinenpistole.
Er entsichert, während er im strömenden Regen sein Ziel anvisiert.
Bellavia sieht ihn zuerst. Er hält Mr. Calabrese gerade die Wagentür auf, als er herüberblickt und Callan entdeckt. In seinen Schweinsäuglein zeigt sich erst ein Funke des Wiedererkennens, dann das Erschrecken, er will gerade fragen Was hast du hier zu suchen?, aber da hat er schon begriffen und zieht die Pistole.
Viel zu spät.
Sein Arm wird zur Seite geschleudert, während eine Geschossgarbe seine Brust durchsiebt. Er fällt gegen die offene Tür des schwarzen Lincoln Continental, dann plumpst er zu Boden.
Callan richtet das Gewehr auf Calabrese.
Ihre Blicke begegnen sich, kurz bevor Callan abdrückt. Der alte Mann taumelt, fällt in den Rinnstein, scheint sich im Regenwasser aufzulösen.
Callan stellt sich über die beiden verkrümmten Körper, hält den Lauf gegen Bellavias Kopf und drückt zweimal ab. Bellavias Kopf hüpft vom nassen Beton hoch. Dann presst Callan den Lauf an Calabreses Schläfe und drückt ein weiteres Mal ab.
Er lässt das Gewehr fallen, dreht sich um und läuft ostwärts Richtung Second Avenue.
Das Blut im Rinnstein fließt hinter ihm her.
Nora hört die Schreie.
Die Tür wird aufgestoßen.
Der Oberkellner kommt herein, schreiend, draußen sei jemand erschossen worden. Nora steht auf, alle stehen auf, aber sie wissen nicht, warum. Wissen nicht, ob sie losrennen sollen oder bleiben, wo sie sind.
Dann kommt Sal Scachi und sagt es ihnen.
»Alle hiergeblieben«, sagt er. »Jemand hat den Boss ermordet.«
Wen?, fragt sich Nora. Welchen Boss?
Jetzt übertönt das Jaulen der Sirenen alles andere, doch sie zuckt hoch, als sie das Ploppen des Champagnerkorkens hört.
Das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Und alle starren auf Johnny Boy, der einfach sitzen geblieben ist und sich Champagner einschenkt.
Ein Auto wartet an der Ecke.
Die hintere Tür öffnet sich, und Callan steigt ein. Das Auto biegt östlich in die 56th Street ein, fährt zum FDR Drive, Richtung Norden. Auf dem Rücksitz liegen frische Sachen. Callan zieht seine nassen Klamotten aus und zwängt sich in die trockenen. Die ganze Zeit bleibt der Fahrer stumm, fädelt sich geschickt durch den dichten Verkehr.
Bis jetzt läuft alles nach Plan, denkt Callan. Bellavia und Calabrese hatten geglaubt, am Schauplatz eines Verbrechens aufzutauchen, ihren ermordeten Kumpan vorzufinden, waren vorbereitet gewesen auf Heulen und Zähneknirschen und den Jammerschrei: Und wir waren gekommen, um für Frieden zu sorgen!
Doch Sal Scachi und die Familie hatten andere Pläne.
Wer dealt, der stirbt. Aber wer nicht dealt, stirbt erst recht, denn Geld und Macht hat der, der dealt. Und wer den anderen Familien alles Geld und alle Macht überlässt, begeht langsam, aber sicher Selbstmord. Das war Scachis Überlegung, und sie war korrekt.
Also musste Calabrese gehen.
Und Johnny Boy musste Boss werden.
»Das ist so mit den Generationen«, hat ihm Scachi erklärt. »Das Alte muss dem Neuen weichen.«
Natürlich dauert es eine Weile, bis sich die Wogen glätten.
Johnny Boy wird jede Beteiligung leugnen, weil ihm die Vorstände der anderen vier Familien, oder was von ihnen übrig ist, niemals erlaubt hätten, ohne ihre Einwilligung zu handeln, und ihre Einwilligung hätten sie niemals gegeben. (»Ein Boss«, hat Scachi ihn belehrt, »sanktioniert niemals die Beseitigung eines anderen Bosses.«) Also wird Johnny Boy geloben, dass er die Schweinehunde, die seinen Boss umgelegt haben, zur Strecke bringt, und es wird noch ein paar widerborstige Calabrese-Getreue geben, die ihrem Boss in die nächste Welt folgen müssen, aber am Ende werden sich die Wogen glätten.
Johnny Boy wird sich widerstrebend zum neuen Boss küren lassen.
Die anderen Bosse werden ihn akzeptieren. Und der Kokain-Nachschub wird wieder klappen. Reibungslos. Von Kolumbien über Honduras und Mexiko bis nach New York.
Wo es endlich wieder eine weiße Weihnacht geben wird.
Aber nicht für mich, denkt Callan.
Er öffnet die Segeltuchtasche auf dem Boden.
Wie vereinbart, hunderttausend Dollar in bar, ein Pass, Flugtickets, Sal Scachi hat an alles gedacht. Ein Ausflug nach Südamerika und ein neuer Job.
Das Auto biegt ab auf die Auffahrt zur Triborough Bridge.
Selbst bei diesem Regen kann Callan die Skyline von Manhattan erkennen. Irgendwo da drüben, denkt er, hat sich mein Leben abgespielt. Hell's Kitchen, Sacred Heart, das Liffey, das Landmark, Glocca Morra, der Hudson. Michael Murphy, Kenny Mäher, Eddie Friel. Dann Jimmy Boylan, Larry Moretti und Matty Sheehan.
Und jetzt Tommy Bellavia und Paulie Calabrese. Als lebende Gespenster bleiben zurück - Jimmy Peaches. Und O-Bop. Siobhan.
Er blickt zurück auf Manhattan, aber er sieht die Wohnung vor sich. Wie Siobhan am Samstagvormittag an den Frühstückstisch kommt. Mit trockengerubbelten Haaren, ohne Make-up, und so schön. Wie sie dasitzt, über ihrem Kaffee und der Zeitung, die meist ungelesen bleibt, und auf den grauen Hudson und die Skyline von Jersey hinausblickt.
Callan ist mit Mythen aufgewachsen.
Cuchulain, Edward Fitzgerald, Wolfe Tone, Roddy McCorley, Pádraic Pearse, James Connelly, Sean South, Sean Barry, John Kennedy, Bobby Kennedy, Bloody Sunday, Jesus Christus.
Und alle enden sie blutig.
DRITTER TEIL
Die NAFTA
8 Die Tage der unschuldigen Kinder
Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, viel Klagens, Weinens und Heulens; Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen.
Matthäus 2,18
Tegucigalpa, Honduras San Diego, Kalifornien Guadalajara, Mexiko
1992
Keller sitzt auf einer Parkbank in Tegucigalpa. Er schaut dem Mann im braunen Adidas-Trainingsanzug nach, der soeben sein Haus verlassen hat.
Ramón Mette hat sieben solcher Anzüge - einen für jeden Tag. Jeden Tag zieht er einen frischen an und verlässt seine Villa im Vorort Tegus, um drei Meilen zu joggen, begleitet von zwei Bodyguards im passenden Outfit, nur dass sich ihre Trainingsanzüge an ungewöhnlichen Stellen ausbeulen - wegen der Mac-10-Maschinenpistolen, mit denen sie seine morgendlichen Runden absichern.
Mette dreht also jeden Morgen seine Runden, dann duscht er, während ihm einer der Bodyguards einen Smoothie bereitet. Mangofrüchte, Papayas, Pampelmusen und, da wir hier in Honduras sind, auch Bananen. Mette geht mit dem Glas auf den Patio hinaus und schlürft seinen Smoothie, während er die Zeitung liest. Macht ein paar Anrufe, zieht ein paar Geschäfte durch, dann geht er in sein privates Fitnessstudio und stemmt Gewichte.
Das ist sein Programm.
Nach der Uhr, Tag für Tag.
Seit Monaten.
Nur an diesem Morgen ist es anders. Als Mette zurückkommt, schwitzend und keuchend durch die Tür tritt, die ihm der Bodyguard aufhält, trifft ihn der Knauf einer Pistole seitlich am Kopf.
Er geht in die Knie - vor Art Keller.
Sein Bodyguard bleibt mit erhobenen Händen stehen, denn ein schwarz gekleideter honduranischer Geheimdienst-Söldner hält ihm eine M16 an die Schläfe. Sehr seltsam, denkt Mette, obwohl ihm der Kopf dröhnt. Das müssen an die fünfzig Söldner sein. Wo kommen die her? Ich kontrolliere doch den Geheimdienst.
Offenbar nicht, denn keiner von denen zuckt auch nur, als Art Keller ihm das Gebiss eintritt. Keller steht über ihm und sagt: »Das war die letzte Runde, die du gedreht hast. Ich hoffe, sie hat Spaß gemacht.«
Anstelle des Smoothie schlürft Mette sein eigenes Blut, während Keller ihm die berühmte schwarze Kapuze über den Kopf stülpt, sie festschnürt und ihn im Klammergriff zum Lieferwagen mit den abgedunkelten Scheiben hinausführt. Und diesmal hat keiner was dagegen, dass sie ihn in eine Air-Force-Maschine verfrachten, nach Santo Domingo fliegen, in der amerikanischen Botschaft abliefern, wo er wegen Mordes an Ernie Hidalgo verhaftet und in einer anderen Maschine nach San Diego gebracht wird, um sofort unter Anklage gestellt und in einer Einzelzelle des Bundesgefängnisses verstaut zu werden - Kaution ausgeschlossen.
All das führt zu Aufruhr in den Straßen von Tegucigalpa, wo Tausende empörte Bürger, aufgestachelt und bezahlt von Mettes Anwälten, die amerikanische Botschaft niederbrennen - aus Protest gegen den Yankee-Imperialismus. Sie wollen wissen, woher dieser amerikanische Agent die Frechheit nimmt, einen der angesehensten Bürger von Tegucigalpa zu entführen - einfach so.
Eine Menge Leute in Washington fragen sich das auch. Sie würden auch gern wissen, woher Art Keller, der in Ungnade gefallene ehemalige Resident des geschlossenen DEA-Büros in Guadalajara, die Frechheit nimmt, einen internationalen Zwischenfall zu provozieren. Nicht nur die Frechheit, auch die Logistik, das Ganze durchzuziehen.
Quito Fuentes ist nur ein kleiner Fisch.
Das war er auch 1985, als er den gefolterten Ernie Hidalgo vom Stützpunkt in Guadalajara zur Ranch in Sinaloa karrte. Jetzt wohnt er in Tijuana und macht kleine Drogendeals mit Amerikanern, die über die Grenze kommen, um sich mit einem kleinen Vorrat einzudecken.
Doch auch diese Art von Geschäft nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Es kann immer passieren, dass sich so ein Yankee-Kid für einen echten bandito hält, dir dein Zeug abknöpft und sich in Richtung Grenze entfernt. Nein, man braucht ein ordentliches Schießeisen, und das Ding, das Quito da hat, taugt einen Dreck.
Quito braucht eine neue Kanone.
Die, entgegen der landläufigen Auffassung, in Mexiko, wo die Polizei das Waffenmonopol besitzt, nicht so einfach zu kriegen ist. Glücklicherweise wohnt Quito in Tijuana, hat also Los Estados Unidos, den größten Waffenmarkt der Welt, direkt vor der Haustür, und er ist ganz Ohr, als ihn Paco Méndez aus Chula Vista anruft und ihm einen Deal anbietet. Eine saubere Mac-10, die er loswerden will.
Quito braucht sie nur abzuholen.
Aber Quito fährt nicht mehr so gern über die Grenze nach Norden.
Seit der Sache mit Hidalgo, dem Yankee-Cop.
In Mexiko wird man ihm deshalb nichts anhängen, aber in den USA sieht das ganz anders aus, also bedankt er sich bei Paco und fragt, ob der ihm das Ding nicht nach Tijuana bringen kann. Es ist eher eine hypothetische Frage, denn entweder muss man sehr gute Beziehungen haben, wenn man irgendwelche Waffen, gar noch eine Maschinenpistole, nach Mexiko schmuggeln will, oder man muss ein Volltrottel sein. Wer dabei erwischt wird, den schlagen die Federales windelweich, bevor er seine Mindeststrafe von zwei Jahren Gefängnis antritt. In den mexikanischen Gefängnissen gibt es keine Verpflegung, das ist Sache der Angehörigen, wie Paco weiß, nur hat er in Mexiko keine Angehörigen mehr. Und da er weder besonders gute Beziehungen hat noch ein Volltrottel ist, sagt er zu Quito, dass er ihm den Gefallen nicht tun kann.
Aber weil er die Macio dringend zu Geld machen muss, vertröstet er Quito: »Ich denke drüber nach und ruf dich zurück.«
Er legt auf und sagt zu Art Keller: »Er kommt nicht rüber.«
»Dann hast du ein Riesenproblem«, sagt Keller.
Und das ist kein Scherz. Eine Anklage wegen Kokain und Waffenbesitz. Nur für den Fall, dass Paco damit nicht zu beeindrucken ist, fügt Keller hinzu: »Ich bringe das vors Bundesgericht und beantrage noch zusätzliche Haftstrafen.«
»Ich geb mir ja schon Mühe!«, jammert Paco.
»Mühe allein genügt nicht«, sagt Keller.
»Sie sind ein richtiger Gangster, wissen Sie das?«
»Ich weiß«, sagt Keller. »Fragt sich, ob du das weißt.«
Paco sackt auf seinem Stuhl zusammen.
»Okay«, sagt Keller. »Hol ihn an den Zaun.«
»Wirklich?«
»Den Rest erledigen wir.«
Also geht Paco wieder ans Telefon und bestellt Quito in den Coyote Canyon, an den löchrigen Grenzzaun. Niemandsland.
Wer sich nachts in den Coyote Canyon wagt, sollte das nicht unbewaffnet tun, und selbst dann kann es sehr gefährlich werden, weil man nicht der Einzige ist, dem dort das Schießeisen locker sitzt. Coyote Canyon zieht sich wie eine Narbe durch die kahlen Wüstenberge entlang der Pazifikküste. Er beginnt in Tijuana, reicht etwa zwei Meilen weit in die USA und gehört den Banditen. Jeden Nachmittag sammeln sich Tausende von Grenzgängern an den beiden Rändern des Canyons über dem stillgelegten Aquädukt, der die Staatsgrenze markiert. Wenn die Sonne untergeht, rennen sie los, quer durch den Canyon, und überwinden die Grenzwachen einfach kraft ihrer Überzahl. Eine einfache Rechnung: Einige werden gefasst, viele kommen durch. Und für die, die gefasst werden, gibt es immer noch den nächsten Tag. Vielleicht.
Denn auch die banditos liegen auf der Lauer, wenn der Pulk der mojados nach Norden strömt. Greifen sich die Schwachen und Kranken. Rauben, schänden, morden. Nehmen das bisschen Geld, das die Illegalen bei sich tragen, zerren die Frauen in die Büsche und vergewaltigen sie, schlitzen ihnen die Kehle auf.
Wer in den Estados Unidos Orangen pflücken will, muss im Coyote Canyon Spießruten laufen. Und mitten im Chaos, im Staub, den Tausende Füße aufwirbeln, in der Dunkelheit voller Schreie, Schüsse, blitzender Klingen und Grenzer in Patrouillenfahrzeugen, die dröhnend durch die Hügellandschaft kurven wie Cowboys, die einer durchgegangenen Rinderherde nachjagen, werden auch Geschäfte abgewickelt.
Es geht um Drogen, Sex und Waffen.
Und heute Nacht duckt sich auch Quito neben ein Loch im Grenzzaun.
»Hast du die Waffe?«, fragt er Paco. »Erst das Geld.«
Quito sieht die Macio im Mondlicht glänzen, daher ist er ziemlich sicher, dass ihn sein alter cuate nicht übers Ohr haut. Er streckt die Hand durchs Loch, um Paco das Geld zu geben, und Paco greift -
- nicht nach dem Geld, sondern nach seinem Handgelenk. Und hält es fest.
Quito will die Hand zurückziehen, aber plötzlich sind da drei Yankees, halten ihn fest, und einer sagt: »Sie sind verhaftet wegen Mordes an Ernie Hidalgo.«
Quito sagt: »Sie können mich nicht verhaften, ich bin in Mexiko.«
»Kein Problem«, sagt Keller.
Und zieht ihn hinüber in die Vereinigten Staaten, zerrt ihn einfach durch das Loch im Zaun, aber ein spitzer Draht hakt sich in Quitos Hose fest. Keller lässt nicht locker, und der Draht bohrt sich in sein Gesäß und kommt auf der anderen Seite wieder heraus.
Da liegt er also genau auf der Grenzlinie und schreit: »Ich hänge fest, ich hänge fest!«
Keller kümmert das nicht. Er stemmt den Fuß gegen den Zaun und zieht Quito mit einem Ruck auf die amerikanische Seite. Quito schreit jetzt erst richtig los, weil er verletzt ist und blutet, weil er in Amerika ist und weil die Yankees auf ihn eindreschen. Sie stopfen ihm einen Lappen in den Mund, damit er still ist, legen ihm Handfesseln an und schleppen ihn zu einem Jeep. Quito sieht ein Patrouillenfahrzeug und will um Hilfe schreien, aber der Grenzer dreht ihm den Rücken zu, als ginge ihn das nichts an.
Das alles erzählt Quito dem Haftrichter, der Keller streng anblickt und ihn fragt, wo die Verhaftung stattgefunden hat.
»Der Beschuldigte wurde auf dem Territorium der Vereinigten Staaten verhaftet, Euer Ehren«, versichert Keller. »Auf amerikanischem Boden.«
»Der Beschuldigte sagt aus, Sie hätten ihn durch den Zaun gezogen.«
»Davon ist kein Wort wahr, Euer Ehren«, versichert Keller, während Quitos Verteidiger vor Empörung in die Höhe springt. »Fuentes hat aus eigenem Antrieb die Grenze übertreten, um eine illegale Waffe zu kaufen. Dafür können wir einen Zeugen benennen.«
»Wäre das Mr. Méndez?«
»Ja, Euer Ehren.«
»Euer Ehren«, protestiert der Verteidiger. »Mr. Méndez hat eindeutig einen Deal mit -«
»Es gab keinen Deal«, sagt Keller. »So wahr mir Gott helfe.«
Mit dem Arzt wird es nicht ganz so einfach.
Doktor Alvarez betreibt eine florierende gynäkologische Praxis in Guadalajara, und nichts kann ihn in die USA locken oder auch nur in die Nähe der Grenze. Er weiß, dass die DEA über seine Rolle beim Hidalgo-Mord im Bilde ist, er weiß, dass Keller hinter ihm her ist, also bleibt er immer schön in Guadalajara.
»Die in Mexico City machen schon ein Riesengeschrei wegen Quito Fuentes«, sagt Tim Taylor zu Keller.
»Sollen sie schreien.«
»Sie haben gut reden.«
»Ja, allerdings.«
»Und ich sage Ihnen, Keller, Sie können da nicht einfach rein und sich den Arzt holen, da machen die Mexikaner nicht mit. Und sie liefern ihn auch nicht aus. Das ist nicht Honduras, das ist nicht der Coyote Canyon. Akte geschlossen.«
Vielleicht für dich, denkt Keller.
Aber nicht für mich.
Nicht bevor die Mörder von Ernie tot oder hinter Gittern sind.
Und wenn wir nicht dürfen, die Mexikaner nicht wollen, dann muss ich mir einen suchen, der es kann. Keller fährt nach Tijuana.
Wo Antonio Ramos ein kleines Restaurant betreibt.
Er findet den dicken Ex-Cop vor dem Lokal, die Füße auf dem Tisch, die Zigarre im Mund und ein kaltes Tecate-Bier in Griffweite.
»Wenn du ein gutes Chile verde willst, dann ist das hier nicht das richtige Lokal«, sagt er, als er Keller kommen sieht.
»Nein, will ich nicht«, sagt Keller und setzt sich. Er bestellt ein Bier bei der Serviererin, die blitzschnell zur Stelle ist.
»Was dann?«, fragt Ramos.
»Nicht was - wen«, sagt Keller. »Doktor Humberto Alvarez.« Ramos schüttelt den Kopf. »Ich bin aus dem Rennen.«
»Ich weiß.«
»Außerdem haben sie den Geheimdienst zerschlagen«, sagt Ramos. »Einmal im Leben mache ich das große Ding, und die lassen alles im Sande verlaufen.«
»Trotzdem. Ich brauche deine Hilfe.«
Ramos schwingt die Beine vom Tisch, beugt sich vor, bis nahe an Kellers Gesicht. »Ich hab dir geholfen. Schon vergessen? Ich liefere dir den verfluchten Barrera vor die Flinte, und du drückst nicht ab. Du wolltest keine Rache, du wolltest Gerechtigkeit. Und hast weder das eine noch das andere bekommen.«
»Ich habe noch nicht aufgegeben.«
»Das solltest du aber«, sagt Ramos. »Weil es keine Gerechtigkeit gibt, und richtige Vergeltung willst du nicht. Du bist kein Mexikaner. Es gibt nicht viele Dinge, die wir wichtig nehmen. Aber die Vergeltung gehört dazu.«
»Sie ist mir wichtig.«
»Das glaube ich dir nicht.«
»Sie ist mir hunderttausend Dollar wert.«
»Du bietest mir hunderttausend Dollar für die Beseitigung von Alvarez?«
»Nicht für die Beseitigung«, sagt Keller. »Für die Entführung. Hol ihn dir. Setz ihn in ein Flugzeug, damit ich ihn vor ein US-Gericht stellen kann.«
»Siehst du, genau das meine ich«, sagt Ramos. »Du bist ein Weichling. Du willst Vergeltung, aber du traust dich nicht. Und kommst mir mit deinem Gerede von einem fairen Prozess. Erschießen - und fertig. Ganz einfach.«
»Ich will es aber nicht einfach«, sagt Keller. »Ich will, dass er leidet. So lange wie möglich. Ich will, dass er in irgendeinem Höllenloch von Bundesknast verfault, und hoffe, dass er ein langes Leben hat. Der Weichling bist du. Du willst ihm die Qualen ersparen.«
»Ich weiß nicht...«
»Ein Weichling, der sich langweilt. Erzähl mir nicht, du hast keine Langeweile. Vergeudest hier deine Zeit mit Tamales für Touristen. Du hast doch die Zeitung gelesen. Du weißt, dass ich Mette und Fuentes schon habe. Als Nächsten hole ich mir den Arzt, mit deiner Hilfe oder ohne. Und dann ist Barrera dran. Mit deiner Hilfe oder ohne.«
»Hunderttausend?«
»Hunderttausend.«
»Ich brauch ein paar Leute ...«
»Du kriegst hunderttausend für den Job«, sagt Keller. »Wie du die verteilst, ist deine Sache.«
»Bist doch ein harter Knochen.«
»Kannst du annehmen.«
Ramos nimmt einen langen Zug von seiner Zigarre und lässt perfekt geformte Rauchringe davonschweben. Dann sagt er: »Mist, ich verdiene nichts mit diesem Laden. Okay, abgemacht.«
»Ich will ihn lebend«, sagt Keller. »Bringst du mir eine Leiche, kannst du auf das Geld pfeifen.«
»Sí, sí, si...«
Dr. Humberto Alvarez Machain verabschiedet die letzte Patientin, geleitet sie galant hinaus, wünscht seiner Sprechstundenhilfe einen schönen Abend und geht in sein Arbeitszimmer, um noch ein paar Papiere zu holen und dann nach Hause zu fahren. Die sieben Männer, die durch die Praxistür kommen, hört er nicht. Er schreckt erst auf, als Ramos in sein Zimmer tritt, eine Schreckschusspistole auf seinen Fuß richtet und abdrückt.
Alvarez geht zu Boden und krümmt sich vor Schmerzen.
»Sie haben Ihre letzte Fotze gesehen, Doktor«, sagt Ramos. »Da, wo Sie hinkommen, gibt es keine Muschis.«
Er gibt einen weiteren Schreckschuss ab. »Tut verdammt weh, oder?«
»Ja«, stöhnt Alvarez.
»Gut so.«
Sie verbinden ihm die Augen, fesseln ihm die Hände mit Telefonkabel und bringen ihn durch die Hintertür zu einem Auto, das in der Seitenstraße wartet. Alvarez wird hinter den Vordersitzen auf den Boden geworfen, Ramos steigt hinten ein und setzt ihm den Fuß in den Nacken.
Im verdunkelten Wohnzimmer eines Vorstadthauses nehmen sie ihm die Augenbinde ab.
Alvarez fängt an zu weinen, als er den Mann sieht, der vor ihm sitzt.
»Wissen Sie, wer ich bin?«, fragt Keller. »Ernie Hidalgo war mein bester Freund. Un hermano. Blut von meinem Blut.« Jetzt zittert Alvarez wie Espenlaub.
»Sie waren sein Folterer«, sagt Keller. »Sie haben mit Metallstacheln an seinen Knochen gekratzt, Sie haben glühende Eisenstangen in ihn hineingeschoben. Sie haben ihm Spritzen verpasst, damit er bei Bewusstsein blieb.«
»Nein!«, sagt Alvarez.
»Hören Sie auf zu lügen. Das macht mich nur noch wütender. Ich habe das auf Tonband.«
Auf der Hose des Arztes erscheint ein feuchter Fleck und breitet sich aus, am Hosenbein entlang.
»Er bepisst sich«, sagt Ramos.
»Zieh ihn aus.«
Sie ziehen ihm das Hemd über den Kopf und lassen es von seinen gefesselten Handgelenken baumeln. Reißen ihm Hose samt Shorts herunter bis zu den Knöcheln. Seine Augen weiten sich in Panik. Erst recht, als Ramos sagt: »Schnuppern Sie mal. Riechen Sie was?«
Alvarez schüttelt den Kopf.
»Aus der Küche«, sagt Ramos. »Sie kennen den Geruch. Nein? Okay - glühendes Metall. Eine Stahlstange auf dem Herdfeuer.«
Einer von seinen Männern kommt herein, mit dem Kochhandschuh hält er eine rotglühende Eisenstange. Alvarez wird ohnmächtig. »Mach ihn wieder munter«, sagt Keller. Ramos schießt ihn in die Wade. Alvarez kommt zu sich und schreit. »Legt ihn über die Lehne.«
Sie packen Alvarez und legen ihn bäuchlings über die Seitenlehne des Sofas. Zwei Männer drücken seine Beine an den Boden. Der Mann mit dem glühenden Eisen kommt und hält es dem Arzt unter die Nase.
»Nein, bitte ... bitte nicht.«
»Ich will die Namen«, sagt Keller. »Die Namen von allen, die bei Ernie Hidalgo dabei waren. Und zwar schnell.« No problema.
Alvarez rasselt die Namen herunter wie ein Schnellredner auf Speed.
»Adán Barrera, Raúl Barrera, Ángel Barrera, Gúero Méndez-«
»Wie bitte?«
»Adán Barrera, Raúl Barrera -«
»Nein, der letzte Name.«
»Gúero Méndez.«
»Der war auch dort?«
»Sí, sí, sí. Der war der Anführer, Señor.« Alvarez schnappt nach Luft, dann sagt er: »Er hat Hidalgo getötet.«
»Und wie?«
»Mit einer Überdosis Heroin. Ein Unfall. Wir wollten ihn freilassen. Ich schwöre es.«
»Nehmt ihn hoch.«
Der Arzt ist ein schluchzendes Bündel.
»Sie werden jetzt eine schriftliche Aussage machen«, sagt Keller. »Alles über Ihre Beteiligung. Alles über die Barreras und über Méndez. Verstanden?«
»Verstanden.«
»Und eine zweite Aussage. Sie bestätigen, dass Sie weder gefoltert noch anderweitig zu dieser Aussage gezwungen wurden. Verstanden?«
»Si.« Und schon fängt er an zu verhandeln. »Kommen Sie mir in irgendeiner Weise entgegen, wenn ich kooperiere?«
»Ich lege ein Wort für Sie ein«, sagt Keller.
Sie setzen ihn an den Küchentisch und geben ihm Stift und Papier. Nach einer Stunde sind beide Aussagen fertig. Keller liest sie durch, steckt sie weg. »Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug.«
»No, Señor!«, schreit Alvarez. Mit kleinen Ausflügen kennt er sich aus. Gewöhnlich enden sie in einer Grube.
»In die Vereinigten Staaten«, sagt Keller. »Auf dem Flugplatz wartet eine Maschine. Sie fliegen doch sicher aus eigenem Entschluss.«
»Ja, natürlich.«
Und ob er freiwillig fliegt!, denkt Keller. Der Mann hat gerade die Barreras und Gúero Méndez verraten. Seine Lebenserwartung in Mexiko liegt praktisch bei null. Keller hofft, dass er im Bundesgefängnis von Marion ein biblisches Alter erreicht.
Zwei Stunden später sitzt Alvarez gewaschen und frisch eingekleidet in einem Flugzeug nach El Paso, wo er verhaftet wird, wegen Folterung und Ermordung von Ernie Hidalgo. Nach der Festnahme wird er nackt fotografiert, von allen Seiten, zum Beweis, dass er nicht gefoltert wurde.
Und Keller, getreu seinem Versprechen, legt ein gutes Wort für Alvarez ein und spricht sich vor den Bundesanwälten gegen die Todesstrafe aus.
Er will ein Lebenslänglich ohne Anspruch auf Bewährung, ohne einen Funken Hoffnung.
Die mexikanische Regierung protestiert, ganze Schwärme amerikanischer Bürgerrechtsanwälte stimmen in den Protest ein, aber Mette und Alvarez sitzen im Hochsicherheitstrakt von Marion und warten auf ihre Berufungsverhandlung, Quito Fuentes sitzt in einer Zelle in San Diego, und niemand legt Art Keller irgendwelche Hindernisse in den Weg.
Die es wollen, können nicht.
Die es können, wollen nicht.
Denn er hat gelogen.
Art Keller hat das Blaue vom Himmel heruntergelogen, als er vor dem Senatsuntersuchungsausschuss stand, der den Gerüchten nachgehen sollte, dass die CIA in irgendeiner Weise in die Drogen- und Waffengeschäfte der Contras verwickelt war. Keller hat den Wortlaut der Befragung im Kopf - wie die Tonspur eines Films, die er nicht löschen kann.
Frage: Haben Sie jemals von einer Luftfrachtfirma namens SETCO gehört? Antwort: Flüchtig.
F: Sind Sie oder waren Sie jemals der Ansicht, dass mit Flugzeugen der SETCO Kokain transportiert wurde? A: Darüber habe ich keine Kenntnis. F: Kennen Sie den Ausdruck »Mexikanisches Trampolin«? A: Nein.
F: Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie unter Eid aussagen?
A: Ja.
F: Sagt Ihnen die Abkürzung TIWG etwas?
A: Was ist das?
F: Die Arbeitsgruppe Terrorismus.
A: Nie gehört.
F: Die NSD-Direktive Nr. 3?
A: Nein.
F: Die NHAO?
Kellers Anwalt beugt sich vor und spricht ins Mikrofon: »Sir, mieten Sie doch lieber ein Boot, wenn Sie im Trüben fischen wollen.«
F: Haben Sie je etwas von der NHAO gehört?
A: Ja, neulich stand was in der Zeitung.
F: Hat die NHAO Druck auf Sie ausgeübt, um Ihre Aussage zu beeinflussen?
»Das lasse ich nicht länger zu!«, ruft Kellers Anwalt.
F: Hat zum Beispiel Colonel Craig Druck auf Sie ausgeübt?
Die Frage erfüllt ihren Zweck. Sie macht die Presse hellhörig.
Colonel Scott Craig hat einem anderen Untersuchungsausschuss das Sternenbanner in den Arsch gerammt, samt Mast und allem Drum und Dran, als der versuchte, ihn auf den Deal mit den Iranern festzunageln, den Tausch von Waffen gegen Geiseln. Im Verlauf der Sache wurde Craig zum amerikanischen Volkshelden, zum Liebling der Medien, zum Fernsehpatrioten. Die ganze Nation starrte auf die Iran-Contra-Affäre, einen lächerlichen Nebenkriegsschauplatz, ohne den eigentlichen Skandal zu bemerken - dass die US-Regierung den Contras bei ihren Drogengeschäften geholfen hatte: Drogen gegen Waffen. Daher sorgt die Frage, ob Art Keller von Colonel Craig zum Schweigen gebracht wurde - von dem Mann, den Keller zuletzt beim Entladen von Kokain in Ipongo gesehen hatte -, für einen dramatischen Höhepunkt.
»Das ist ungeheuerlich, Sir«, ruft Kellers Anwalt.
F: Ganz Ihrer Meinung. Ist Ihr Klient bereit, die Frage zu beantworten?
A: Ich bin hier, um Ihre Fragen wahrheitsgemäß und korrekt zu beantworten, und das versuche ich nach besten Kräften. F: Wollen Sie also die Frage beantworten?
A: Oberst Craig habe ich nie gesehen, und ich habe nie etwas mit ihm zu tun gehabt.
Die Presse schläft wieder ein.
F: Wie steht es mit dem Wort »Kerberos«, Mr. Keller? Haben Sie je davon gehört?
A: Nein.
F: War jemand mit dem Namen Kerberos in den Mord an Hidalgo verwickelt?
A: Nein.
Bei dieser Antwort verließ Althea die Zuschauertribüne. Später, im Watergate Hotel, sagte sie zu Keller: »Diese Senatoren merken vielleicht nicht, wenn du lügst, Art. Aber ich schon.«
»Können wir nicht einfach nett mit den Kindern essen gehen?« fragte er.
»Wie konntest du nur?«
»Was denn?«
»Dich gemein machen mit einem Haufen rechtsgerichteter-«
»Stopp!«
Er hielt die Hand hoch und kehrte ihr den Rücken zu. Er hatte die Vorwürfe satt.
Er hat es satt, überhaupt noch was zu hören, dachte Althea. Als er damals in den letzten Monaten in Guadalajara immer so abwesend gewirkt hatte, war das noch ein Zuckerlecken gewesen im Vergleich zu dem, was dann kam, als er aus Mexiko nach Hause kam. Oder nicht nach Hause kam - jedenfalls nicht als der Mann, den sie gekannt hatte. Er redete nicht mehr, er hörte nicht mehr zu. Die meiste Zeit seiner »Beurlaubung« saß er allein am Pool ihrer Eltern oder machte lange, einsame Spaziergänge durch Pacific Palisades oder am Strand. Beim Essen sprach er kaum oder, schlimmer noch, er hielt ihr lange, erbitterte Vorträge über Politik, um sich dann zu entschuldigen, nach oben zu gehen oder zu einem nächtlichen Spaziergang aufzubrechen. Spätnachts dann lag er schlaflos im Bett, befingerte die Fernbedienung, zappte sich wie ein Speedfreak durch die Programme und nannte sie allesamt Mist und wieder Mist. Schliefen sie dann doch einmal miteinander (wenn man das überhaupt noch so nennen konnte), war er aggressiv und hastig, als wollte er seine Wut an ihr auslassen, statt sie einfach nur zu lieben oder sich mit ihr zu vergnügen.
»Ich bin kein Sandsack«, sagte sie eines Nachts, als er auf ihr lag und eine seiner gefürchteten postkoitalen Depressionen durchlebte.
»Ich hab dich nie geschlagen.«
»Das meinte ich auch nicht.«
Er blieb ein pflichttreuer Vater, spielte seine gewohnte Daddy-Rolle, aber es war, als würde er nur einer alten Routine gehorchen. Wie sein eigenes Roboter-Double ging er mit den Kindern in den Park, brachte er Michael das Surfen auf dem Bodyboard bei, Cassie das Tennisspielen. Die Kinder spürten, dass etwas nicht stimmte.
Althea schlug ihm eine Behandlung vor.
Er lachte. »Eine Psychotherapie?«
»Oder ein Lebensberater, was immer.«
»Die verschreiben einem nur Tabletten«, sagte er.
Grundgütiger, dann nimm sie doch!, dachte sie.
Als die Vorladungen kamen, wurde es noch schlimmer.
Die Termine bei den DEA-Bürokraten, den Regierungsstellen, den Ermittlern vom Kongress. Sie hatte Angst, die Anwaltskosten könnten sie ruinieren, aber er sagte immer nur, sie solle sich keine Sorgen machen. »Es ist für alles gesorgt.« Sie wusste nicht, wo das Geld herkam, aber irgendwo musste es herkommen, denn sie sah nie auch nur eine einzige Anwaltsrechnung.
Keller natürlich verweigerte jedes Gespräch darüber.
»Ich bin deine Frau«, beschwor sie ihn eines Nachts. »Warum vertraust du dich mir nicht an?«
»Es gibt Dinge, die du nicht wissen darfst«, sagte er.
Er wollte ja mit ihr reden, ihr alles erklären, ihr wieder näherkommen, aber es ging nicht. Da war diese unsichtbare Wand wie in einem Science-Fiction-Film - nicht zwischen ihnen, sondern in ihm drin -, die er einfach nicht durchbrechen konnte. Es war, als würde er im Wasser leben, unter Wasser, und hochblicken zum Licht der wirklichen Welt, aber immer nur die vom Wasser verzerrten Gesichter seiner Frau und seiner Kinder sehen, als könnte er nicht nach oben greifen, sie berühren - genauso wenig wie sie ihn.
Stattdessen tauchte er noch tiefer.
Zog sich in sein Schweigen zurück, das schleichende Gift für jede Ehe.
An dem Tag im Watergate Hotel sah er Althea an und begriff: Sie wusste, dass er abgetaucht war - ganz tief gesunken war und für die Regierung gelogen hatte, ihr geholfen hatte, einen dreckigen Deal zu kaschieren, der Tonnen von Crack in die amerikanischen Gettos gespült hatte.
Aber sie kannte nicht den Grund, warum er das getan hatte.
Und das ist er, der Grund, denkt Keller, als er durch die Jalousien auf das Haus gegenüber schaut, Calle Cosmos 2718, wo sich Tío Barrera versteckt.
»Jetzt hab ich dich, du Dreckskerl«, sagt er, »und diesmal haut dich keiner raus.«
Tío wechselt seinen Unterschlupf alle paar Tage, wechselt ständig zwischen Dutzenden von Wohnungen und Häusern in Guadalajara. Entweder aus Angst vor der Verhaftung oder, wie es das Gerücht will, weil er zu viel von seiner eigenen Ware raucht. Die Paranoia jedenfalls ist unverkennbar.
Und hat gute Gründe, denkt Keller. Jetzt beobachtet er Tío schon drei Tage in dieser Wohnung. Eine lange Zeit für seine Verhältnisse, deshalb wird er heute Nachmittag vermutlich umziehen.
Oder glauben, dass er's tut.
Keller hat seine eigenen Vorstellungen von Tíos Umzug.
Aber die Sache muss richtig eingefädelt werden.
Die US-Regierung hat den Mexikanern versprochen, dass alles ohne Aufsehen geschieht. Vor allem ohne Kollateralschäden. Und Keller soll so schnell wie möglich verschwinden. Das Ganze soll aussehen wie ein mexikanischer Einsatz, wie ein Triumph für die Federales.
Sollen sie haben, denkt Keller.
Mir ist es egal, Tío. Hauptsache, du endest im Gefängnis.
Er blickt noch einmal zu seinem Haus hinüber. Mein Lohn für die »Jahre in der Wüste«, wie er die verfluchte Zeit von 1987 bis 1989 nennt, als er sich durch das Minenfeld seiner Ermittlungen arbeitete, den Meineidsprozess vorbereitete, der niemals kam, einen Präsidenten gehen und den Vizepräsidenten - denselben, der den verdeckten Krieg gegen die Sandinisten geführt hatte -, seine Nachfolge antreten sah. Meine Jahre in der Wüste, denkt er mit Bitterkeit. Versetzt von einem Schreibtisch an den nächsten, bis seine Ehe verkümmerte, sie sich in getrennte Schlafzimmer und getrennte Leben zurückzogen, Althea schließlich die Scheidung einreichte - gegen seinen zähen Widerstand.
Auch jetzt, denkt Keller, liegt ein frischer Satz von Scheidungspapieren auf dem Küchentisch seiner kahlen Einzimmerwohnung im Zentrum von San Diego und wartet auf seine Unterschrift.
»Niemals«, hat er seiner Frau versichert, »werde ich dir meine Kinder überlassen.«
Schließlich kam der Frieden.
Für Nicaragua, nicht für die Kellers.
Es fanden Wahlen statt, die Sandinisten mussten gehen, der verdeckte Krieg wurde eingestellt, und zirka fünf Minuten später stand Keller bei John Hobbs auf der Matte und verlangte seinen Lohn.
Er wollte alle, die an der Ermordung von Ernie Hidalgo beteiligt waren.
Seine Liste: Ramón Mette, Quito Fuentes, Doktor Alvarez, Gúero Méndez. Raúl Barrera. Adán Barrera. Und Miguel Ángel Barrera. Tío.
Was immer Keller vom Präsidenten halten mochte: John Hobbs, Colonel Craig und Sal Scachi standen zu ihrem Wort. Art Keller bekam freie Hand und alle denkbare Unterstützung zugesichert. Und begann seinen Feldzug.
»Im Ergebnis«, hatte Hobbs geklagt, »haben wir eine toll gewordene Bürgerrechtsbewegung und eine niedergebrannte Botschaft in Honduras, den Zusammenbruch der diplomatischen Beziehungen zu Mexiko. Um die Metapher ein wenig zu strapazieren: Das Außenministerium würde Sie liebend gern auf dem Scheiterhaufen verbrennen, und das Justizministerium bringt die Marshmallows.«
»Aber ich darf mich doch darauf verlassen«, sagte Keller, »dass ich die volle Unterstützung des Weißen Hauses und des Präsidenten habe.«
Womit er Hobbs diskret daran erinnerte, dass der gegenwärtige Präsident, bevor er ins Weiße Haus einzog, die Contras mit Kokain finanziert hatte. Also bitte keine hohlen Sprüche mehr über Außen- und Justizministerium.
Die Erpressung funktionierte, Keller bekam die Erlaubnis, sich Tío vorzuknöpfen - doch auch nicht ohne weiteres.
Es gab Verhandlungen auf höchster Ebene, und Keller wurde nicht einmal hinzugezogen.
Hobbs flog nach Los Pinos, der Residenz des mexikanischen Präsidenten, um einen Deal auszuhandeln. Die Verhaftung von Miguel Ángel Barrera würde einen Stolperstein auf dem Weg zur Unterzeichnung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA beseitigen.
NAFTA ist der Schlüssel, die unabdingbare Voraussetzung für die Modernisierung Mexikos, für den Schritt ins neue Jahrhundert. Ohne dieses Abkommen wird Mexiko stagnieren und zusammenbrechen, es wird für immer ein Drittweltland bleiben und im Elend versinken.
Die Mexikaner geben Barrera frei, damit die NAFTA-Verhandlungen nicht behindert werden.
Aber nur unter einer Bedingung: Er soll der Letzte sein, der im Zusammenhang mit dem Hidalgo-Mord ausgeliefert wird. Danach wird die Akte geschlossen. Art Keller darf nicht einmal mehr das Land betreten. Er bekommt Barrera, aber nicht Adán und Raúl, auch nicht Gúero Méndez.
Ist okay, denkt Keller.
Ich hab schon einen Plan.
Aber erst ist Tío dran.
Jetzt sitzt er also hier und wartet.
Das Problem: Tío hat drei bis an die Zähne bewaffnete Leibwächter. (Wieder Kerberos, denkt Keller, der unvermeidliche dreiköpfige Höllenhund.)
Nicht dass sich Keller deswegen allzu viele Sorgen macht. Seine Leute sind auch nicht schlecht bestückt. Er hat fünfundzwanzig Sondereinsatzkräfte der Federales mit Mi6-Gewehren, Scharfschützengewehren, der kompletten Ausrüstung für Spezialeinheiten, ganz zu schweigen von Ramos und seiner privaten Crew. Aber die mexikanische Forderung lautet: »Wir dulden keinerlei Schusswaffengebrauch im Stadtgebiet von Guadalajara, Feuergefechte müssen um jeden Preis verhindert werden.« Und Keller ist entschlossen, sich daran zu halten.
Also versuchen sie, die Sache anders anzugehen.
Es ist das Mädchen, das ihnen auf die Sprünge hilft.
Barreras neueste Flamme.
Sie will nicht kochen.
In den vergangenen drei Tagen hat Keller beobachtet, dass die Leibwächter zu dritt zu einem nahe gelegenen Imbiss gegangen sind, um zu frühstücken. Hat über die Abhörtechnik verfolgt, wie sie sich stritten, hat sich ihr Gezeter und das Gemaule der Wachmänner angehört, bis sie dann aus dem Haus liefen und nach zwanzig Minuten zurückkamen, gesättigt und gestärkt für einen langen Arbeitstag im Dienst von Miguel Angel.
Aber heute nicht, denkt Keller.
Heute wird es ein kurzer Tag.
»Die müssten langsam rauskommen«, sagt er zu Ramos. »Keine Sorge.«
»Ich mach mir aber Sorgen. Wenn nun plötzlich die Hausfrau in ihr erwacht?«
»Vergiss es!«, sagt Ramos. »Wenn die meine Frau wäre, der würde ich's zeigen. Die würde jeden Morgen fröhlich aufwachen und mich verwöhnen. Die glücklichste Frau von Mexiko.«
Aber nervös ist er auch, wie Keller deutlich sieht. Seine Kinnlade krampft sich um die unvermeidliche Zigarre, seine Finger vollführen kleine Trommelwirbel auf dem Schaft seiner Uzi. »Irgendwann müssen sie was essen«, fügt er hinzu.
Hoffen wir mal, denkt Keller. Wenn wir diese Chance verpassen, ist die wacklige Absprache mit ihren hochnervösen, widerstrebenden Unterstützern in der mexikanischen Regierung gefährdet. Der Innenminister und der Gouverneur von Jalisco haben sich ausdrücklich von diesem Einsatz distanziert und zu einer dreitägigen »Tauchexkursion« aufs Meer verabschiedet, so dass sie bei Bedarf die Ahnungslosen spielen können - gegenüber der Regierung und gegenüber den Barrera-Brüdern. Dieser Einsatz ist voller Unwägbarkeiten, die sie alle im Griff behalten müssen, und das in einem äußerst engen Zeitrahmen.
Der Trupp Federales aus Mexico City ist dazu abgestellt, Barrera zu schnappen. Gleichzeitig wartet eine Sondereinheit der Armee am Stadtrand, bereit, die ganze Polizeimacht des Staates Jalisco lahmzulegen, Polizeichef und Gouverneur festzusetzen, bis Barrera in Mexico City gelandet ist, unter Anklage gestellt und hinter Gitter gebracht wurde.
Das ist ein Staatsstreich, denkt Keller, durchgeplant bis auf die Sekunde, und wenn sie diese Chance verpassen, wird es unmöglich sein, die Sache einen weiteren Tag geheim zu halten. Die Polizei von Jalisco wird ihren Liebling Barrera in Sicherheit bringen, der Gouverneur wird sich ahnungslos geben, und alles ist vorbei.
Es muss also passieren, jetzt. Keller starrt auf die Haustür gegenüber. Bitte, lieber Gott, mach sie hungrig. Schick sie zum Frühstücken.
Er starrt auf die Haustür, als könnte er sie mit Blicken öffnen.
Tío ist auf Crack.
Er hängt an der Pfeife.
Das ist tragisch, denkt Adán mit einem Seitenblick auf seinen Onkel. Was als Pantomime angefangen hat, ist bittere Wirklichkeit geworden, als hätte sich Tío in eine Rolle hineingesteigert, die er nun nicht mehr abschütteln kann. Schon immer ein hagerer Mensch, ist er nun vollends abgemagert, er isst nicht mehr, raucht eine Zigarre nach der anderen. Und wenn er den Rauch nicht inhaliert, hustet er ihn aus. Sein pechschwarzes Haar ist silbern geworden, seine Haut hat einen gelblichen Teint, und er hängt an einem Glukose-Tropf, den er am Ständer hinter sich herzieht wie einen Hund.
Er ist dreiundfünfzig Jahre alt.
Ein junges Mädchen kommt herein - mein Gott, ist das nun die fünfte oder schon die sechste nach Pilar? -, pflanzt ihren fetten Hintern in den Sessel und drückt die Fernbedienung. Raúl ist schockiert von dieser Respektlosigkeit, und das noch mehr, als sein Onkel mit kläglicher Stimme sagt: »Herzchen, wir reden übers Geschäft.«
Herzchen - von wegen!, denkt Adán. Das Mädchen - er weiß nicht mal ihren Namen - ist wieder so ein matter Abklatsch von Pilar Talavera Méndez. Zehn Kilo schwerer, phlegmatisch, fettiges Haar, ein Gesicht, das zu viele carnitas davon entfernt ist, hübsch zu sein, doch es besteht eine vage Ähnlichkeit. Dass Tío so versessen auf Pilar war, konnte ihm Adán nachfühlen - was für eine Schönheit! -, aber das mit dieser segundera hier, das kann er nicht fassen. Besonders als das Mädchen ihr feistes Gesicht zu einem Schmollmund verzieht und mault: »Immer redest du übers Geschäft!«
»Mach uns was zu essen«, sagt Adán.
»Ich kann nicht kochen!«, sagt sie patzig und watschelt hinaus. Wenig später hören sie einen anderen Fernseher loslärmen, in einem anderen Zimmer.
»Sie muss ihre Seifenopern sehen«, erklärt Tío.
Adán hat sich bis jetzt zurückgehalten, ist sitzen geblieben und hat seinen Onkel mit wachsender Sorge beobachtet. Sein schlechter Zustand, seine Schwäche sind unverkennbar, seine hartnäckigen Versuche, sich Ersatz für Pilar zu beschaffen, sind ein Desaster. Tío Angel wird zusehends zur Witzfigur, und doch ist er der patrón der Federación.
Tío beugt sich vor und flüstert: »Triffst du sie?«
»Wen, Tio?«
»Sie«, krächzt er. »Gúeros Frau. Pilar.«
Gúero hat Pilar geheiratet. Hat sich in sie verguckt, als sie nach ihrer salvadorianischen »Hochzeitsreise« mit Tío aus dem Flugzeug stieg, und sie tatsächlich geheiratet - ein Mädchen, das andere mexikanische Männer nicht einmal angerührt hätten, weil sie keine Jungfrau mehr war. Und zudem war sie Barreras Ansteckblume, seine segundera.
Umso mehr liebt Gúero jetzt Pilar Talavera.
»Si, Tio«, sagt Adán. »Ich treffe sie.«
Tío nickt. Vergewissert sich mit einem Blick in Richtung Wohnzimmer, ob das Mädchen vorm Fernseher sitzt, und flüstert: »Ist sie noch schön?«
»Nein, Tio«, lügt Adán. »Jetzt ist sie hässlich und fett.«
Aber das stimmt nicht.
Sie ist, denkt Adán, überirdisch. Jeden Monat liefert er das Geld bei Méndez ab, und dann sieht er sie. Inzwischen ist sie eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern. Der Babyspeck ist verschwunden, sie ist zu einer wahren Schönheit gereift.
Und Tío trauert ihr noch immer nach.
Adán kommt wieder zur Sache. »Was ist mit Keller?«
»Was soll mit ihm sein?«, fragt Tío.
»Er hat sich Mette geschnappt, in Honduras«, sagt Adán, »und er hat Alvarez entführt. Hier in Guadalajara. Bist du der Nächste?«
Die Frage stellt sich wirklich, denkt Adán.
Tío zuckt die Schultern. »Mette wurde zu selbstgefällig. Und Alvarez war leichtsinnig. Auf mich trifft das nicht zu. Ich bin vorsichtig. Ich ziehe alle paar Tage um. Die Polizei von Jalisco schützt mich. Außerdem habe ich Freunde.«
»Du meinst die CIA?«, fragt Adán. »Der Krieg gegen Nicaragua ist vorbei. Welchen Nutzen hast du noch für die CIA?«
Denn Loyalität ist nicht die Stärke der Yankees, wie Adán weiß. Sie haben ein kurzes Gedächtnis. Wer das nicht glaubt, kann Manuel Noriega aus Panama fragen. Der war eine Schlüsselfigur von Kerberos gewesen, eine wichtige Station des mexikanischen Trampolins, und wo steckt er jetzt? In einem amerikanischen Gefängnis, genauso wie Mette und Alvarez, nur dass es nicht Art Keller war, der ihn festgesetzt hat, sondern George Bush, Noriegas alter Freund aus besseren Tagen. Ist in sein Land eingebrochen, hat ihn sich geholt.
Wenn du also auf die Loyalität der Amerikaner baust, Tío, hast du auf Sand gebaut. Auf CNN habe ich Kellers Aussage gesehen. Sein Schweigen hat einen Preis, und der Preis könntest du sein, der könnten wir alle sein.
»Mach dir keine Sorgen, Neffe«, sagt Tío. »Der Präsident in Los Pinos steht auf unserer Seite.«
»Was macht dich so sicher?«, fragt Adán.
»Meine fünfundzwanzig Millionen Dollar. Und die andere Sache.«
Adán weiß, was die andere Sache ist.
Dass die Federación den Wahlbetrug des Präsidenten unterstützt hat. Vor vier Jahren, 1988, schien es sicher, dass der linke Gegenkandidat Cárdenas die Wahl gewinnen und die PRI, die seit der Revolution von 1917 an der Macht ist, vom Thron stürzen würde.
Doch es geschah etwas Seltsames.
Die Computer, die die Stimmen auszählen sollten, verweigerten auf wundersame Weise ihren Dienst.
Im Fernsehen verkündete der Wahlleiter mit Bedauern, die Computer seien zusammengebrochen, es werde mehrere Tage dauern, bis die Stimmen ausgezählt wären und der Wahlsieger ermittelt sei. Und im Verlauf dieser Tage wurden die beiden Wahlbeobachter der Oppositionspartei - zwei Männer, die wussten, dass Cárdenas 55 Prozent der Stimmen errungen hatte - im Fluss aufgefunden.
Mit dem Gesicht nach unten.
Darauf trat der Wahlleiter erneut vor die Fernsehkameras und verkündete mit unbewegter Miene, die PRI habe die Wahlen gewonnen.
Der gegenwärtige Präsident trat sein Amt an und ging daran, die Banken, die Telefongesellschaften, die Ölfelder zu privatisieren, um sie weit unter Marktpreis an die Leute zu verkaufen, die zu seiner Spendengala erschienen waren und ein 25-Millionen-Dollar-Trinkgeld hinterließen.
Adán weiß, dass Tío mit der Ermordung der Wahlbeobachter nichts zu tun hat - das war García Ábrego -, aber Tío dürfte davon gewusst und sein Okay gegeben haben. Und während Ábrego beste Beziehungen nach Los Pinos unterhält - geschäftlich mit el Bagmán verbunden ist, dem Bruder des Präsidenten, dem ein Drittel aller von Ábrego geschmuggelten Kokainlieferungen gehören -, hat Tío gute Gründe, zu glauben, dass Los Pinos gute Gründe hat, sich ihm gegenüber loyal zu verhalten.
Adán hat da seine Zweifel.
Jetzt merkt er, dass sein Onkel ungeduldig wird, das Gespräch beenden will. Tío will Crack rauchen, aber nicht in Gegenwart seines Neffen. Wirklich traurig, denkt Adán, wenn man mitansehen muss, was die Droge aus diesem großartigen Mann gemacht hat.
Adán fährt mit dem Taxi ins Stadtzentrum und geht zur Kathedrale, um ein Wunder zu erbitten. Gott und die Wissenschaft, denkt er.
Die widerstreitenden, aber manchmal auch harmonierenden Kräfte, von denen sich Adán und Lucia Hilfe für ihre Tochter erhoffen.
Lucia hält sich lieber an Gott.
Sie betet und stiftet Messen, kniet vor einer ganzen Galerie von Heiligen. Sie kauft milagros vor der Kathedrale, spendet Kerzen, Geld und Opfergaben.
Adán geht am Sonntag zur Kirche, bringt ebenfalls seine Opfer, sagt seine Gebete, empfängt die Kommunion, aber es ist eher eine Geste, eine Gefälligkeit Lucia gegenüber. Er glaubt nicht - nicht mehr -, dass aus dieser Richtung Hilfe kommen wird. Bei seinen Fahrten nach Culiacán aber, die er regelmäßig unternimmt, um Gúero Méndez Tribut zu zollen, macht er immer Station im Schrein von Santo Jesús Malverde, um sein manda zu hinterlegen.
Er betet zum Narcosanto, dem Schutzheiligen der Drogenschmuggler, aber seine Hoffnungen richtet er auf die Ärzte.
Adán verkauft Drogen und kauft Biopharmaka.
Konsultiert Kinderneurologen, Neuropsychologen, Psychoneurologen, Endokrinologen, Hirnspezialisten, Pharmaforscher, Kräuterheiler, Schamanen, Scharlatane, Quacksalber. Ärzte gibt es überall - in Mexiko, Kolumbien, Costa Rica, England, Frankreich, der Schweiz und sogar direkt hinter der Grenze, in den USA.
Aber da darf Adán nicht hin.
Darf seine Frau und seine Tochter nicht begleiten zu ihren traurigen, fruchtlosen Pilgerfahrten zu den Spezialisten im Scripps Hospital von La Jolla oder im Mercy Hospital von Los Angeles. Er schickt Lucia los mit seinen Aufzeichnungen, seinen Fragen, ganzen Stapeln von medizinischen Befunden. Lucia fährt allein los mit Gloria, überquert die Grenze unter ihrem Mädchennamen - die Staatsbürgerschaft besitzt sie noch -, und manchmal sind sie über Wochen unterwegs, sogar Monate, während sich Adán nach seiner Tochter verzehrt. Und sie kommen immer mit der gleichen Nachricht zurück.
Dass es keine Hoffnung gibt.
Kein neues Mittel wurde entdeckt.
Und es ist kein Wunder geschehen.
Weder Gott noch die Ärzte können ihnen helfen.
Adán und Lucia bestärken sich gegenseitig in ihrer Hoffnung, ihrem Glauben - den Lucia besitzt und Adán vortäuscht - und ihrer Liebe.
Adán liebt seine Frau und seine Tochter innig.
Er ist ein guter Ehemann, ein wunderbarer Vater.
Andere Männer, und das weiß Lucia, würden sich von ihrer missgestalteten Tochter abwenden, die eheliche Gemeinschaft meiden, tausend Ausreden anbringen, warum sie nicht nach Hause kommen.
Nicht so Adán.
Er ist fast jeden Abend zu Hause, fast jedes Wochenende. Jeden Morgen geht er als Erstes in Glorias Zimmer, küsst sie und streichelt sie und bereitet ihr das Frühstück, bevor er zur Arbeit geht. Wenn er am Abend nach Hause kommt, führt ihn sein erster Weg in Glorias Zimmer. Er liest ihr vor, erzählt Geschichten, spielt mit ihr.
Auch versteckt Adán sein Kind nicht. Er macht mit Gloria lange Spaziergänge durch das Rio-Viertel. Geht mit ihr in den Park, ins Restaurant, in den Zirkus, überallhin. Sie sind ein vertrauter Anblick in den besseren Vierteln von Tijuana - Adán, Lucia und Gloria. In allen Geschäften kennt man das Mädchen, man schenkt ihr Süßigkeiten, Blumen, Haarspangen, Armbänder, hübsche Kleinigkeiten.
Wenn Adán geschäftlich unterwegs ist - wie jetzt gerade, auf seinem regelmäßigen Ausflug nach Guadalajara, um sich mit Tío zu treffen, dann nach Culiacán, mit einem Aktenkoffer voller Geld für Gúero -, ruft er jeden Tag an, viele Male täglich, um mit seiner Tochter zu sprechen. Erzählt ihr Witze, lustige Sachen, die er unterwegs erlebt hat. Er bringt ihr Geschenke mit - aus Guadalajara, Culiacán, Badiraguato.
Und die Ärzte, die sich in seiner Reichweite befinden, besucht er ebenfalls. Er wird zum Experten für zystische Lymphangiome, er liest, studiert, stellt Fragen, setzt Belohnungen aus, spendet Unsummen für die Forschung und animiert seine Geschäftspartner diskret, desgleichen zu tun. Er und Lucia sind von schönen Dingen umgeben, haben ein schönes Haus, aber sie könnten noch viel schönere Dinge, ein noch viel größeres Haus besitzen, wenn sie nicht so viel Geld für die Ärzte ausgeben würden. Und für Spenden, Geschenke, Messen, für Spielplätze und Kliniken.
Lucia ist froh darüber. Sie braucht keine schöneren Dinge, kein größeres Haus. Sie will auch nicht so ein protziges und, offen gesagt, geschmackloses Landhaus, mit dem sich andere narco trafican tes brüsten.
Lucía und Adán würden alles opfern, was sie haben, jedem Arzt und jedem Gott, der in der Lage ist, ihrem Kind zu helfen.
Je mehr die Wissenschaft versagt, umso stärker wendet sich Lucia der Religion zu. Sie findet mehr Zuversicht im Wunderglauben als in den nüchternen Zahlen der medizinischen Befunde. Ein Fingerzeig Gottes, der Heiligen, der Jungfrau von Guadelupe könnte diese Zahlen in Sekundenschnelle zum Guten wenden. Sie wird zur Betschwester, empfängt täglich die Kommunion, lädt den Gemeindepfarrer, Padre Rivera, zum Abendessen ein, zu privaten Gebetsstunden, Konsultationen, Bibelsitzungen. Sie stellt die Tiefe ihres Glaubens in Frage (»Vielleicht sind es meine Zweifel, die ein Wunder verhindern?«), die Echtheit von Adáns Glauben. Sie drängt ihn, öfter zur Messe zu gehen, inständiger zu beten, der Kirche noch mehr Geld zu spenden, mit Padre Rivera zu reden (»Schütte ihm dein Herz aus!«).
Damit es ihr besser geht, besucht er den Padre.
Der ist kein schlechter Kerl, nur ein bisschen vertrottelt. Adán sitzt also in seinem Büro, an seinem Schreibtisch, und sagt: »Ich hoffe, Sie reden Lucia nicht ein, dass ihr mangelnder Glaube eine Heilung unserer Tochter verhindert.«
»Natürlich nicht. So etwas würde ich niemals sagen oder auch nur denken.«
Adán nickt.
»Aber reden wir über Sie«, sagt Rivera. »Was kann ich tun, um Ihnen zu helfen, Adán?«
»Mir geht es gut, wirklich.«
»Es kann nicht leicht sein -«
»Nein, ist es nicht. Aber so ist das Leben.«
»Und wie steht es zwischen Ihnen und Lucia?«
»Alles in Ordnung.«
Riveras Augen glitzern schelmisch: »Und im Bett, wenn ich fragen darf? Wie steht es um Ihre eheliche -«
Adán muss sich ein Grinsen verkneifen. Es amüsiert ihn jedes Mal, wenn Pfarrer, diese freiwilligen Eunuchen, einem Ratschläge in Sachen Sex erteilen wollen. Wie Vegetarier, die dir erzählen, wie du dein Steak zu grillen hast. Doch ist jetzt klar, dass Lucia mit Rivera über ihr Sexualleben gesprochen hat, sonst hätte er nicht gewagt, das Thema anzuschneiden.
Nur leider: Es gibt da nichts zu bereden.
Ein Sexualleben findet nicht statt. Lucia hat schreckliche Angst davor, schwanger zu werden. Und weil die Kirche die künstliche Empfängnisverhütung verbietet, wird sie nichts tun, was ihre absolute Treue zu den Geboten der Kirche in Frage stellen könnte ...
Er hat ihr hundertmal erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit, wieder ein Kind mit Geburtsfehler zu bekommen, bei eins zu tausend, eins zu einer Million liegt, doch für Logik ist sie nicht empfänglich. Sie weiß, dass er recht hat, aber eines Nachts gesteht sie ihm unter Tränen, dass sie nichts so sehr fürchtet, wie diesen Moment in der Entbindungsklinik noch einmal zu erleben, den Moment, als man sie informierte, als man ihr zeigte -
Den Gedanken, diesen Moment noch einmal durchleben zu müssen, erträgt sie nicht.
Sie hat etliche Male versucht, an den empfängnisfreien Tagen mit ihm zu schlafen, aber ist dabei innerlich erstarrt. Angst und Schuld, hat Adán begriffen, sind schlechte Aphrodisiaka.
Am liebsten würde er Rivera erklären, dass ihm Sex nicht so wichtig ist. Er hat beruflich zu tun, er hat zu Hause zu tun, und alle seine Energien werden durch die Geschäfte beansprucht (welcher Art die sind, wird nie erwähnt), durch die Sorge um das schwerkranke, schwerbehinderte Kind und die Suche nach Heilung. Verglichen mit den Leiden seiner Tochter ist ein unerfülltes Geschlechtsleben nicht der Rede wert.
»Ich liebe meine Frau«, sagt er zu Rivera.
»Ich habe ihr geraten, noch Kinder zu bekommen«, sagt Rivera. »Weiter zu -«
Genug, denkt Adán, jetzt wird es kränkend. »Gloria beansprucht jetzt unsere ganze Kraft, Padre.«
Er hinterlässt einen Scheck auf dem Schreibtisch.
Zu Hause erzählt er Lucia, dass er mit Padre Rivera gesprochen und sich im Glauben gestärkt hat.
Aber woran Adán wirklich glaubt, sind Zahlen.
Es tut ihm weh, ihre traurige, vergebliche Gläubigkeit zu erleben, er weiß, dass sich ihr Schmerz mit jedem Tag steigern wird, denn die Zahlen lügen nicht. Die Zahlen sind sein täglich Brot, alle seine wichtigen Entscheidungen sind auf Zahlen gegründet, die Arithmetik bestimmt die Gesetze des Universums, der mathematische Beweis ist der einzig gültige.
Und die Zahlen sagen, dass ihre Tochter nicht gesünder, sondern immer kränker wird, dass die flehentlichen Gebete seiner Frau vergebens sind.
Also hofft er auf die Wissenschaft, darauf, dass irgendwann die richtige Formel gefunden wird, hofft auf das Wundermittel, den chirurgischen Trick, mit dem Gott und die ganze Bande nutzloser Heiliger übertrumpft werden kann.
Bis dahin kann man nichts weiter tun, als dieses aussichtslose Marathon fortzusetzen, Schritt für Schritt.
Weder Gott noch Wissenschaft können seiner Tochter helfen.
Noras Haut sieht ganz rosig aus, als sie aus dem Bad kommt.
In einen dicken weißen Frotteemantel gehüllt, das Handtuch als Turban um den Kopf gewickelt, lässt sie sich aufs Sofa plumpsen, legt die Füße auf den Couchtisch und greift nach dem Brief.
»Und?«, fragt sie. »Wirst du's tun?«
»Werde ich was tun?«, fragt Parada. Er schwelgt gerade in den Klängen von John Coltrane, die aus dem Radio kommen. »Zurücktreten.«
»Ich weiß nicht«, sagt er. »Ich werde wohl müssen. Ich meine, ein Brief vom Papst persönlich ...«
»Aber du sagtest, es ist eine Bitte, kein Befehl.«
»Das ist nur eine Höflichkeitsfloskel«, sagt Parada. »Es läuft aufs Gleiche hinaus. Einer Bitte des Papstes widersetzt man sich nicht.«
Nora zuckt die Schultern. »Für alles gibt's ein erstes Mal.«
Parada lächelt. Ja, ja, die unbekümmerte Jugend. Es ist die Schwäche und Tugend junger Menschen zugleich, dass sie so wenig Respekt vor Traditionen haben und noch weniger vor der Autorität. Ein Vorgesetzter bittet dich, etwas zu tun, und du willst nicht? Kein Problem - einfach Nein sagen.
Aber es wäre so leicht, zu gehorchen, denkt er. Mehr als leicht - verlockend. Tritt zurück, werde wieder einfacher Pfarrer oder nimm die Versetzung ins Kloster an - für eine »Zeit der Besinnung«, wie sie es wahrscheinlich nennen würden. Eine Zeit der Einkehr und des Gebets. Das klingt wundervoll - nach all der Mühe und Verantwortung, den ständigen politischen Verhandlungen, dem unablässigen Kampf um Nahrung, Unterkunft, Medikamente, nicht zu vergessen die Geißel des Alkoholismus, eheliche Gewalt, Arbeitslosigkeit und Armut und die unabsehbar vielen Tragödien, die daraus erwachsen. Das ist eine wahre Bürde, denkt er, ohne sich seines Selbstmitleids zu schämen, und nun will mir Il Papa nicht nur den Kelch aus der Hand nehmen, er möchte, dass ich ganz auf ihn verzichte.
Und wird ihn mir, mit Gewalt aus der Hand reißen, wenn ich ihn nicht in aller Demut übergebe.
Das ist es, was Nora nicht versteht.
Eins der wenigen Dinge, die sie nicht versteht.
Seit Jahren schon kommt sie zu Besuch. Anfangs immer nur für ein paar Tage, um im Waisenhaus außerhalb der Stadt zu helfen, dann wurden Wochen daraus, und später wurden aus den Wochen Monate, bevor sie wieder in die Staaten zurückging, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und dann wiederzukommen. Und ihre Einsätze im Waisenhaus werden länger und länger.
Was eine gute Sache ist, denn dort hat sie sich unentbehrlich gemacht.
Zu ihrer Überraschung ist sie ganz gut darin, das zu tun, was getan werden muss. An manchen Vormittagen kümmert sie sich um die Vorschulkinder, dann wieder überwacht sie die anscheinend niemals endenden Klempnerarbeiten oder verhandelt mit Baufirmen über die Kosten eines neuen Schlafsaals. Oder fährt auf den großen Zentralmarkt von Guadalajara, um die besten Preise für den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf herauszuschlagen.
Anfangs hat sie jedes Mal, wenn eine neue Aufgabe auf sie zukam, dasselbe Klagelied angestimmt: »Davon hab ich keine Ahnung!« - und von Schwester Camella die immergleiche Antwort erhalten: »Dann wirst du's lernen.«
So war es, und so ist es auch geblieben. Sie hat sich zum Experten für die Sanitärprobleme der Dritten Welt entwickelt. Die Baufirmen lieben und hassen sie - sie ist wunderschön, aber von einer gnadenlosen Härte, und verbreitet Entsetzen wie Entzücken, wenn sie mit ihrem abgehackten, aber sehr eindrücklichen Spanisch Dinge ausspricht wie: »No me quiebres el culo.«
Reißt mir nicht den Arsch auf.
Bei anderen Gelegenheiten kann sie so charmant und verführerisch sein, dass sie ihr alles geben, was sie fordert, auch wenn sie selbst kaum daran verdienen. Es reicht ein Blick, ein Lächeln von ihr. Sie sagt nur: »Das Dach kann wirklich nicht warten, bis das Geld da ist - die Regenzeit fängt an, sehen Sie nicht den Himmel?«
Nein, den Himmel sehen sie nicht, nur ihr Gesicht, ihre Figur und, seien wir ehrlich, auch ihre Seele, und sie gehen los und reparieren das verfluchte Dach. Sie wissen auch, dass sie gut im Geldbeschaffen ist, dass sie es besorgen wird, denn wer in der ganzen Diözese wagt es, ihr etwas abzuschlagen?
Dazu hat niemand den Mumm.
Und auf dem Markt? Dios mío!, der reinste Terror. Tritt auf wie eine Königin, verlangt das Beste von diesem, das Frischeste von jenem. Fasst die Sachen an, beschnuppert sie, verlangt Kostproben.
Eines Morgens fragt ein aufgebrachter Händler: »Was glauben Sie, für wen Sie einkaufen? Für ein Luxushotel?«
Und sie antwortet: »Meine Kinder verdienen das Gleiche oder Besseres. Oder sehen Sie das anders?«
Sie besorgt ihnen das beste Essen zum besten Preis.
An Gerüchten über sie hat es nicht gemangelt. Sie sei eine Schauspielerin - nein, eine Hure - nein ... die Mätresse des Kardinals. Nein, sie war eine Edelkurtisane, sie stirbt bald an Aids, und jetzt arbeitet sie im Waisenhaus, um Buße zu tun, bevor sie vor ihren Schöpfer tritt.
Aber diese Geschichten haben an Glaubwürdigkeit verloren, als das erste Jahr verging, dann zwei, dann fünf, dann sieben - und sie kommt immer noch nach Mexiko, ohne dass ihre Gesundheit oder ihr Aussehen gelitten haben, und irgendwann haben die Spekulationen über ihre Vergangenheit ganz von selbst aufgehört.
Aber sie genießt die Mahlzeiten, wenn sie in die Stadt kommt. Sie isst sich richtig satt, dann geht sie mit ihrem Weinglas in das Badezimmer mit richtigen Kacheln und bleibt so lange im heißen Wasser, bis ihre Haut ganz rosig ist. Und trocknet sich mit den großen, flauschigen Handtüchern ab (die im Waisenhaus sind klein, hart und dünn - fast durchsichtig). Das Zimmermädchen bringt ihre Sachen, die gewaschen wurden, während sie in der Wanne saß, und dann verbringt sie den Abend mit Padre Juan, bei Geplauder, Musik oder Filmen. Sie weiß, dass er ihre Zeit im Bad genutzt hat, um in den Garten zu gehen und heimlich zu rauchen. (Die Ärzte haben es ihm wieder und wieder verboten, aber er gibt ihnen jedes Mal zur Antwort: »Wenn ich nun das Rauchen aufgebe und von einem Auto überfahren werde? Dann habe ich ganz umsonst auf mein Vergnügen verzichtet.«) Hinterher lutscht er ulkigerweise noch eine Pfefferminzpastille, als könnte er Nora damit täuschen, als hätte er es nötig, sie zu täuschen.
Dabei sind sie längst dazu übergegangen, ihre Badezeiten nach Zigarettenlängen zu bemessen. »Ich gehe jetzt mal fünf Zigaretten lang baden« oder, wenn sie sich besonders abgespannt und badebedürftig fühlt: »Das wird jetzt ein Achtzigarettenbad.« Aber trotzdem tut er weiter so, als wüsste er nicht, wovon sie redet, und lutscht seine Pfefferminzpastille.
Dieses Spiel läuft nun schon seit sieben Jahren.
Sieben Jahre - sie kann es nicht fassen.
Ausnahmsweise ist sie heute schon am Vormittag gekommen, nachdem sie die ganze Nacht bei einem kranken Kind im städtischen Krankenhaus verbracht hat. Als das Kind außer Gefahr war, ist sie mit dem Taxi zu Padre Juan gefahren, hat sich ein Bad und ein ausgiebiges Frühstück gegönnt. Und jetzt sitzt sie bei ihm im Zimmer und hört seine Musik.
»Wohin sind die verschwunden?«, fragt sie, während sich Coltrane in sein Solo vertieft.
»Wohin ist was verschwunden?«
»Die sieben Jahre.«
»Wohin sie immer verschwinden«, sagt er. »Wenn man tut, was getan werden muss.«
»Vermutlich.«
Sie macht sich Sorgen um ihn.
Er sieht müde aus, abgespannt. Und obwohl sie darüber witzeln - er hat neuerdings abgenommen und scheint anfälliger zu sein für Grippe und Erkältungen.
Aber es geht um mehr als um seine Gesundheit.
Es geht um seine Sicherheit.
Nora hat Angst, dass sie ihn ermorden werden.
Nicht nur wegen seiner politischen Predigten und Aktivitäten. In den letzten Jahren hat er sich immer öfter im Staat Chiapas aufgehalten, die Kirche dort unten zu einem Zentrum für die Indio-Bewegung gemacht - zur Empörung der dortigen Landbesitzer. Er hat die sozialen Probleme des Landes angesprochen und sich dabei gefährlich weit nach links bewegt, sogar gegen das NAFTA-Abkommen gewettert, welches, wie er argumentiert, die Armen und Landlosen noch ärmer machen wird.
Auch die Kanzel hat er dafür genutzt und die Kirchenoberen in Mexiko genauso verärgert wie die rechten Politiker.
Nora kann die Gefahr, in der er schwebt, förmlich mit Händen greifen.
Als sie die Plakate zum ersten Mal sah, wurde sie wütend und wollte sie herunterreißen, aber er hat sie zurückgehalten. Er fand es lustig, wie sie ihn karikierten. EL CARDENAL ROJO - der rote Kardinal - und der Zusatz GEFÄHRLICHER VERBRECHER. GESUCHT WEGEN HOCHVERRATS. Am liebsten hätte er sich das Plakat einrahmen lassen.
Es macht ihm keine Angst - und er versichert ihr, dass selbst die Rechten keinen Priester ermorden würden. Aber mit Oscar Romero in Guatemala haben sie es doch gemacht, oder nicht? Die Kugeln sind nicht an seiner Soutane abgeprallt. Eine Todesschwadron ist in seine Kirche eingedrungen, während er die Messe las, und hat ihn niedergeschossen. Nora hat Angst vor der mexikanischen Guardia Blanca und vor diesen Plakaten, die irgendeinen Verrückten dazu ermutigen könnten, sich zum Helden zu machen, indem er einen Hochverräter erschießt.
»Damit wollen sie mich nur einschüchtern«, hat Padre Juan ihr versichert, als sie das Plakat zum ersten Mal sahen.
Aber gerade das Wissen, dass er sich nicht einschüchtern lässt, macht ihr die meiste Angst. Was werden sie tun, wenn sie merken, class diese Methode bei ihm nicht verfängt? Vielleicht ist also die »Bitte« des Papstes, er möge zurücktreten, keine schlechte Sache. Weshalb auch sie ihm die Idee eines Rücktritts nahelegt. Sie ist zu klug, um seine Gesundheit ins Feld zu führen, seine Erschöpfung und die Drohungen, aber sie möchte ihm eine Tür öffnen, durch die er einfach hinausgehen kann. Und zwar lebend.
»Ich weiß nicht«, sagt sie. »Vielleicht ist es keine so schlechte Idee.«
Er hatte ihr von seinem Streit mit dem päpstlichen Nuntius in Mexico City erzählt, von dessen Vorwurf, er begehe in Chiapas »schwere seelsorgerliche und theologische Fehler«.
»Das ist die Theologie der Befreiung«, hat ihm Antonucci vorgeworfen.
»Die Theologie der Befreiung interessiert mich nicht«, war seine Antwort gewesen. »Dann bin ich beruhigt.«
»Mich interessiert nur die Befreiung.«
Antonuccis Vogelgesicht wurde dunkelrot, als er erwiderte: »Christus erlöst uns von Hölle und Tod, und ich denke, das ist Befreiung genug. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, und das ist es, was Sie den gläubigen Christen in Ihrer Diözese zu vermitteln haben. Das sollte Ihr Hauptanliegen sein - und nicht die Politik.«
»Mein Hauptanliegen ist es«, erwiderte Parada darauf, »dass das Evangelium für die Menschen schon jetzt zur frohen Botschaft wird, nicht erst nachdem sie verhungert sind.«
»Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war es große Mode, so zu reden. Aber möglicherweise ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass wir inzwischen einen anderen Papst haben.«
»Ja«, sagte Parada, »und manchmal verdreht er die Dinge. Er küsst den Boden, und er läuft über die Menschen - statt umgekehrt.«
»Lassen Sie die Scherze«, sagte Antonucci. »Gegen Sie wurde ein Verfahren eröffnet.«
»Durch wen veranlasst?«
»Das Lateinamerika-Büro des Vatikans. Bischof Gantin. Er verlangt Ihre Ablösung.«
»Aus welchen Gründen?«
»Ketzerei.«
»Das ist lachhaft.«
»Ach ja?« Antonucci holte eine Akte vom Schreibtisch. »Haben Sie im vergangenen Mai in Chiapas die heilige Messe zelebriert- und das im Maya-Kostüm, samt Federschmuck?«
»Das sind Symbole, die von der indigenen Bevölkerung -«
»Also, Sie geben es zu«, sagte Antonucci. »Sie huldigen heidnischen Götzen - in aller Offenheit.«
»Glauben Sie, dass Gott erst mit Kolumbus nach Amerika gekommen ist?«
»Jetzt zitieren Sie sich selbst«, sagte Antonucci. »Ja, hier habe ich diesen theologischen Leckerbissen. Sehen wir mal: >Gott liebt die ganze Menschheit -<«
»Haben Sie etwas gegen diese Feststellung einzuwenden?«
»>- und daher offenbart er sein ,Gottsein' allen ethnischen Gruppen und Kulturen dieser Welt. Bevor die ersten Missionare die Botschaft Christi überbrachten, war der Prozess der Erlösung schon im Gange. Wir wissen sehr wohl, dass Gott nicht auf den Schiffen des Kolumbus nach Amerika kam. Nein, Gott war in all diesen Kulturen schon präsent, daher hat die Missionsarbeit eine völlig andere Bedeutung - sie verkündet die Gegenwart Gottes, der bereits anwesend ist.< Leugnen Sie, das gesagt zu haben?«
»Nein, ich unterstreiche es.«
»Dass diese Völker schon vor Christus erlöst wurden?«
»Ja.«
»Das ist reinste Ketzerei.«
»Nein, das ist es nicht.« Es ist die reinste Erlösung. Die simple Feststellung, dass Gott nicht auf den Schiffen des Kolumbus nach Amerika gebracht wurde, hat mehr zur geistlichen Erweckung in Chiapas beigetragen als tausend Katechismerl, weil die indigenen Völker in ihren eigenen Kulturen nach Zeichen des offenbarten Gottes zu suchen begannen. Und sie fanden sie - in ihren Bräuchen, ihrem Verhältnis zur Welt, ihren alten Gesetzen, die den Umgang mit ihren Brüdern und Schwestern regelten. Erst als das geschehen war, als sie Gott in sich entdeckt hatten, konnten sie die frohe Botschaft Christi unverfälscht in sich aufnehmen.
Und auf Erlösung hoffen. Erlösung von fünfhundert Jahren Sklaverei, einem halben Jahrtausend Unterdrückung, Erniedrigung, Elend, verzweifelter, mörderischer Armut. Und wenn Christus nicht erschienen ist, um sie davon zu erlösen, dann ist er überhaupt nicht erschienen.
»Und was sagen Sie dazu?«, fragte ihn Antonucci. »>Das Mysterium der Dreifaltigkeit ist kein mathematisches Rätsel. Es ist die Manifestation des Vaters in der Politik, des Sohnes in der Wirtschaft und des Heiligen Geistes in der Kultur.< Gibt das wirklich Ihre Meinung wieder?«
»Ja.«
Ja, allerdings, weil diese drei Dinge - Politik, Wirtschaft und Kultur - zusammenwirken müssen, damit sich Gott in all seiner Macht offenbart. Deshalb haben wir die letzten sieben Jahre damit verbracht, Kulturzentren, Kliniken, Kooperativen zu gründen - und ja, auch politische Organisationen.
Antonucci fuhr fort. »Wollen Sie etwa Gott, unseren Vater, auf bloße Politik reduzieren und Jesus Christus, Seinen Sohn und unseren Erlöser, auf das Niveau eines drittklassigen marxistischen Wirtschaftsseminars? Und Ihre blasphemische Verbindung des Heiligen Geistes mit der heidnischen Kultur werde ich nicht einmal kommentieren, was immer Sie damit sagen wollen.«
»Dass Sie das nicht wissen, ist ja gerade das Problem.«
»Nein«, sagte Antonucci. »Das Problem ist, dass Sie es wissen.«
»Wissen Sie, was mich ein alter Indianer neulich gefragt hat?«
»Das werden Sie mir jetzt zweifellos erzählen.«
»Er hat mich gefragt: >Rettet euer Gott nur unsere Seelen oder auch unsere Körper?<«
»Ich brenne darauf, Ihre Antwort auf diese Frage zu erfahren.«
»Das sollten Sie auch.«
Sie saßen sich am Schreibtisch gegenüber und funkelten sich gegenseitig an. Um die Lage ein wenig zu entschärfen, sagte Parada: »Sehen Sie doch mal, was wir in Chiapas erreicht haben. Wir haben jetzt sechstausend indigene Katecheten. Es gibt sie in allen Dörfern, und sie verbreiten das Evangelium.«
»Ja, sehen wir doch mal, was Sie in Chiapas erreicht haben«, erwiderte Antonucci. »Sie haben den höchsten Prozentsatz an protestantischen Konvertiten in ganz Mexiko. Nur etwas mehr als die Hälfte Ihrer Leute sind überhaupt noch katholisch, so wenig wie sonst nirgends in Mexiko.«
»Ach, darum geht es Ihnen!«, rief Parada. »Coca-Cola befürchtet, Marktanteile an Pepsi zu verlieren.«
Doch er bereute seinen Ausrutscher sofort. Eine alberne, hochmütige Bemerkung, die ihm den Rückweg zur Verständigung verbaute.
Und Antonucci hatte mit seinem Haupteinwand recht, denkt er jetzt.
Ich bin aufs Land gegangen, um die Indios zu bekehren. Stattdessen haben sie mich bekehrt.
Und nun wird dieses Horror-Abkommen, genannt NAFTA, die Bauern von dem bisschen Land vertreiben, das sie noch besitzen, Platz schaffen für größere, »effizientere« Farmen. Den Weg bereiten für riesige Kaffeeplantagen, für die Ausbeutung von Bodenschätzen, die Rodung der Wälder - und natürlich für Ölbohrtürme.
Muss denn wirklich alles auf dem Altar des Kapitalismus geopfert werden?, fragt er sich, wieder in der Gegenwart angekommen.
Er steht auf, dreht die Musik leiser und hält Ausschau nach seinen Zigaretten. Immer muss er nach ihnen suchen, genauso wie nach der Brille. Und Nora hilft ihm nicht, obwohl sie die Schachtel auf einem Tischchen liegen sieht. Er raucht viel zu viel, das kann ihm nicht guttun.
»Der Rauch stört mich wirklich«, sagt sie.
»Ich zünde sie nicht an«, verspricht er, als er die Schachtel findet. »Ich nuckle nur so.«
»Versuch's doch mit Kaugummi.«
»Ich mag kein Kaugummi.«
Er setzt sich hin, ihr gegenüber, und blickt ihr in die Augen. »Du willst, dass ich zurücktrete.«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich will, dass du tust, was du tun musst.«
»Hör auf, mich zu erziehen!«, blafft er. »Sag mir lieber, was du denkst.«
»Na gut«, sagt sie. »Auch du musst irgendwie leben. Du hast es dir verdient. Wenn du zurücktrittst, wird dir niemand etwas vorwerfen. Sie werden dem Vatikan die Schuld geben, und du kannst erhobenen Hauptes aus alldem hervorgehen.«
Sie steht vom Sofa auf und gießt sich ein Glas Wein ein. Sie möchte jetzt Wein, aber vor allem will sie seinem Blick ausweichen. Will nicht, dass er ihr in die Augen sieht, als sie sagt: »Ich bin egoistisch. Den Gedanken, dass dir was passieren könnte, halte ich nicht aus.«
»Aha.«
Die geteilte und doch unausgesprochene Erkenntnis lastet schwer zwischen ihnen: Wenn er nicht nur auf seinen Kardinalsrang verzichten würde, sondern auch auf die Priesterschaft, dann könnten sie ...
Aber das würde er niemals tun, denkt sie, und ich würde es nicht wirklich wollen.
Und er denkt: Was bist du für ein Narr! Sie ist vierzig Jahre jünger als du, und was immer kommen mag, im Herzen bleibst du Priester. Also sagt er: »Ich fürchte, ich bin hier der Egoist. Vielleicht hält dich unsere Freundschaft davon ab, eine Beziehung zu suchen -«
»Hör auf.«
»- die deinen Bedürfnissen eher entspricht.«
»Du entsprichst all meinen Bedürfnissen.«
Der Blick, mit dem sie das sagt, ist so ernst, dass er zusammenzuckt. Diese erschreckend intensiven Augen. »Allen bestimmt nicht.«
»Allen.«
»Willst du keinen Ehemann?«, fragt er. »Eine Familie, Kinder?«
»Nein.«
Verlass mich nicht, will sie schreien. Zwing mich nicht, dich zu verlassen. Ich brauche keinen Ehemann, keine Familie, keine Kinder. Ich brauche weder Sex noch Geld noch Luxus noch Sicherheit.
Ich brauche dich.
Es gibt sicher eine Million psychologische Gründe - ein liebloser Vater, sexuelle Störungen, Angst vor einer wirklichen Beziehung -, ein Psychiater hätte seine Freude an mir, aber das ist mir egal. Und du bist der beste Mensch, den ich je kannte. Der klügste, netteste, lustigste. Und ich weiß nicht, was ich tue, wenn dir was passiert, also bitte, verlass mich nicht. Zwing mich nicht, dich zu verlassen.
»Du wirst also nicht zurücktreten?«, fragt sie.
»Ich kann nicht.«
»Okay.«
»Wirklich?«
»Klar.«
Sie hat nie wirklich geglaubt, dass er zurücktreten wird.
Ein zaghaftes Klopfen an der Tür, sein Sekretär steckt den Kopf herein und sagt, er habe einen unangemeldeten Besucher, dem er schon gesagt habe -
»Wer ist es?«, fragt Parada.
»Ein Señor Barrera«, sagt der Sekretär. »Ich hab ihm gesagt -«
»Ich empfange ihn.«
Nora steht auf. »Ich muss sowieso los.«
Sie umarmt ihn und geht, um sich anzuziehen.
Als er sein Büro betritt, wird er schon von Adán erwartet.
Er hat sich verändert, denkt Parada.
Immer noch dieses jungenhafte Gesicht, aber jetzt ist er ein Junge, der Kummer hat. Kein Wunder bei seinem kranken Kind, denkt er. Parada gibt ihm die Hand, und zu seiner Überraschung küsst Adán seinen Ring.
»Ist nicht nötig«, sagt Parada. »Wir haben uns lange nicht gesehen, Adán.«
»Fast sechs Jahre.«
»Was also -«
»Vielen Dank für die Geschenke, die Sie Gloria geschickt haben«, sagt Adán.
»Keine Ursache«, sagt Parada. »Ich lese auch Messen für sie. Bete für sie.«
»Das wissen wir zu schätzen. Mehr als Sie glauben.«
»Wie geht es Gloria?«
»Unverändert.«
Parada nickt. »Und Lucia?«
»Danke, gut.«
Parada nimmt Platz hinterm Schreibtisch, beugt sich mit gefalteten Händen vor und setzt seinen amtlichen Blick auf. »Vor sechs Jahren habe ich mich an Sie gewandt und um Gnade für einen wehrlosen Menschen gebeten. Und was haben Sie getan? Sie haben ihn umgebracht.«
»Es war ein Unfall«, sagt Adán. »Darauf hatte ich keinen Einfluss.«
»Sie können sich und mich belügen«, sagt Parada, »aber nicht Gott.«
Warum nicht, denkt Adán. Er belügt uns auch.
Aber er sagt: »Beim Leben meiner Frau und meiner Tochter, ich wollte Hidalgo befreien. Einer meiner Kollegen hat ihm versehentlich eine Überdosis verpasst, um seine Schmerzen zu lindern.«
»Infolge von Folter.«
»Nicht durch mich.«
»Genug, Adán«, sagt Parada und wedelt mit der Hand, wie um eine lästige Fliege zu verscheuchen. »Was führt Sie her? Brauchen Sie geistlichen Beistand?«
»Nein.«
»Dann...«
»Nicht ich, sondern mein Onkel.«
»Jesus konnte auf dem Wasser wandeln«, sagt Parada. »Seitdem hat es, glaube ich, keiner mehr geschafft.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
Parada nimmt eine Packung Zigaretten vom Schreibtisch, schüttelt sich eine in den Mund und zündet sie an. »Dass ich in Abweichung von der offiziellen Linie davon ausgehen muss, dass manche Menschen nicht zu retten sind. Was Sie von mir erwarten, ist ein Wunder.«
»Ich dachte, Wunder wären Ihr Geschäft.«
»Stimmt«, sagt Parada. »Im Moment zum Beispiel versuche ich, Tausende hungrige Menschen zu speisen, mit sauberem Wasser zu versorgen, ihnen ein Dach überm Kopf zu sichern, medizinische Versorgung, Bildung und ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Jedes für sich wäre schon ein Wunder.«
»Wenn es eine Frage des Geldes ist...«
»Scheiß auf das Geld!«, sagt Parada. »So. Ist Ihnen das deutlich genug?«
Adán lächelt und weiß wieder, warum er diesen Mann liebt. Und warum Padre Juan wahrscheinlich der einzige Priester ist, der die Nerven hat, Tío zu helfen. »Mein Onkel leidet Höllenqualen«, sagt er.
»Gut. Geschieht ihm recht.«
Als Adán eine Braue hochzieht, sagt Parada: »Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Höllenfeuer gibt, Adán, aber wenn, dann ist Ihr Onkel ein sicherer Anwärter.«
»Er ist abhängig von Crack.«
»Die ironischen Kommentare will ich mir verkneifen«, sagt Parada. »Sind Sie vertraut mit der Vorstellung vom Karma?«
»So etwa«, sagt Adán. »Ich weiß nur, dass er Hilfe braucht. Und dass Sie einem Mann in Not die Hilfe nicht verwehren dürfen.«
»Einem Mann, der aufrichtig Buße tut, sein Leben ändern will«, sagt Parada. »Trifft das auf Ihren Onkel zu?«
»Nein.«
»Trifft es auf Sie zu?«
»Nein.«
Parada steht auf. »Dann haben wir nichts mehr zu bereden.«
»Bitte besuchen Sie ihn«, sagt Adán. Er zieht einen Notizblock aus dem Jackett und schreibt ihm Tíos Adresse auf. »Wenn Sie ihn überreden könnten, eine Klinik aufzusuchen ...«
»In meiner Diözese gibt es Hunderte, die eine solche Behandlung brauchen, sie sich aber nicht leisten können.«
»Schicken Sie außer meinem Onkel noch fünf andere. Ich übernehme die Kosten.«
»Wie ich schon sagte -«
»Also gut, verzichten Sie auf mein Geld«, sagt Adán. »Wegen Ihrer Prinzipien müssen andere leiden.«
»Sie leiden an den Drogen, die Sie verkaufen.«
»... sagte er mit der Zigarette im Mund.« Adán senkt den Kopf und starrt einen Moment zu Boden. »Es tut mir leid. Ich wollte Sie um einen Gefallen bitten und hätte mich zusammenreißen müssen. Das hatte ich eigentlich vor.«
Parada nimmt einen langen Zug von seiner Zigarette, geht ans Fenster und blickt hinaus auf den Zócalo, auf dem die Straßenhändler ihre Votivgaben feilbieten.
»Ich werde Miguel Angel besuchen«, sagt er. »Aber ich glaube nicht, dass es etwas nützt.«
»Danke, Padre Juan.«
Parada nickt.
»Padre Juan?«
»Ja?«
»Es gibt viele, die hinter dieser Adresse her sind.«
»Ich bin kein Polizist«, sagt Parada.
»Ich hätte nichts sagen sollen.« Adán geht zur Tür. »Auf Wiedersehen, Padre Juan. Und vielen Dank.«
»Ändern Sie Ihr Leben, Adán.«
»Zu spät.«
»Wenn Sie das wirklich glauben würden, wären Sie nicht zu mir gekommen.«
Parada führt Adán in das kleine Foyer, in dem eine Frau mit einer kleinen Reisetasche über der Schulter wartet.
»Ich fahr dann mal los«, sagt sie zu Parada und schenkt Adán ein Lächeln.
»Nora Hayden«, sagt Parada, »Adán Barrera.«
»Mucho gusto«, sagt Adán.
»Mucho gusto.« Sie wendet sich an Parada. »In ein paar Wochen bin ich wieder da.«
»Ich freue mich auf dich.« Sie wendet sich zum Gehen.
»Ich muss auch los«, sagt Adán. »Darf ich Ihre Tasche tragen? Brauchen Sie ein Taxi?«
»Sehr nett von Ihnen.« Sie küsst Parada auf die Wange. »Adios.«
»Buen viaje.«
Draußen auf dem Zócalo sagt sie zu ihm: »Ihr ironisches Lächeln -«
»Habe ich ein ironisches Lächeln?«
»- ist völlig fehl am Platze. Es ist nicht so, wie Sie denken.«
»Sie missverstehen mich«, sagt Adán. »Ich liebe und achte den Mann. Ich wünsche ihm alles Glück dieser Welt und würde es ihm nicht neiden.«
»Wir sind nur Freunde.«
»Wie Sie meinen.«
»Es stimmt aber.«
Adán hält Ausschau. »Da drüben ist ein gutes Café. Ich wollte gerade frühstücken, aber ich esse ungern allein. Hätten Sie Lust und Zeit, mir Gesellschaft zu leisten?«
»Ich hab noch nichts gegessen.«
»Dann kommen Sie«, sagt Adán und, während sie über den Platz laufen, »Moment, ich muss kurz telefonieren.«
»Nur zu.«
Er holt sein Mobiltelefon heraus und wählt Glorias Nummer.
»Hola, - de mi alma«, sagt er, als sie sich meldet. Das Lächeln seiner Seele, das ist sie wirklich. Ihre Stimme ist die Nacht seiner Seele. »Wie geht es dir heute Morgen?«
»Gut, Papa. Wo bist du?«
»In Guadalajara. Ich besuche Tio.«
»Wie geht es ihm?«
»Auch gut«, sagt Adán. Er blickt hinaus auf den Platz, der sich zusehends mit Händlern füllt. »Esancho de mi corazón, Trost meines Herzens, hier gibt es Singvögel zu kaufen. Soll ich dir einen mitbringen?«
»Welche Lieder singen sie, Papa?«
»Ich glaube, die Lieder muss man ihnen beibringen. Kennst du welche?«
»Papa!« Sie lacht, weil sie weiß, dass er sie necken will. »Ich singe dir doch immer welche vor.«
»Ich weiß, ich weiß.« Deine Lieder brechen mir das Herz. »Ja, bitte, Papa«,, sagt sie. »Ich möchte einen Vogel.«
»Welche Farbe?«
»Gelb?«
»Ich glaube, ich sehe einen gelben.«
»Oder grün. Die Farbe ist egal, Papa. Wann kommst du nach Hause?«
»Morgen Abend«, sagt er. »Ich muss noch Onkel Gúero besuchen, dann komme ich.«
»Du fehlst mir.«
»Du mir auch«, sagt er. »Heute Abend rufe ich wieder an.«
»Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch.« Er beendet das Gespräch. »Ihre Freundin?«, fragt Nora.
»Die Liebe meines Lebens«, sagt Adán. »Meine Tochter.«
»Ah.«
Sie suchen sich einen Tisch im Freien. Adán hält ihr den Stuhl hin, dann sitzt er ihr gegenüber und schaut in diese auffallend blauen Augen. Sie weicht seinem Blick nicht aus. Schaut einfach nur zurück.
»Und Ihre Frau?«, fragt sie.
»Was ist mit ihr?«
»Das frage ich Sie.«
Metall trifft auf Holz.
Die Tür zerkracht mit einem Knall.
Angel zieht hastig seinen pito aus dem Mädchen zurück, als die Federales hereinkommen.
Das ist beinahe komisch, denkt Keller, als Tío mit heruntergelassener Hose zu rennen versucht, den rollenden Tropfständer im Schlepptau, um an die Waffen heranzukommen, die in der Ecke gestapelt sind. Dann kippt der Ständer krachend um, reißt ihm die Kanüle aus dem Arm, Tío fällt hin, auf die Waffen, richtet sich auf und will eine Handgranate entsichern, doch da hat ihn schon ein Soldat gepackt und ihm die Granate entrissen.
Noch immer ragt ein dicker weißer Hintern über den Küchentisch. Wie ein riesiger Teigklumpen. Bis Ramos hingeht und dem Mädchen mit dem Gewehrkolben einen Klaps versetzt.
»Au!«, schreit sie beleidigt.
»Du solltest ihm doch Frühstück machen, du Schlampe!«
Er reißt sie an den Haaren nach oben. »Zieh die Hose hoch. Deinen fetten Arsch will keiner sehen.«
»Ich gebe euch fünf Millionen«, sagt Angel zu den Federales. »Fünf Millionen amerikanische Dollar.« Dann sieht er Keller und weiß, dass fünf Millionen nicht reichen werden. Er fängt an zu weinen. »Bringt mich um! Bitte bringt mich um! Sofort!«
Das ist das Böse, wenn es nicht weiterweiß, denkt Keller.
Eine traurige Burleske.
Ein Mann, der mit heruntergelassenen Hosen in der Ecke sitzt und um den Gnadenschuss bettelt. Wie lächerlich.
»Drei Minuten«, sagt Ramos zu den Soldaten. Dann sollen sie zurückkommen.
»Holen wir dieses Stück Scheiße hier raus«, sagt Keller. Er kniet sich neben Adáns Onkel und flüstert ihm ins Ohr: »Tio, jetzt verrate ich dir, was du immer wissen wolltest.«
»Was?«
»Wer die Quelle Chupar war.«
»Wer?«
»Gúero Mendez«, lügt Keller. Gúero Méndez. Der Schweinehund.
»Er hasst dich«, erklärt ihm Keller, »weil du ihm die kleine Schlampe weggenommen und kaputtgemacht hast. Er wusste, er kriegt sie nur zurück, wenn er dich aus der Welt schafft.«
Komme ich an Adán, Raúl und Gúero nicht heran, denkt Keller, versuche ich's eben auf diese Art.
Sollen sie sich gegenseitig vernichten.
Adán sackt erschöpft über Nora zusammen. Sie umfasst seinen Hals, streichelt sein Nackenhaar.
»Das war unglaublich«, sagt er.
»Du hattest lange keine Frau, oder?«
»War das zu spüren?«
Direkt vom Café sind sie ins nächstbeste Hotel gegangen. Mit zitternden Fingern hat er ihre Bluse aufgeknöpft. »Aber du bist nicht gekommen«, sagt er. »Das wird schon«, sagt sie. »Beim nächsten Mal.«
»Beim nächsten Mal?«
Eine Stunde später stützt sie sich auf das Fensterbrett, und ihre Beine bilden ein muskulöses V, während er sie von hinten nimmt. Der Luftzug von draußen ist angenehm kühl, und sie täuscht ihm einen prächtigen Orgasmus vor.
Danach, sie liegen auf dem Fußboden, sagt er zu ihr: »Ich muss dich wiedersehen.«
»Das ließe sich arrangieren.«
Es ist nur eine Frage des Geldes.
Tío hockt in der Zelle.
Die Klageerhebung lief nicht gut - nicht so, wie sie hätte laufen sollen.
»Ich verstehe nicht, wieso Sie mich mit Kokainschmuggel in Verbindung bringen«, hat er sich beschwert. »Ich bin Autohändler. Alles, was mit Drogen zu tun hat, kenne ich nur aus der Zeitung.«
Und die Leute im Gerichtssaal haben gelacht.
Gelacht. Der Richter hat Untersuchungshaft angeordnet - ohne Kaution. Er sei ein gefährlicher Verbrecher, hat der Richter gesagt. Fluchtgefahr sei hochgradig gegeben. Besonders in Guadalajara, wo der Angeklagte über beträchtlichen Einfluss innerhalb der Justizorgane verfügt. Also haben sie ihn - in Handschellen - mit einem Militärflugzeug nach Mexico City verfrachtet. Und unter massiver Bewachung vom Flugzeug in einen Transporter mit schwarzen Scheiben. Dann in eine Einzelzelle des Almoloya-Gefängnisses.
Wo ihm die Kälte in die Knochen fährt.
Und das Verlangen nach Crack nagt an ihm wie ein ausgehungerter Hund. Es nagt und nagt und nagt - er braucht dringend Kokain.
Aber am schlimmsten ist die Wut.
Über den Verrat seiner Partner. Verrat auf der höchsten Ebene - sonst säße er nicht hier.
Dieser Hurensohn und sein Bruder in Los Pinos, dem wir mit unserem Geld zur Macht verholfen haben. Mit meinem Geld und dem Geld des Kartells haben wir Cárdenas den Wahlsieg abgejagt - und nun fallen sie mir in den Rücken. Diese gottverfluchten Hurensöhne.
Und die Amerikaner, die ich in ihrem Krieg gegen die Kommunisten unterstützt habe, die haben mich auch verraten.
Und Gúero Méndez, der mir meine Geliebte gestohlen hat. Méndez, der meine Geliebte geheiratet hat und ihr Kinder macht.
Auch Pilar, diese Schlampe, hat mich verraten.
Tío hockt auf dem Zellenboden, hat die Arme um die Knie gelegt und wippt mit dem Oberkörper vor lauter Wut und Drogenhunger. Es dauert einen Tag, bis sich ein Aufseher bereit findet, ihm Crack zu verkaufen. Er inhaliert den köstlichen Rauch und hält ihn in der Lunge fest, bis er in alle Gehirnwindungen vordringt. Ihm die Glückseligkeit bringt, dann die Klarheit.
Jetzt sieht er alles vor sich.
Seine Rache.
An Méndez.
An Pilar.
Mit einem Lächeln schläft er ein.
Fabián Martínez alias el Tiburón ist ein eiskalter Killer.
Und einer von Rauls wichtigsten Sicarios, sein bester Schütze. Es gab da einen Journalisten in Tijuana, dessen Hintergrundartikel ein wenig zu hintergründig wurden - el Tiburón hat ihn weggeputzt wie ein Monster im Videospiel. Dann den kalifornischen Beachboy und Dealer, der sich drei Tonnen Marihuana an den Strand von Rosarita liefern ließ, aber seine Landegebühren nicht bezahlte - el Tiburón hat ihn abgeschossen wie einen Ballon auf dem Jahrmarkt und ist auf eine Party gegangen. Oder die drei total beknackten Idioten aus Durango, die einen Kokaintransport der Barreras überfallen wollten - also, die hat el Tiburón mit der Kalaschnikow von der Straße gefegt wie Hundescheiße, dann mit Benzin übergossen und angezündet. Die Feuerwehr hatte Angst, sie zu löschen, aus gutem Grund, und man erzählt sich, zwei der Banditen hätten noch geatmet, als el Tiburón das Streichholz anzündete.
»So ein Schwachsinn«, sagt Fabián, wenn er das hört. »Stimmt gar nicht. Ich hab das Feuerzeug benutzt.« Wie auch immer.
Wenn er tötet, dann ohne Gefühl und ohne Gewissen.
Genau das brauchen wir, denkt Raúl, der nun mit ihm im Auto sitzt und ihn fragt, ob er den Barreras einen Gefallen tun will.
»Wir wollen, dass du die Geldlieferungen an Gúero Méndez übernimmst«, sagt Raúl. »Dass du der neue Kurier wirst.«
»Das ist alles?«, fragt Fabián.
Er hat an etwas anderes gedacht, an Einsätze, die ihm den süßen Adrenalin-Kick des Tötens bringen. Und tatsächlich, es ist nicht alles.
Pilars große Liebe sind ihre Kinder.
Sie ist eine junge Madonna, ihre Tochter ist erst drei Jahre alt, ihr Sohn noch kleiner, ihre Schönheit ist gereift, ihre Augen haben an Charakter gewonnen. Sie sitzt am Rand des Pools und lässt die Füße im Wasser baumeln.
»Die Kinder sind mein Ein und Alles«, sagt sie zu Fabián Martínez - und fügt leise hinzu: »Mein Mann nicht.«
Fabián findet Gúeros Anwesen total geschmacklos.
»Das ist der Geschmack der Drogenbarone«, bestätigt ihm Pilar und macht sich nicht die Mühe, ihre Verachtung zu verbergen. »Ich würde es gern anders haben, aber er hat so seine Vorstellungen ...«
Ein narcovaquero, denkt Fabián.
Ein Drogencowboy.
Statt seinen bäuerlichen Wurzeln zu entfliehen, prahlt er mit ihnen. Macht aus sich die groteske Kopie eines reichen Landbesitzers, wie es sie früher mal gab - und eines vaquero, eines mexikanischen Cowboys mit Stiefeln, ledernden Überhosen und Sombrero. Doch die neuen narcos stellen die Tradition auf den Kopf: schwarze Cowboyhemden aus Polyester, Perlmuttknöpfe aus Plastik, Überhosen aus Polyester in schrillen Farben - lindgrün, kanariengelb, korallenrot. Und hochhackige Stiefel. Keine praktischen Laufstiefel, sondern spitze Yankee-Cowboystiefel aus Straußenleder, Krokodilleder und anderen exotischen Materialien, rot oder grün gefärbt.
Die alten vaqueros hätten sich kaputtgelacht.
Oder sich im Grabe umgedreht.
Und das Haus...
Das ist Pilar nun echt peinlich.
Nicht der klassische Estancia-Stil, ebenerdig, mit Ziegeldach und hübscher Veranda - sondern eine Monstrosität in drei Etagen, mit gelben Ziegeln, Säulen und schmiedeeisernen Gittern. Und im Inneren gar! Ledersessel mit Seitenlehnen aus Rinderhörnern und mit Hufen anstelle der Beine. Sofas aus roten und weißen Rinderhäuten, Barhocker mit Sätteln anstelle der Polster.
»Was könnte er mit all dem Geld anfangen ...«, seufzt Pilar.
Apropos Geld. Fabián hat einen ganzen Koffer dabei. Nachschub für Gúero Méndez, für seinen Krieg gegen den guten Geschmack. Fabián ist jetzt der Kurier, denn für die Barrera-Brüder ist dieser Job zu gefährlich geworden, seit das mit Miguel Angel passiert ist.
Sie müssen sich bedeckt halten.
Also bringt jetzt Fabián jeden Monat das Geld und berichtet von der Front.
Auf der Ranch findet eine Wochenendparty statt. Pilar spielt die charmante Gastgeberin, und Fabián stellt mit Erstaunen fest, dass sie wirklich charmant ist - aufreizend charmant und klug. Beim abendlichen Dinner mit vielen Gästen sieht er ihr Gesicht im Kerzenschimmer und ist hingerissen.
Sie schaut zu ihm hinüber und fängt seinen Blick auf. Wie ein junger Filmstar sieht er aus.
Es dauert nicht lange, da geht er mit ihr am Pool spazieren, und sie gesteht ihm, dass sie ihren Mann nicht liebt.
Er weiß nicht, was er dazu sagen soll, also hält er den Mund. Und ist überrascht,, als sie weiterspricht. »Ich war so jung. Er auch. Und er sah richtig gut aus. Er wollte mich vor Don Angel retten, und das hat er getan. Wollte eine große Lady aus mir machen. Auch das hat er getan. Eine unglückliche große Lady.«
»Wieso unglücklich?«, fragt Fabián.
Was für eine dumme Frage.
»Ich liebe ihn nicht«, sagt sie. »Ist das nicht furchtbar von mir? Ich bin ein furchtbarer Mensch. Er hat keine anderen Frauen, geht nicht zu den Huren ... ich bin seine große Liebe - und habe deshalb Schuldgefühle. Gúero trägt mich auf Händen, und ich verachte ihn dafür. Wenn er zu mir kommt, fühle ich nichts ... gar nichts. Und mache eine Liste der Dinge, die ich an ihm hasse. Er ist unsensibel, hat keinen Geschmack, ist ein Bauer, ein Hinterwäldler. Ich hasse diese Ranch. Ich will zurück nach Guadalajara, wo es die richtigen Restaurants gibt, die richtigen Geschäfte. Ich will ins Museum, ins Konzert, ich will reisen. Rom, Paris, Rio. Und mich nicht mehr langweilen, mit mir und mit diesem Mann.«
Sie blickt hinüber zu den Gästen, die sich um die große Bar versammelt haben. »Die denken alle, ich bin eine Hure.«
»Das tun sie nicht.«
»Natürlich tun sie das«, sagt sie unbewegt. »Aber keiner hat den Mut, es laut zu sagen.«
Logisch, denkt Fabián - sie kennen alle die Geschichte von Rafael Barragos.
Nur Pilar kennt sie nicht. Oder?
»Rafi« war zu einer Grillparty gekommen, kurz nach der Heirat von Gúero und Pilar, und stand mit ein paar Freunden herum, als Gúero aus dem Haus trat, mit Pilar am Arm. Und Rafi konnte den Mund nicht halten. Gúero habe sich Barreras Hure vor den Karren gespannt, witzelte er. Und einer seiner braven Kumpels ging zu Gúero und plauderte. In derselben Nacht noch wurde Rafi aus seinem Gästezimmer geholt. Der Silberteller, den er dem Paar zur Hochzeit geschenkt hatte, wurde in seinem Beisein eingeschmolzen, dann steckten sie Rafi einen Trichter in den Mund, gossen das flüssige Silber hinein. Und Gúero sah zu.
So wurde Rafis Leiche gefunden - er hing mit dem Kopf nach unten an einem Telegrafenmast, zwanzig Meilen von der Ranch entfernt, mit weit aufgerissenen Augen, im Mund ein Silberklumpen. Und keiner wagte ihn abzuschneiden, weder die Polizei noch seine Angehörigen. Noch Jahre später erzählte der alte Mann, der dort in der Gegend Ziegen hütete, von dem seltsamen Klang, den die Krähen erzeugten, wenn sie mit ihren Schnäbeln auf Silber stießen.
Und die Stelle an der einsamen Straße hieß jetzt »Donde los cuervos son neos« - wo die Krähen reich sind.
Klar, sagt sich Fabián, alle haben sie Angst, dich Hure zu nennen.
Allein der Gedanke versetzt sie in Panik.
Und, denkt er, wenn Gúero das mit einem Mann macht, der dich beleidigt hat, was macht er dann mit einem Mann, der dich verführt? Kurz spürt auch er eine Aufwallung von Angst, dann verwandelt sie sich in Erregung. Er ist stolz auf seine Kaltblütigkeit, auf seine Qualitäten als Verführer.
In dem Moment flüstert sie ihm ins Ohr: »Yo quiero rabiar.«
Ich will brennen.
Ich will rasen.
Ich will toben.
Adán schreit seinen Orgasmus heraus.
Er sinkt auf Noras weiche Brüste, sie umklammert ihn fest mit den Armen und liefert ihm rhythmische Kontraktionen.
»Mein Gott«, keucht er.
Nora lächelt.
»Bist du gekommen?«, fragt er. »Und wie!«, lügt sie.
Sie will ihm nicht erzählen, dass sie bei einem Mann nie etwas empfindet, dass sie sich später, wenn sie allein ist, mit den Fingern befriedigen wird. Es wäre sinnlos, ihm das zu erzählen, und sie will seine Gefühle nicht verletzen. Sie mag ihn wirklich, empfindet eine Art Zuneigung für ihn, und einem Mann, den man mag, erzählt man so etwas nicht.
Seit ihrer Begegnung in Guadalajara treffen sie sich regelmäßig. Meistens, so wie heute, in einem Hotelzimmer in Tijuana, was ihr die Anfahrt von San Diego erleichtert und offenbar auch ihm angenehm ist. Einmal in der Woche etwa verschwindet er aus einem seiner Restaurants und trifft sich mit ihr im Hotel. Es ist die vielbeschworene »Liebe am Nachmittag« - am Abend ist er wieder zu Hause.
Das hat er von Anfang an klargemacht.
»Ich liebe meine Frau.«
Den Satz hat sie tausendmal gehört. Alle lieben sie ihre Frau. Und meistens stimmt es auch. Was sie wollen, ist Sex, nicht Liebe.
»Ich will ihr nicht weh tun«, hat Adán gesagt, als würde er seine Geschäftsgrundlage erläutern. Was ja auch den Tatsachen entspricht. »Ich will sie in keiner Weise kränken oder demütigen. Sie ist ein wundervoller Mensch. Ich werde sie oder meine Tochter niemals verlassen.«
»Gut«, hat Nora gesagt.
Sie sind beide Geschäftsleute und kommen schnell zu einer Vereinbarung, ohne emotionales Getue. Sie will auch kein Bargeld sehen. Er richtet ein Konto für sie ein und überweist ihr jeden Monat eine gewisse Summe. Er bestimmt Datum und Uhrzeit der Treffen, und sie wird da sein, unter der Bedingung, dass sie eine Woche vorher Bescheid bekommt. Wenn er sie öfter als einmal in der Woche sehen will, ist das okay, aber sie muss es vorher wissen.
Jeden Monat werden ihm diskret die Ergebnisse ihres Gesundheitstests ins Büro geschickt, und er tut dasselbe für sie, damit sie auf das lästige Kondom verzichten können.
Und noch etwas, worüber sie sich einigen: Padre Juan darf nichts erfahren.
Auf verrückte Weise haben beide das Gefühl, als würden sie ihn betrügen.
»Weiß er, wovon du lebst?«, hat er sie gefragt.
»Ja.«
»Und findet er das okay?«
»Wir sind und bleiben Freunde«, hat Nora darauf geantwortet. »Weiß er denn, wovon du lebst?«
»Ich bin Restaurantbesitzer.«
»Aha.«
Sie hat es damals nicht geglaubt, und jetzt, nach ein paar Monaten, glaubt sie es erst recht nicht. Sein Name hatte sie gleich an etwas erinnert, an eine Nacht, die fast zehn Jahre zurücklag, an die Nacht im Weißen Haus, als Jimmy Piccone sie auf so brutale Art in ihren Beruf eingeführt hatte. Gleich nach ihrer Rückkehr von Guadalajara hat sie Haley angerufen, sich nach Adán Barrera erkundigt und die ganze Geschichte erfahren.
»Sieh dich vor«, hat ihr Haley geraten. »Die Barreras sind gefährlich.«
Vielleicht, denkt Nora, während Adán in seinen postkoitalen Schlummer versinkt, aber diese Seite kennt sie nicht an ihm, und sie bezweifelt, ob es sie überhaupt gibt. Zu ihr ist er immer freundlich, sogar richtig süß. Sie bewundert, wie sehr er an seiner kranken Tochter und seiner frigiden Frau hängt. Er hat eben Bedürfnisse, das ist alles, und versucht, sie auf ethisch möglichst vertretbare Weise zu befriedigen.
Für einen welterfahrenen Mann ist er im Bett auffallend unerfahren. Behutsam musste sie ihm gewisse Praktiken, Stellungen, Techniken beibringen, und der Mann ist tief beeindruckt von den Genüssen, die sie ihm verschafft.
Und selbstlos ist er auch, denkt sie. Er steigt nicht mit dieser Konsumhaltung ins Bett, die so viele Kunden an den Tag legen, mit der Erwartung, dass ihnen zusteht, was die Platinum Card so bietet. Er will ihr Gutes tun, sie soll genauso viel Freude haben wie er.
Er behandelt mich nicht wie einen Automaten, denkt sie. Geld rein, Knopf drücken, Kaugummi raus.
Verflixt, ich mag den Kerl, denkt sie.
Er hat sich ihr geöffnet, sexuell und auch sonst. Sie verbringen mehr Zeit mit Reden. Nicht über Drogen, natürlich, er weiß, dass sie weiß, was er tut, und sie belassen es dabei - sondern über seine Restaurants, die Probleme, die damit verbunden sind, so viele Mäuler zu stopfen, so viele Gäste zufriedenzustellen. Sie reden über Sport - er ist entzückt, dass sie so gut übers Boxen Bescheid weiß, dass sie den Unterschied zwischen einem Slider und einem Curveball kennt - und auch den Aktienmarkt. Sie kümmert sich selbst um ihre Anlagen, und ihr Tag beginnt genauso wie seiner - mit einer Tasse Kaffee und dem Wall Street Journal. Sie diskutieren die Menüs auf seinen Speisekarten, das Ranking im Mittelgewicht, analysieren die Vor- und Nachteile von Aktienfonds im Vergleich zu Staatsanleihen.
Sie weiß, auch das ist ein Klischee, genauso wie die überstrapazierte »Liebe am Nachmittag«, aber Männer wollen reden, wenn sie zu einer Hure gehen. Die Ehefrauen dieser Welt könnten den Huren einen Großteil ihres Geschäfts abjagen, wenn sie auch die Sportseiten lesen, ein paar Minuten lang den Sportkanal oder Wall Street Week sehen würden. Ihre Männer wären bereit, stundenlang über Gefühle zu sprechen, wenn ihre Frauen nur ein kleines bisschen mehr über Sachen mit ihnen reden würden.
Daher gehört das zu ihrem Job, aber die Unterhaltungen mit Adán machen ihr wirklich Spaß. Sie interessiert sich für seine Themen, und sie ist gewöhnt an intelligente, erfolgreiche Männer, aber Adán ist etwas Besonderes. Ein scharfsinniger Analytiker. Er geht den Dingen auf den Grund.
Und gib's nur zu, sagt sie sich, auch sein Kummer macht ihn sympathisch. Die Last, die er mit stiller Würde trägt. Du hoffst, du kannst seine Schmerzen lindern, und der Gedanke reizt dich. Bei diesem Mann geht es nicht um seichte Befriedigung. Du kannst ihm helfen, seine Trauer ein wenig zu vergessen.
Schwester Nora, denkt sie. Warum nicht.
Florence Nightingale mit Blowjob statt Häubchen.
Sie beugt sich über ihn und streicht ihm sanft über den Nacken, bis er die Augen öffnet. »Du musst aufstehen«, sagt sie. »In einer Stunden hast du einen Termin, denk dran.«
»Danke.« Noch benommen vom Schlaf, steht er auf und geht unter die Dusche. Wie in den meisten Dingen, ist er auch darin flink und effizient. Er wäscht sich, trocknet sich ab, kommt zurück und zieht sich an.
Aber heute, während er das Hemd zuknöpft, sagt er: »Ich möchte dich exklusiv.«
»Oh, das wäre aber sehr teuer, Adán«, erwidert sie, ein bisschen verdattert. »Ich meine, wenn du mich die ganze Zeit haben willst, dann musst du mich für die ganze Zeit bezahlen.«
»Davon war ich ausgegangen.«
»Kannst du dir das leisten?«
»Geld gehört nicht zu meinen Problemen.«
»Adán«, sagt sie, »ich möchte nicht, dass du deine Familie finanziell belastest.«
Und bereut es sofort, denn sie sieht, dass sie ihn damit beleidigt. Er schaut von seinem Hemd auf, mit einem Blick, den sie noch nicht an ihm erlebt hat, und sagt: »Ich glaube, du weißt, dass ich so etwas niemals tun würde.«
»Ich weiß. Tut mir leid.«
»Ich besorge dir eine Wohnung hier in Tijuana. Wir könnten uns auf eine jährliche Vergütung einigen, die an jedem Jahresende neu verhandelt wird. Abgesehen davon müssten wir nie über Geld reden. Du wärst einfach meine -«
»Mätresse.«
»Ich dachte eher an >Geliebte<«, erwidert er. »Nora, ich liebe dich, du sollst Teil meines Lebens sein. Aber der größere Teil ist durch andere Dinge okkupiert.«
»Ich verstehe.«
»Das weiß ich, und ich weiß es zu schätzen, mehr als du glaubst. Ich weiß, dass du mich nicht liebst, aber ich bin mehr als ein gewöhnlicher Kunde, da bin ich sicher. Das Arrangement, das ich dir vorschlage, ist nicht ideal, aber es bietet ein Maximum dessen, was wir voneinander haben können.«
Er hat sich vorbereitet, denkt sie. Hat alles durchdacht, seine Wort sorgfältig gewählt, seinen Auftritt geprobt.
Eigentlich müsste sie seinen Vorschlag idiotisch finden, aber sie ist gerührt.
Dass er sich die Zeit nimmt, dass er sich solche Gedanken macht.
»Adán, dein Angebot ist schmeichelhaft, ich finde es sehr lieb und verlockend. Gibst du mir ein wenig Bedenkzeit?«
»Natürlich.«
Als er gegangen ist, setzt bei ihr das Nachdenken ein. Sie zieht Bilanz.
Du bist neunundzwanzig, sagt sie sich, jünger aussehend, aber trotzdem bald jenseits von Gut und Böse. Noch hast du feste Brüste, einen strammen Hintern, einen flachen Bauch, und das wird eine Weile so bleiben, aber mit jedem Jahr wird es schwerer, die Figur zu halten, und wenn du noch so hart trainierst. Das Alter kannst du nicht aufhalten.
Und es rücken junge Mädchen nach, Mädchen mit langen Beinen und hohen Brüsten, Mädchen, die einfach einen Body haben, auch ohne Hometrainer und Laufband, ohne Sit-ups und Gewichtheben, ohne Diät-Stress. Und zunehmend sind es solche Mädchen, die von den Typen mit der Platinum Card verlangt werden.
Also, wie viele Jahre bleiben dir?
Jahre an der Spitze. Denn ins Mittelfeld willst du nicht abrutschen, noch tiefer erst recht nicht. Wie viele Jahre, bis Haley dich zu den Kunden zweiter Klasse schickt - und dann überhaupt nicht mehr?
Zwei, drei oder, wenn es hoch kommt, fünf?
Was dann?
Hast du dann genug angespart, um dich zur Ruhe zu setzen?
Das hängt vom Markt ab, von den Wertpapieren. In drei oder fünf Jahren hab ich vielleicht genug, um in Paris zu leben, oder ich muss mir einen Job suchen. Aber welchen? ' Die Sexindustrie teilt sich in zwei große Branchen.
Prostitution und Porno.
Klar, man kann auch strippen, damit fangen die Mädchen an, aber sie bleiben nicht lange dabei. Entweder steigen sie aus, oder sie landen in einer der beiden Branchen. Die Stripper-Phase hast du übersprungen - danke, Haley! - und bist direkt zum Top-Level der Prostitution vorgestoßen. Doch was kommt danach? Porno?
Angebote hatte sie weiß Gott genug. Harte Arbeit, aber gutes Geld. Und sie hört, dass es auch mit der Gesundheitsfürsorge besser geworden ist. Aber irgendwie widerstrebt ihr der Gedanke, vor der Kamera zu arbeiten.
Und auch hier wieder die Frage: Wie lange kann das gehen?
Sechs oder sieben Jahre, bestenfalls.
Dann käme der steile Abstieg in die Billigproduktion. Blanke Matratzen am Swimmingpool, Lesbennummern, Gruppensex, die sexhungrige Hausfrau, die nymphomanische Schwiegermutter, die schwanzgeile, schluckfreudige Alte.
Und nach einem Jahr bist du fertig.
Aufgeschnittene Pulsader oder Überdosis.
Derselbe Abstieg, wenn du Callgirl bleibst. Du hast es gesehen, hast dich davor gegruselt, hast die Frauen bedauert, die zu lange dabeigeblieben sind, ihr Geld nicht gespart haben, sich keinen festen Freier zugelegt haben. Du hast gesehen, wie ihre Gesichter alterten, wie sie körperlich verfielen, wie sie verblödeten, und hast sie bemitleidet.
Mitleid.
Mit dir selbst oder mit anderen. Das hältst du nicht aus.
Nimm das Angebot an.
Er liebt dich, er behandelt dich gut.
Nimm es an, solange du jung und schön bist, solange er dich will, solange du ihm mehr geben kannst, als er zu träumen wagte. Nimm sein Geld, leg es auf die hohe Kante, und wenn er dich satt hat, wenn er den Jüngeren nachschaut, so wie er dir nachgeschaut hat, dann kannst du ihn verlassen, mit erhobenem Haupt und einer gesicherten Zukunft vor dir.
Kannst dich zur Ruhe setzen und das Leben genießen.
Sie beschließt, auf Adáns Angebot einzugehen.
Guamuchilito, Sinaloa,
Mexiko Tijuana,
Mexiko Kolumbien
Fabián brennt.
Seit Pilar ihm das zugeflüstert hat. »Yo quiero rabiar.«
Was wollte sie mir damit sagen? Das, was ich vermute! Er muss an ihren Mund denken, ihre Schenkel, ihre im Wasser baumelnden Füße, ihre Figur unter dem Badeanzug. Und stellt sich vor, wie er die Hand unter diesen Badeanzug schiebt, ihre Brüste berührt, ihre Spalte streichelt, wie er sie stöhnen hört, in sie eindringt und ...
Hat sie wirklich rabiar gesagt? Spanisch ist eine subtile Sprache, jedes Wort kann die verschiedensten Bedeutungen annehmen. Rabiar kann dürsten bedeuten, brennen, sich verzehren, toben, wüten, verrückt werden ... und all das hat sie gemeint - glaubt er. Es kann sich auch ganz speziell auf Sado-Maso beziehen - hat sie vielleicht auch angedeutet, dass sie gefesselt werden will, ausgepeitscht, brutal gefickt? Jetzt gehen seine Phantasien mit ihm durch. Phantasien, die er im Zusammenhang mit Frauen nie hatte. Er malt sich aus, wie er sie mit Seidenschals ans Bett fesselt, ihr den süßen Arsch versohlt, ihr die Peitsche zu kosten gibt. Er stellt sich vor, wie er sie von hinten fickt, wie sie schreit, er soll sie bei den Haaren packen. Wie er dicke Strähnen von ihren schwarzen, glänzenden Haaren packt und sie zügelt wie ein Pferd, bis sich ihr langer Hals durchbiegt und sie brüllt vor Schmerz und Lust.
»Yo quiero rabiar.«
Ay, Dios mío!
Beim nächsten Besuch von Rancho Méndez (endlose Wochen später) bleibt ihm fast die Luft weg, als er aus dem Auto steigt. In seiner Brust ballt sich etwas zusammen, er fühlt sich schwindlig - und auch schuldig. Fragt sich, als ihn Gúero mit einer Umarmung begrüßt, ob ihm dieses irrsinnige Verlangen nach Gúeros Frau nicht anzusehen ist.
Und mit Sicherheit ist es ihm anzusehen, als sie aus der Haustür tritt und ihn anlächelt. Sie hält das Baby und hat den anderen Arm um das kleine Mädchen gelegt, zu dem sie jetzt sagt: »Sieh mal, Claudia, Onkel Fabián ist da.«
Onkel Fabián ist es ein wenig peinlich.
Als hätte sie gesagt: Sieh mal, Claudia, Onkel Fabián will deine Mama vögeln. Und wie er das will! An diesem Abend küsst er sie.
Gúero, der Trottel, lässt die beiden allein im Wohnzimmer sitzen, weil er telefonieren muss, sie stehen am Kamin, er riecht ihren Mimosenduft, und sein Herz ist kurz vorm Explodieren. Da begegnen sich ihre Blicke, und sie küssen sich.
Ihre Lippen sind unglaublich weich.
Wie überreife Pfirsiche.
Ihm wird schwindlig.
Der Kuss endet, und sie lösen sich voneinander.
Verzaubert.
Und verängstigt.
Er entfernt sich von ihr, geht in die andere Ecke. »Ich wollte nicht, dass es passiert«, sagt sie. »Ich auch nicht.« Aber er hat es gewollt. Es läuft alles nach Plan.
Den Plan hat er von Raúl, aber er ist sicher, dass er von Adán stammt. Oder von Miguel Angel Barrera persönlich. Und Fabián führt ihn aus.
Bald also tauschen sie verstohlene Küsse, heimliche Umarmungen, berühren sich wie zufällig, wechseln Blicke. Es ist ein irrsinnig gefährliches Spiel, irrsinnig aufregend. Das Spiel mit dem Sex, das Spiel mit dem Tod. Denn Gúero bringt sie beide um, wenn er dahinterkommt.
»Ich glaube nicht«, sagt Pilar zu Fabián. »Dich bringt er sicher um. Bei mir wird er ein großes Geschrei machen, dann wird er mir verzeihen.«
Sie sagt es fast traurig.
Sie will keine Vergebung. Sie will brennen.
Trotzdem sagt sie: »Zwischen uns kann nie etwas passieren.«
Fabián stimmt ihr zu. Doch er denkt das Gegenteil. Es kann. Und es wird. Das ist mein Job, mein Auftrag, mein Befehl. Verführe Gúeros Frau. Hol sie von ihm weg.
Er fängt mit den drei Zauberworten an. Was wäre, wenn?
Das sind die mächtigsten Worte, egal in welcher Sprache.
Was wäre, wenn wir uns schon vorher irgendwo treffen? Was wäre, wenn wir frei wären? Was wäre, wenn wir zusammen reisen könnten - Paris, Rio, Rom? Was wäre, wenn wir fliehen würden? Was wäre, wenn wir genug Geld mitnehmen würden, um ein neues Leben anzufangen?
Wie Kinder, die sich in ein Spiel hineinsteigern (Was wäre, wenn diese Steine aus Gold wären?), fangen sie an, sich ihre Flucht in allen Einzelheiten auszumalen - wann es passieren soll, was sie mitnehmen wollen. Wie sie wegkommen, ohne dass Gúero etwas merkt. Wie sie die Wachen überlisten. Wo sie sich treffen. Was mit den Kindern wird. Dass sie die Kinder nicht zurücklassen wird. Dass sie das niemals tun könnte.
All diese Phantasien werden in kurzen Gesprächsfetzen ausgetauscht, wenn Gúero gerade nicht hinhört - im Geiste ist sie ihm schon untreu geworden. Im Schlafzimmer, wenn sie unter ihm liegt, denkt sie an Fabián. Gúero ist stolz auf sich, wenn sie ihren Orgasmus herausschreit (das ist neu, das war vorher nicht), aber sie denkt an Fabián. Selbst den Orgasmus stiehlt sie ihm.
Ihre Untreue ist komplett, nur ihr Körper gehört Gúero noch.
Aus dem Vorstellbaren werden Phantasien, aus den Phantasien werden Vorsätze, aus den Vorsätzen werden Pläne. Es ist so befreiend, dieses neue Leben zu planen. Bis ins kleinste Detail. Da sie beide modeverrückt sind, nutzen sie die wenigen kostbaren Minuten, um zu bereden, was sie einpacken müssen, was sie später dort kaufen können (»dort« heißt Paris, Rio, Rom - je nachdem).
Oder wichtigere Dinge: Wollen wir Gúero eine Nachricht hinterlassen? Wollen wir zusammen fliehen oder getrennt und uns irgendwo treffen? Und wenn, wo? Wollen wir separat reisen oder im selben Flugzeug? Uns über den Gang sehnsüchtige Blicke zuwerfen - einen quälenden Nachtflug lang, in einem Pariser Hotel die Kinder ins Bett stecken und uns ins andere Zimmer zurückziehen? Rabiar.
Nein, so lange kann ich nicht warten, sagt sie zu ihm. Ich gehe auf die Flugzeugtoilette, und du kommst nach. Nein, sie treffen sich in einer Bar in Rio. Als wären sie Fremde. Er folgt ihr hinaus auf den Hof, presst sie gegen den Zaun.
Rabiar.
Wirst du mir weh tun?
Wenn du willst.
Ja.
Dann tu ich dir weh.
Er ist alles, was Gúero nicht ist: intelligent, gutaussehend, gut angezogen, sexy. Und charmant. Unglaublich charmant.
Sie ist zu allem bereit.
Sie fragt ihn, wann es losgeht.
»Bald«, sagt er. »Ich will mit dir weg, aber ...«
Aber.
Die schreckliche Gegenmacht von Was wäre, wenn. Der Störfaktor Realität.
»Wir brauchen dafür Geld«, sagt er. »Ich habe Geld, aber nicht genug, damit wir so lange abtauchen können, wie es nötig ist.«
Er weiß, das ist der heikle Punkt. Das könnte die Seifenblase zum Platzen bringen. Jetzt schwebt sie noch schillernd dahin, aber die schnöden finanziellen Probleme könnten ihr im Nu den Garaus machen. Er setzt eine bekümmerte Miene auf, fügt ein bisschen Schüchternheit hinzu und sagt mit gesenktem Blick: »Wir müssen noch warten, bis ich genug beisammen habe.«
»Wie lange denn noch?«, fragt sie. Sie klingt verletzt, enttäuscht, den Tränen nahe.
Er muss behutsam vorgehen. Äußerst behutsam. »Nicht lange«, sagt er. »Ein Jahr vielleicht. Oder zwei.«
»Das ist zu lange!«
»Tut mir leid. Was soll ich machen?«
Er lässt die Frage im Raum stehen. Bis sie die Antwort liefert, die er erhofft hat. »Ich habe Geld.«
»Nein«, sagt er. »Niemals.«
»Aber zwei Jahre -«
»Ganz und gar unmöglich.«
So wie der Flirt zwischen ihnen ganz und gar unmöglich war, dann die Küssereien, dann die Fluchtpläne ... »Wie viel würden wir brauchen?«, fragt sie. »Mehrere Millionen. Genau deshalb brauche ich ja -«
»Die könnte ich von der Bank holen.«
»Ich aber nicht.«
»Du denkst nur an dich«, sagt sie. »Das ist dein männlicher Stolz. Du bist eben ein Macho. Wie kannst du nur so egoistisch sein!«
Und das ist der Trick, denkt Fabián. Jetzt kann er den Spieß umdrehen, und es wird zu einem Akt der Großzügigkeit, ihr Geld anzunehmen, ein Ausdruck seiner Selbstlosigkeit. Jetzt liebt er sie so sehr, dass er sogar seinen männlichen Stolz dafür opfert, seinen machismo.
»Du liebst mich nicht«, schmollt sie.
»Ich liebe dich mehr als mein Leben.«
»Aber nicht genug, um -«
»Doch«, sagt er. . Und sie umarmt ihn.
Wieder in Tijuana, geht er zu Raúl und gibt ihm Bescheid, dass es losgehen kann.
Es hat Monate gedauert, aber jetzt bekommt der Hai seine Beute.
Gutes Timing, denkt Raúl.
Der Krieg gegen Gúero Méndez kann beginnen.
Sorgfältig faltet Pilar ein kurzes schwarzes Kleid zusammen und legt es in den Koffer.
Zu den schwarzen BHs, Slips und der anderen Wäsche.
Fabián mag sie in Schwarz.
Sie will ihm gefallen. Ihr erstes Mal mit ihm soll perfekt sein. Ihr Traum soll nicht enttäuscht werden. Aber das ist nicht zu befürchten. Kein Mann redet so wie er, zaubert so mit Worten wie er, hat solche Ideen wie er. Sie wird schon feucht, wenn er mit ihr spricht - was soll das erst werden, wenn er sie wirklich in den Armen hält?
Er soll alles mit mir machen, was er will, denkt sie.
Wirst du mir weh tun?
Wenn du willst.
]a.
Dann tu ich dir weh.
Sie hofft, dass er es wahr macht, dass er sich nicht von ihrer Schönheit einschüchtern lässt.
Und nicht die Nerven verliert. Denn sie will ein neues Leben anfangen, sie will weg aus dieser toten Gegend, weg von ihrem Mann und seinen primitiven Freunden. Sie will, dass es ihre Kinder besser haben - bessere Schulen, Kultur, ein Gefühl dafür, dass die Welt mehr zu bieten hat als dieses groteske Märchenschloss am Ende der Welt.
Und Fabián verkörpert dieses Gefühl - sie haben darüber geredet. Er will sie herausführen aus dem engen Kreis der narcotraficantes, er will Freundschaften aufbauen, Beziehungen zu Bankiers, Investoren, sogar zu Künstlern und Schriftstellern.
Genau das wünscht sie sich.
Für sich und ihre Kinder.
Daher wird sie, als sich Gúero beim Frühstück vom Tisch entfernt und Fabián ihr das Wort »heute« zuflüstert, von einer ungeheuren Erregung gepackt. Es ist fast ein kleiner Orgasmus.
»Heute?«, flüstert sie zurück.
»Gúero muss wegfahren«, sagt Fabián. »Seine Felder inspizieren.«
»Ja.«
»Wenn ich zum Flughafen fahre, kommst du mit. Ich habe einen Flug nach Bogotá gebucht.«
»Auch für die Kinder?«
»Natürlich. Kannst du ein paar Sachen einpacken? Schnell?«
Jetzt hört sie Gúeros Schritte auf dem Flur. Sie schiebt den Koffer unters Bett.
Er sieht die verstreuten Sachen. »Was machst du?«
»Ich wollte ein bisschen altes Zeug aussortieren«, sagt sie. »Das bringe ich zur Kirche.«
»Und dann gleich wieder shoppen?«, fragt er, um sie zu necken. Er mag es, wenn sie einkauft, wenn sie Geld ausgibt. Er ermuntert sie dazu.
»Wahrscheinlich.«
»Ich muss weg«, sagt er. »Den ganzen Tag, vielleicht sogar über Nacht.«
Sie küsst ihn zärtlich. »Du wirst mir fehlen.«
»Du mir auch«, sagt er. »Vielleicht suche ich mir eine kleine Freundin, um mich zu wärmen.«
War mir nur recht, denkt sie. Dann würdest du mich öfter mal in Ruhe lassen. Aber sie sagt: »Du doch nicht. Du bist doch nicht wie diese Gomeros.«
»Und ich liebe meine kleine Frau.«
»Ich dich auch.«
»Ist Fabián schon weg?«
»Nein, ich glaube, er packt gerade.«
»Dann sag ich ihm auf Wiedersehen.«
»Und gib den Kindern einen Kuss.«
»Schlafen die nicht noch?«
»Natürlich«, sagt sie. »Aber sie freuen sich, wenn du ihnen zum Abschied einen Kuss gibst.«
Er umarmt seine Frau und küsst sie. »Eres toda mi vida.« Du bist mein Ein und Alles.
Kaum ist er gegangen, schließt sie die Tür und holt den Koffer unterm Bett vor.
Adán sagt seiner Familie Adieu.
Geht ins Kinderzimmer und küsst Gloria auf die Wange. Das Mädchen strahlt.
Trotz allem, denkt Adán, ist sie so fröhlich, so tapfer. Im Käfig am Fenster zwitschert der Vogel, den er ihr aus Guadalajara mitgebracht hat.
»Hast du dem Vogel einen Namen gegeben?«, fragt er. »Gloria.«
»Er heißt so wie du?«
»Nein«, kichert sie. »Wie Gloria Trevi.«
»Aha.«
»Du fährst weg, nicht wahr?«, sagt sie. »Ja.«
»Papaaa...«
»Nur eine Woche etwa.«
»Wohin?«
»Ziemlich weit weg. Costa Rica. Vielleicht Kolumbien.«
»Warum?«
»Um Kaffee zu kaufen. Für die Restaurants.«
»Kaffee gibt es doch auch hier.«
»Der ist nicht gut genug für unsere Restaurants.«
»Darf ich mitkommen?«
»Diesmal nicht«, sagt er. »Vielleicht nächstes Mal.«
Wenn es ein nächstes Mal gibt, denkt er. Wenn alles läuft, wie es laufen soll in Badiraguato, in Culiacán und auf der Brücke über den Rio Magdalena, wo er die Orejuelas treffen will.
Wenn alles gutgeht, meine Kleine.
Wenn nicht, dann weiß Lucia, wo die Versicherungspolicen liegen, wie sie an die Konten auf den Caymans herankommt, an die Wertpapiere in den Schließfächern. Wenn es nicht gutgeht, dann stoßen ihn die Orejuela-Brüder von der Brücke, dann haben seine Frau und sein Kind für den Rest ihres Lebens ausgesorgt.
Auch Nora.
Er hat bei seinem Banker ein Konto für sie eingerichtet.
Wenn er von dieser Reise nicht zurückkommt, hat sie alles, was sie braucht, um sich selbständig zu machen, ein neues Leben anzufangen.
»Was soll ich dir mitbringen?«, fragt er seine Tochter. »Dass du wiederkommst«, sagt sie.
Geradezu unheimlich, die Intuition kleiner Kinder, denkt er. Als könnten sie Gedanken lesen.
»Dann lass dich überraschen«, sagt er. »Gibst du Papa einen Kuss?«
Er spürt ihre trockenen Lippen auf der Wange, ihre dünnen Ärmchen, die sich um seinen Hals schlingen und nicht loslassen wollen. Das bricht ihm das Herz. Am liebsten würde er bei ihr bleiben, und für einen Moment wird er schwankend. Soll er nicht doch lieber aussteigen, sich nur noch um die Restaurants kümmern? Aber dafür ist es zu spät - jetzt steht der Krieg mit Gúero bevor, und wenn sie Gúero nicht erledigen, erledigt er sie.
Also gibt er sich einen Ruck, löst ihre Arme von seinem Hals und richtet sich auf.
»Adios, mein Kleines«, sagt er. »Ich ruf dich an. Jeden Tag.«
Er dreht sich schnell weg, damit sie seine Tränen nicht sieht. Sie soll nicht erschrecken. Er geht hinüber ins Wohnzimmer, wo ihn Lucia erwartet, mit seinem Koffer und dem Jackett.
»Etwa eine Woche«, sagt er.
»Du wirst uns fehlen.«
»Du mir auch.« Er küsst sie auf die Wange, nimmt sein Jackett und geht zur Tür.
»Adán?«
»Ja?«
»Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Klar«, sagt er. »Bin nur ein bisschen müde.«
»Vielleicht kannst du im Flugzeug schlafen.«
»Vielleicht.« In der Tür dreht er sich noch einmal um und sagt: »Lucia, du weißt, dass ich dich liebe.«
»Ich liebe dich auch, Adán.«
Es klingt wie eine Entschuldigung, und so ist es wohl auch gemeint. Dass sie das Bett nicht mit ihm teilt, dass sie nicht anders kann, beim besten Willen nicht. Dass sie ihn aber trotzdem liebt.
Er geht mit einem traurigen Lächeln.
Auf dem Weg zum Flughafen ruft er Nora an und sagt ihr, dass sie sich diese Woche nicht sehen werden. Vielleicht nie wieder, denkt er und legt auf.
Alles hängt davon ab, was in Culiacán passiert. Wo die Banken gerade geöffnet haben.
Pilar hebt sieben Millionen Dollar ab.
In drei verschiedenen Banken von Culiacán.
Zwei der Bankmanager erheben Einwände, wollen erst Señor Méndez benachrichtigen - und zu Fabians Schrecken greift der eine schon zum Telefon -, aber Pilar macht ihre Sache gut und weist den verdutzten Manager zurecht. Erklärt ihm, dass sie Señora Méndez ist und nicht irgendeine Hausfrau, die ihr Wochenlimit überzieht.
Der Hörer landet wieder auf der Gabel.
Sie bekommt ihr Geld.
Und noch bevor sie zum Flugplatz fahren, lässt Fabián sie noch eine Reihe telegrafische Überweisungen vornehmen - zwei Millionen Dollar an ein Dutzend Banken in aller Welt. »Jetzt können wir leben«, sagt er zu ihr. »Er findet uns nicht und das Geld auch nicht.«
Sie stecken die Kinder in Pilars Auto und fahren zum Flugplatz, zu einem Privatflug nach Mexico City.
»Wie hast du das alles arrangiert?«, fragt ihn Pilar. »Ich habe einflussreiche Freunde«, antwortet er. Sie ist beeindruckt.
Gúerito ist natürlich noch zu klein, um zu verstehen, was passiert, aber Claudia will wissen, wo ihr Papa ist. »Wir machen was ganz Lustiges«, sagt sie, »wir spielen Versteck mit ihm.« Das Mädchen akzeptiert die Erklärung, aber Pilar sieht, dass sie sich trotzdem Sorgen macht.
Die Fahrt zum Flughafen ist schrecklich aufregend; ständig schauen sie nach hinten, ob sie von Gúero und seinen Sicarios verfolgt werden. Dann fahren sie direkt hinaus aufs Rollfeld, wo das Privatflugzeug schon bereitsteht. Beim Warten auf die Starterlaubnis wirft Fabián einen Blick aus dem Fenster - und sieht Gúero mit einer kleinen Mannschaft nahen. Zwei Jeeps, die mit scharfem Tempo aufs Rollfeld fahren.
Der Bankmanager hat ihn also doch benachrichtigt.
Pilar starrt Fabián an, die Augen vor Entsetzen geweitet. Und vor Erregung.
Gúero springt aus dem Jeep, Pilar verfolgt, wie er auf einen Wachmann einredet, dann entdeckt er sie - sieht sie im Flugzeug sitzen. Fabián nutzt diesen Moment, sie demonstrativ auf den Mund zu küssen, dann dreht er sich zum Cockpit um und ruft »Vamonos!«.
Das Flugzeug setzt sich in Bewegung, Gúero springt in den Jeep und jagt ihm nach, die Rollbahn entlang, dann spürt Pilar, wie es vom Boden abhebt. Sie erheben sich in die Lüfte, Gúero mitsamt der kleinen Welt von Culiacán wird immer kleiner.
Am liebsten würde Pilar sofort mit Fabián in der engen Flugzeugtoilette verschwinden, aber die Kinder schauen sie erwartungsvoll an, und sie muss die Sache aufschieben, was ihre Ungeduld und ihre Erregung nur steigert.
Erst fliegen sie nach Guadalajara zum Auftanken, dann nach Mexico City, wo sie in ein Charterflugzeug nach Belize umsteigen. Dort werden sie bestimmt ein Weilchen bleiben, denkt sie, in einem netten Strandhotel, wo sie sich endlich austoben können. Doch auf dem kleinen Flugplatz von Belize steigen sie wieder um und fliegen weiter nach San José, Costa Rica, wieder glaubt sie, dass sie jetzt mindestens einen Tag Pause machen, doch sie checken zu einem Flug nach Caracas ein, den sie aber nicht antreten.
Statt dessen geht es mit einem weiteren Charterflug nach Cali, Kolumbien.
Mit falschen Pässen und falschen Namen.
Es ist alles so aufregend, so spannend, und als sie schließlich in Cali gelandet sind, sagt Fabián, dass sie ein paar Tage bleiben werden. Sie nehmen ein Taxi zum Hotel Internacional, wo Fabián unter wieder anderen Namen zwei benachbarte Zimmer bucht, und sie hält es kaum noch aus, als sie zu viert in dem einen Zimmer sitzen und darauf warten, dass die übermüdeten Kinder einschlafen.
Dann nimmt er sie beim Handgelenk und führt sie ins Nachbarzimmer.
»Ich will duschen«, sagt sie.
»Nein.«
»Nein?«
Ein Wort, das sie nicht gewöhnt ist. Er sagt: »Zieh dich aus. Sofort.«
»Aber -«
Er schlägt ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Dann setzt er sich auf einen Stuhl in der Ecke und schaut ihr zu, wie sie ihre Bluse aufknöpft und abstreift. Die Schuhe abschüttelt und die Hose fallen lässt und in schwarzer Wäsche dasteht.
»Alles.«
Einfach irre, dieses klopfende Gefühl in seinem Schwanz. Ihre weißen Brüste, dazu der schwarze BH. Er will sie berühren, streicheln, aber er weiß, sie will was anderes, und enttäuschen darf er sie auf keinen Fall.
Sie hakt den BH auf, ihre Brüste fallen, aber nur ein kleines bisschen. Dann streift sie das Höschen ab und sieht ihn erwartungsvoll an. Sie wird knallrot und fragt: »Was nun?«
»Aufs Bett«, sagt er. »Auf allen vieren. So dass ich alles sehen kann.«
Sie zittert, als sie aufs Bett klettert, sich ihm darbietet.
»Bist du feucht genug für mich?«, fragt er.
»Ja.«
»Soll ich dich ficken?«
»Ja.«
»Sag bitte.«
»Bitte.«
»Noch nicht.«
Er schnallt den Gürtel ab, zieht sie an den Händen hoch - Gott, was für Brüste! Wie sie zittern!, - fesselt ihre Handgelenke und knotet den Gürtel am Kopfende fest.
Jetzt greift er sich eine Handvoll von ihrem Haar, zieht ihr den Kopf in den Nacken, besteigt sie von hinten-, schlägt auf sie ein, reitet sie mit scharfem Tempo. Sie liebt die klatschenden Geräusche, die Schläge, das Pulsen, mit dem ihr Orgasmus losbricht.
Es tut höllisch weh. Yo quiero rabiar.
Pilar brennt. Ihre Haut brennt, ihr Hintern brennt, ihre Spalte brennt, sie windet sich unter seinen Schlägen, er fickt sie wie ein Irrer, er lässt nicht von ihr ab, sie kniet unter ihm, ihre Hände sind ans Kopfende gefesselt.
Die Schmerzen tun so gut. Sie hat zu lange warten müssen, Monate, seit es mit dem Flirt losging, dann die Phantasien, dann das Pläneschmieden und jetzt auch noch die aufregende, erregende Flucht.
Ah. Ah. Ah. Ah.
Seine Schläge und ihr Keuchen bilden einen eigenen Rhythmus.
»Voy a morir!«, stöhnt sie. »Voy a morir!«
Jetzt, Jetzt! Es kommt! Ich sterbe!
»Voy a volar!«
Ich fliege! Ich explodiere!
Dann schreit sie.
Ein langer, tierischer, zitternder Schrei.
Pilar kommt aus dem Bad und setzt sich aufs Bett. Bittet ihn, den Reißverschluss ihres Kleides zu schließen. Er bewundert ihre herrliche Haut. Ihr prächtiges Haar. Mit dem Handrücken streicht er über ihr Haar, er küsst ihren Nacken.
»Später, mi amor«, gurrt sie. »Die Kinder warten im Auto.«
Er umfasst ihren Hals, reibt mit der anderen Hand ihre Brustwarze. Sie stöhnt und lässt sich zurücksinken. Schon ist sie wieder auf allen vieren, wartet, dass er sie nimmt (er zögert einen Moment, um ihre Erwartung zu steigern). Er packt sie am Haar, reißt ihren Kopf hoch.
Dann spürt sie den Schmerz.
Am Hals.
Das ist Sado-Maso, denkt sie, er will sie würgen, aber er hört nicht auf, und der Schmerz ist - Sie windet sich. Sie brennt.
Yo quiero rabiar.
Jetzt fängt sie an zu strampeln, ihre Beine zucken unkontrolliert.
Fabián zischt ihr ins Ohr: »Das ist für Don Miguel Angel. Er schickt dir seine Liebesgrüße.«
Er zieht die Drahtschlinge fest zu und zieht immer weiter, sie schneidet sich durch ihre Kehle, dann durch ihre Nackenwirbel. Ihr Kopf zuckt noch einmal hoch, bevor er zu Boden fällt, mit einem dumpfen Aufprall.
Das Blut spritzt bis an die Decke.
Fabián packt das glänzende schwarze Haar und hebt den Kopf auf. Ihre leblosen Augen starren ihn an. Er legt den Kopf in eine Kühlbox, verschließt sie, schiebt die Kühlbox in einen Karton, den er schon adressiert hat. Er umwickelt den Karton mit mehreren Lagen Klebeband.
Dann geht er duschen.
Ihr Blut tanzt auf seinen Füßen, bevor es kreisend im Abfluss verschwindet.
Er trocknet sich ab, zieht frische Sachen an und geht mit dem Karton hinunter auf die Straße.
Die Kinder warten auf dem Rücksitz.
Fabián rutscht neben sie und nickt Manuel zu. Manuel kann losfahren.
»Wo ist Mama? Wo ist Mama?«, fragt Claudia.
»Wir treffen sie dort.«
»Wo denn?« Claudia fängt an zu weinen.
»An einem ganz besonderen Ort«, sagt Fabián. »Es wird eine Überraschung.«
»Was für eine Überraschung?«, fragt Claudia neugierig und hört auf zu weinen.
»Wenn ich das verrate, ist es keine Überraschung mehr, oder?«
»1st der Karton auch eine Überraschung?«
»Welcher Karton?«
»Der Karton, den du in den Kofferraum gelegt hast. Ich hab es gesehen.«
»Nein«, sagt Fabián. »Das ist nur ein Paket, das ich abschicken muss.«
Manuel muss am Postamt halten. Fabián geht mit dem Paket hinein und hebt es auf den Schalter. Überraschend schwer, ihr Kopf, denkt er. Er denkt an ihr kräftiges schwarzes Haar, wie schwer es sich anfühlte, als er damit spielte, es streichelte, durch seine Finger gleiten ließ. Im Bett war sie spitze, denkt er. Und spürt zu seinem gelinden Erschrecken einen gewissen Kitzel - beim Gedanken an das, was er getan hat, und an das, was er jetzt vorhat.
»Welche Versandart?«, fragt der Beamte. »Eilpaket.«
Der Mann legt es auf die Waage. »Wollen Sie es versichern?«
»Nein.«
»Teuer wird es auch so«, sagt der Mann. »Wollen Sie wirklich Eilzustellung? In zwei oder drei Tagen ist es dort.«
»Nein, es muss morgen ankommen.«
»Ein Geschenk?«
»Ja. Ein Geschenk.«
»Eine Überraschung?«
»Das will ich hoffen«, sagt Fabián. Er zahlt das Porto und geht hinaus zum Auto.
Claudia hat inzwischen wieder Angst bekommen.
»Ich will zu Mama.«
»Ich bringe euch hin«, sagt Fabián.
Die Brücke Santa Ysabel überspannt eine Schlucht gleichen Namens, durch die, 215 Meter tiefer, der Rio Magdalena über zerklüftete Felsen schießt - auf dem langen, hindernisreichen Weg von seinen Quellen in den Kordilleren bis zur Karibik, der ihn quer durch Kolumbien führt, vorbei an Cali und Medellin.
Adán versteht recht gut, warum die Orejuela-Brüder diesen Ort ausgesucht haben - die Brücke liegt sehr einsam, und die Straße ist in beiden Richtungen einsehbar, so dass ein Hinterhalt nicht zu erwarten ist. Zumindest ist es zu hoffen, denkt Adán. Die Wahrheit ist, sie könnten hinter mir die Straße abriegeln, ohne dass ich es merke. Aber das Risiko muss man in Kauf nehmen. Ohne die Kokainlieferungen der Orejuelas haben sie keine Chance, den Krieg gegen Gúero und die übrige Federación zu gewinnen.
Den Krieg, der inzwischen unwiderruflich erklärt sein dürfte.
El Tiburón müsste schon mit Pilar Méndez geflohen sein, sie dazu gebracht haben, ihrem Mann Millionen von Dollar zu stehlen. Er müsste jeden Moment hier auftauchen - mit dem Geld, das die Orejualas von der Federación fortlocken soll. All das gehört zu Tíos Plan: Er nimmt Rache an Gúero, indem er ihm Hörner aufsetzt und die Demütigung dadurch komplett macht, dass ihm seine Frau das Geld entwendet, mit dem der Krieg gegen ihn finanziert wird.
Es könnte aber auch sein, dass Fabián schon mit dem Kopf nach unten an einem Telegrafenmast hängt, den Mund voll Silber, und die Orejuelas kommen, um mir den Garaus zu machen.
Adán hört Motorengeräusch, ein Auto naht von hinten. Entweder, denkt er, habe ich gleich ein paar Kugeln im Rücken, oder das ist Fabián mit dem Geld. Er dreht sich um -
Es ist Fabián mit Chauffeur, und hinten auf dem Rücksitz sieht er Gúeros Kinder. Was zum Teufel soll das? Adán steigt aus seinem Auto und geht Fabián entgegen. »Hast du das Geld?«
Fabián lächelt sein Hollywood-Lächeln. »Mit einem ExtraBonus.«
Er übergibt Adán den Koffer mit den fünf Millionen. »Wo ist Pilar?«, fragt Adán.
»Auf dem Heimweg«, sagt Fabián mit einem schiefen Grinsen, das Adán schaudern lässt.
»Ohne die Kinder?«, fragt er. »Was sollen die hier? Was -«
»Ich befolge nur Rauls Anweisungen«, sagt Fabián. »Adán -« Er zeigt zum anderen Ende der Brücke. Ein schwarzer Landrover ist dort aufgetaucht und kommt langsam näher.
»Warte hier«, sagt Adán. Er nimmt den Koffer und geht dem Landrover entgegen.
Fabián hört die dünne Mädchenstimme: »Wartet Mama dort auf uns?«
»Ja«, sagt Fabián.
»Wo denn? Ist sie bei den Leuten dort?« Claudia zeigt auf den Landrover, aus dem gerade die Orejuelas aussteigen. »Ich glaube, ja«, sagt Fabián. »Ich will da hin.«
»Du musst noch ein paar Minuten warten«, sagt Fabián. »Ich will aber jetzt!«
»Wir müssen erst mit diesen Männern reden.«
Wie vereinbart, geht Adán bis zur Mitte der Brücke. Seine Beine fühlen sich an wie Holz. Er hat Angst. Wenn sie dort drüben einen Scharfschützen platziert haben, bin ich tot, und alles ist aus, denkt er sich. Aber sie hätten mich schon vorher umbringen können. Jedes Mal, wenn ich in Kolumbien war. Also sind sie neugierig, was ich ihnen zu sagen habe.
Er wartet in der Mitte der Brücke, während die Orejuelas näher kommen. Zwei Brüder, Manuel und Gilberto, klein, dunkel, stämmig. Sie schütteln sich die Hand, dann sagt Adán: »Kommen wir ins Geschäft?«
»Deshalb sind wir hier«, sagt Gilberto.
»Du wolltest dieses Treffen«, sagt Manuel.
Abweisend, denkt Adán. Schroff. Gilberto scheint also einem Deal nicht abgeneigt, während Manuel sich sträubt. Nun denn, ans Werk.
»Ich habe vor, unser Kartell aus der Federación herauszulösen«, sagt Adán. »Und möchte sichergehen, dass unsere Verbindung nach Kolumbien erhalten bleibt.«
»Unsere Verbindung besteht mit Abrego«, sagt Manuel, »und mit der Federación.«
»Ganz recht«, sagt Adán. »Aber für jedes Kilo, das die Federación bei euch kauft, kauft sie fünf Kilo in Medellin.«
Er sieht, dass er einen Nerv getroffen hat, besonders bei Gilberto. Die Brüder sind eifersüchtig auf ihre mächtigen Rivalen in Medellin. Und ehrgeizig. Und da die amerikanische DEA so entschlossen gegen das Medellin-Kartell und seine Schmuggelrouten nach Florida vorgeht, wittern die Brüder eine Chance, ihren Marktanteil zu vergrößern.
»Und du bietest uns einen Exklusivvertrag?«
»Wenn ihr mit uns ins Geschäft kommt«, sagt Adán, »beziehen wir unsere Ware ausschließlich bei euch in Cali.«
»Äußerst großzügig«, sagt Manuel. »Aber wir kriegen Ärger mit Don Abrego, wenn wir nur noch an euch liefern und nicht mehr an ihn.«
Doch Gilberto sucht schon nach Lösungen. Adán merkt, er hat angebissen.
»Don Abrego ist die Vergangenheit«, sagt Adán. »Wir sind die Zukunft.«
»Das sollen wir glauben?«, sagt Manuel. »Euer Boss sitzt im Gefängnis. Alle wichtigen Leute in Mexiko sagen, ihre Zukunft liegt bei Abrego. Und wenn nicht bei ihm, dann ... bei Méndez.«
»Wir werfen Méndez aus dem Rennen.«
»Wie soll das gehen?«, fragt Manuel. »Das bedeutet Krieg gegen Méndez, und Abrego stellt sich hinter Méndez, genauso wie die anderen Kartelle. Und die Federales. Nichts für ungut, Adán Barrera, aber ich glaube, ich sehe einen toten Mann vor mir, der mir einen Exklusivdeal anbietet. Ich soll die Lebenden in die Wüste schicken und mit den Toten Geschäfte machen. Wie viel Kokain nimmst du mir ab, wenn du unter der Erde liegst?«
»Wir sind das Barrera-Kartell«, sagt Adán. »Wir haben bis jetzt gesiegt, und wir werden -«
»Nein«, sagt Manuel. »Nimm's mir nicht übel, aber ihr seid nicht mehr das Barrera-Kartell. Ja, dein Onkel, der hätte Abrego besiegen können und Méndez und die ganze mexikanische Regierung, aber du bist nicht dein Onkel. Du bist sehr schlau, aber Schlauheit allein genügt nicht. Du musst auch hart sein. Und ich will dir die Wahrheit sagen, Adán. Für mich bist du ein Weichling. Ich glaube einfach nicht, dass du hart genug bist, zu tun, was du tun musst.«
Adán nickt, dann fragt er, ob er den Koffer öffnen darf, der neben ihm steht.
Die Brüder nicken ebenfalls, er klappt den Koffer auf. »Fünf Millionen. Von Gúero Méndez. Wir haben uns seine Frau geholt, sie hat uns das Geld besorgt. Wenn ihr immer noch glaubt, wir können ihn nicht besiegen, dann erschießt mich, werft mich von der Brücke. Und lasst euch von der Federación weiter mit Almosen abspeisen. Wenn ihr aber glaubt, dass wir Méndez besiegen können, dann betrachtet dieses Geld als Geste unseren guten Willens und als Anzahlung auf die vielen Millionen, die wir noch zusammen machen werden.«
Er setzt eine entspannte Miene auf, doch er sieht den beiden an, dass sie schwanken, dass der Schuss nach hinten losgehen kann.
Auch Fabián sieht es.
Und seine Anweisungen in diesem Fall sind klar. Befehl von Raúl. Und Raúl hat ihn von M-i.
»Kommt«, sagt Fabián zu den Kindern.
»Gehen wir zu Mama?«, fragt Claudia.
»Sí.« Fabián hebt Gúerito auf seine Schulter und nimmt Claudia bei der Hand. So gehen sie zur Mitte der Brücke.
Meine Frau! Meine geliebte Frau!
Gúeros Schreie hallen durch das große, leere Haus.
Das Dienstpersonal versteckt sich. Die Wachen draußen sind in Deckung gegangen, während Gúero durchs Haus stolpert, Möbel umwirft, Geschirr zerschlägt, sich auf das Rindsledersofa wirft, das Gesicht schluchzend in den Kissen vergräbt.
Er hat ihre knappe Mitteilung gefunden: Ich liebe dich nicht mehr. Ich bin mit Fabián gegangen und habe die Kinder mitgenommen. Es geht ihnen gut.
Er ist am Boden zerstört. Er würde alles tun, um sie zurückzubekommen. Würde ihr verzeihen, um ihre Liebe werben. All das erzählt er den Kissen. Dann reckt er den Kopf in die Höhe und heult. Meine Frau! Meine geliebte Frau!
Seine Sicarios, die das Anwesen bewachen, hören ihn schreien und sind geschockt. Seit der Verhaftung von Don Miguel Angel Barrera liegen ihre Nerven blank. Sie wissen, dass ein Krieg bevorsteht, ganz sicher aber ein Machtkampf, und der ist gewöhnlich mit Blutvergießen verbunden.
Und nun läuft el jefe durchs Haus und heult wie ein Weib, so dass es jeder hören kann.
Das lässt einiges befürchten.
Und es geht schon den ganzen Tag so.
Ein FedEx-Lieferwagen kommt angefahren.
Ein Dutzend Kalaschnikows richten sich auf den Fahrer.
Die Wachen stoppen das Auto im sicheren Abstand vom Tor. Einer hält den Fahrer in Schach, ein anderer inspiziert die Ladung. »Was willst du hier?«, fragt er den völlig verstörten Mann.
»Ein Paket für Señor Méndez.«
»Von wem?«
Der Fahrer zeigt auf den Aufkleber. »Von seiner Frau.«
Jetzt ist der Wachmann verstört. Don Gúero hat gesagt, er will nicht behelligt werden, aber wenn das ein Paket von Señora Méndez ist, muss er es wohl ins Haus bringen.
»Ich bringe es ihm«, sagt er.
»Ich brauche seine Unterschrift.«
Der Wachmann schiebt ihm den Gewehrlauf unters Kinn. »Ich kann doch sicher für ihn unterschreiben, oder?«
»Ja, natürlich.«
Der Wachmann unterschreibt, trägt das Paket zum Haus und klingelt. Ein Dienstmädchen kommt an die Tür. »Don Gúero will nicht ge-«
»Ein Paket von der Señora. Federal Express.«
Hinter dem Dienstmädchen erscheint Gúero. Seine Augen sind verschwollen und rotgeweint.
»Was ist hier los?«, fährt er den Sicario an. »Gottverdammt, ich hab doch gesagt -«
»Ein Paket von der Señora.«
Gúero nimmt es entgegen und knallt die Tür zu.
Gúero reißt die Verpackung auf.
Ein Paket von ihr!
Er reißt die Verpackung auf und stößt auf eine Kühlbox. Er löst den Verschluss und klappt den Deckel auf und sieht ihr glänzendes schwarzes Haar.
Ihre toten Augen.
Ihren offenen Mund.
Und zwischen ihren Zähnen eine Karte. Er schreit und schreit.
Die erschrockenen Wachmänner treten die Haustür ein.
Stürzen ins Zimmer, und dort steht el jefe, neben einer Kühlbox, und schreit und schreit. Der Wachmann, der das Paket gebracht hat, schaut in die Kühlbox, dann krümmt er sich und erbricht. Pilars abgetrennter Kopf ruht in einer Pfütze aus getrocknetem Blut. Ihre Zähne halten ein Kärtchen.
Zwei andere Wachen nehmen Gúero bei den Armen und wollen ihn wegziehen, aber er macht die Beine steif und schreit weiter. Der Wachmann, dem übel geworden ist, wischt sich den Mund ab, reißt sich zusammen und zieht die Karte zwischen Pilars Zähnen hervor.
Die Botschaft ist unverständlich.
Hallo, Chupar.
Die zwei Männer wollen Gúero zum Sofa führen, aber er nimmt ihnen das Kärtchen weg, liest es, wird noch bleicher, falls das überhaupt möglich ist, und schreit: »O Gott, meine Kinder! Wo sind meine Kinder?«
»Wo ist meine Mama? Ich will meine Mama!«, schreit Claudia, weil sie ihre Mutter nicht sieht, nur ein paar fremde Männer, die ihnen auf der Brücke entgegenstarren. Gúerito, der ihre Angst spürt, fängt an zu weinen. Sie sträubt sich, zerrt an Fabians Arm und schreit. »Mi madre! Mi madre!«
Aber Fabián zieht sie weiter zur Mitte der Brücke.
Adán sieht ihn kommen.
Ein Alptraum, eine Ausgeburt der Hölle.
Adán ist wie gelähmt, seine Füße sind festgenagelt, er steht einfach nur da, während Fabián den Orejuela-Brüdern entgegenlächelt und sagt: »Don Miguel Angel Barrera lässt euch mitteilen, dass sein Blut auch in den Adern seines Neffen fließt.«
Adán glaubt an Zahlen, an Wissenschaft, an Physik. Und genau in diesem Moment begreift er das Böse. Er begreift, dass es eine Eigendynamik besitzt, dass es, einmal in Gang gesetzt, nicht mehr zu stoppen ist. Ganz nach den Gesetzen der Physik: Ein ruhender Körper ruht, solange er nicht in Bewegung versetzt wird, ein bewegter Körper bleibt in Bewegung oder gibt seine Energie weiter.
Der Energieerhaltungssatz.
Und Tíos Plan ist wie immer brillant. Sein Gehirn, obwohl von Drogen zerfressen, durchschaut das Wesen des Menschen mit tödlicher Präzision. Das ist Tíos Genie. Er weiß, dass ein Mensch, der stark genug ist, das Böse ins Rollen zu bringen, nicht stark genug sein muss, es zu stoppen. Dass es nicht leicht ist, sich des Bösen zu erwehren, dass es aber die schwerste Sache der Welt ist, sich dem Bösen entgegenzustellen.
Sich einem Tsunami entgegenzuwerfen.
Denn genau darum geht es jetzt, weiß Adán, während sich seine Gedanken überschlagen. Wenn ich den Lauf der Dinge jetzt aufhalte, gebe ich mir vor den Orejuelas eine Blöße - zeige ich eine Schwäche, die tödliche Folgen haben wird. Wenn zwischen mir und Fabián auch nur die geringste Kluft aufbricht, bedeutet das unseren sicheren Untergang.
Das ist Tíos Genie. Er manövriert mich genau an diesen Punkt, in eine Situation, in der ich so gut wie keine Wahl habe.
»Ich will Mama!«, schreit Claudia.
»Pst«, flüstert Fabián. »Ich bringe dich zu ihr.«
Fabián schaut auf Adán. Er wartet auf ein Signal.
Und Adán weiß, dass er das Signal geben wird.
Weil ich eine Familie zu schützen habe, denkt Adán. Und ich habe keine Wahl. Die Familie von Méndez oder meine Familie.
Wäre Parada hier, würde er das anders ausdrücken. Er würde sagen, in der Abwesenheit von Gott gibt es nur Natur, und die Gesetze der Natur sind grausam. Die erste Handlung der Sieger ist es, die Brut der Verlierer zu vernichten. Ohne Gott gibt es kein anderes Gesetz. Nur das Gesetz des Überlebens.
Nein, denkt Adán. Gott ist nicht hier.
Er nickt.
Fabián packt das Mädchen und wirft es übers Geländer. Ihre Haare flattern wie hilflose Flügel, und sie verschwindet in der Tiefe, während Fabián den kleinen Jungen mit lockerem Schwung hinterherwirft.
Adán zwingt sich zum Hinsehen.
Die Kinder fallen zweihundert Meter tief, bevor sie auf die Felsen aufschlagen.
Dann schaut er die Orejuela-Brüder an, deren Gesichter vor Entsetzen kalkweiß sind. Gilbertos Hand zittert, als er den Koffer schließt, beim Griff packt und mit unsicherem Schritt davongeht. Zurück zum Auto.
Während der Rio Magdalena die zwei Kinderleichen mit sich nimmt und das Blut.
9 Tage der Toten
Befreit mich niemand von diesem lästigen Priester?
Mordbefehl Heinrichs II. gegen den Erzbischof von Canterbury (1170)
San Diego
1994
Heute ist Totentag in Mexiko. Ein großer Feiertag.
Er geht zurück auf die Zeit der Azteken und feiert die Göttin Mictecacihuatl, die »Herrin des Todes«, aber die Spanier haben für Ordnung gesorgt und den Feiertag vom Mittsommer auf den Herbst verlegt, damit er mit Allerheiligen und Allerseelen zusammenfällt. Klar, warum nicht, denkt Keller. Aber die Dominikaner können machen, was sie wollen - gefeiert wird la muerte.
Die Mexikaner finden nichts dabei, vom Tod zu reden. Sie haben jede Menge Namen dafür: Die Herzensdame, Die Knochige, Die Magere oder schlicht la Muerte. Sie weichen dem Tod nicht aus. Sie sind ihm innig verbunden. Ihre Toten sind ihnen immer nahe. Und am Totentag besuchen die Lebenden die Toten. Sie kochen etwas besonders Gutes, gehen auf den Friedhof und genießen ihre Mahlzeit mit den lieben Verstorbenen.
Na wunderbar, denkt Keller. Ich möchte mit meiner lebenden Familie eine Mahlzeit genießen. Sie wohnen in derselben Stadt wie ich, atmen dieselbe Luft wie ich, und doch sind sie unendlich weit entfernt.
Die Scheidungspapiere hat er unterschrieben, als er von dem Mord an Pilar und ihren beiden Kindern erfuhr. War es die Einsicht ins Unvermeidliche, fragt er sich, oder eine Form der Buße? Er weiß, dass er mitschuldig ist. Er hat diesen grausamen Feldzug in Gang gesetzt, er hat Tío eingeflüstert, hinter der imaginären Quelle Chupar habe Gúero gesteckt. Als ihm über Geheimdienstkanäle das Gerücht zu Ohren kam, die Barreras hätten Pilar enthauptet und ihre Kinder in Kolumbien von einer Brücke geworfen, griff er endlich zum Stift und unterzeichnete die Papiere, die seit Monaten auf seinem Schreibtisch lagen.
Er übertrug Althie das volle Sorgerecht für die Kinder.
»Danke, Art«, hat sie gesagt. »Woher der plötzliche Sinneswandel?«
Meine Buße.
Auch ich verliere zwei Kinder.
Natürlich hat er sie nicht verloren. Er bekommt sie jedes zweite Wochenende und für einen Monat im Sommer. Er fährt mit Cassie zum Volleyball und mit Michael zum Baseball. Er geht zu allen Schulversammlungen, Theatervorführungen, Ballettdarbietungen, Elternabenden.
Aber es hat etwas Forciertes. Familie funktioniert nicht zu festgelegten Zeiten, und ihm fehlen die vielen kleinen Dinge. Ihnen das Frühstück zu machen, ihnen vorzulesen, mit ihnen auf dem Fußboden zu kabbeln.
Und ihm fehlt Althie.
Mein Gott, und wie sie ihm fehlt!
Wie konnte es nur so weit kommen?
Nur weil er »der Herr der Grenze« werden wollte? So nennen sie ihn jetzt bei der DEA - »the Border Lord«. Hinter seinem Rücken. Nur Shag nicht. Der sagt es ihm ins Gesicht. Bringt ihm eine Tasse Kaffee ins Büro und fragt: »Wie geht's dem Border Lord heute Morgen?«
Technisch gesprochen ist er der Chef der Einsatzgruppe Südwestgrenze und Leiter des Ausschusses, der den Drogenkrieg koordiniert: ein Zusammenschluss von DEA, FBI, Grenzschutz, Zoll und Einwanderungspolizei, Staats- und Bundespolizei. Sie alle sind ihm rechenschaftspflichtig. Er leitet ein großes Büro in San Diego, mit entsprechend vielen Leuten.
Es ist eine Machtposition, genau die, die er von John Hobbs gefordert hat.
Außerdem ist er Mitglied im Vertical Committee. Das ist eine sehr kleine Gruppe, sie besteht aus ihm und Hobbs und koordiniert die Aktivitäten der DEA und der CIA in ganz Amerika, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Füße treten. Das ist der erklärte Zweck. Der unerklärte: Es soll verhindert werden, dass Keller der Firma ins Handwerk pfuscht.
Das war der Deal. Keller bekommt die Führung über die Einsatzgruppe Südwestgrenze, damit er seinen Krieg gegen die Barreras führen kann, als Gegenleistung lässt er sich von der CIA an die Leine legen.
Heute ist Totentag?, denkt er in seinem Wagen, der in einer Straße von La Jolla steht. Warum lege ich mir keine Leckerbissen aufs eigene Grab?
Dann sieht er Nora Hayden aus der Boutique kommen.
Sie hat ziemlich feste Gewohnheiten, zumindest seit er sie beobachtet. Auf sie aufmerksam gemacht haben ihn seine Quellen in Tijuana. Sie haben gemeldet, Adán Barrera habe eine Freundin, eine Mätresse, er habe ihr eine Wohnung gemietet und besuche sie regelmäßig.
Sehr leichtsinnig von Adán, sich eine Amerikanerin für seine Eskapaden auszusuchen, denkt Keller beim Anblick der Frau, die ihm mit zwei vollen Tüten entgegenkommt. Sieht ihm gar nicht ähnlich. Stand er doch - bislang jedenfalls - im Ruf, ein treuer Familienvater zu sein.
Aber er kann es verstehen, als er Nora in Augenschein nimmt.
Eine Schönheit, wie man sie selten sieht. Äußerlich betrachtet, denkt er und ruft sich zu Bewusstsein, dass dieses Miststück mit Adán Barrera schläft. Beruflich.
Vor drei Monaten hat er ihr einen Beschatter angehängt, der sie verfolgte, als sie aus Mexiko zurückkam. Seitdem kennt er ihren Namen und ihre Adresse, und wenig später kam noch ihre Arbeitgeberin dazu.
Haley Saxon.
Die DEA hat Madame schon seit Jahren auf dem Kieker, ebenso, wie sich herausstellt, das Finanzamt. Die Polizei von San Diego weiß natürlich genau über das Weiße Haus Bescheid, aber angesichts ihrer prominenten Kundschaft hat es bisher niemand gewagt, in dieses Wespennest hineinzustechen.
Und nun stellt sich heraus, dass Adáns segundera eine Spitzenkraft bei Haley Saxon ist. Pech für Nora, denkt Keller. Wäre sie bei Mary Kay angestellt, hätte sie schon ihre eigene Flotte von pinkfarbenen Cadillacs.
Er wartet, bis sie näher kommt, dann steigt er aus und zeigt ihr seine Marke. »Ms. Hayden, wir müssen miteinander reden.«
»Ich glaube nicht, dass wir das müssen.«
Sie hat umwerfend blaue Augen, ihre Stimme ist kultiviert und selbstbewusst. Er muss sich immer von neuem daran erinnern, dass sie nur eine Hure ist.
»Setzen wir uns in den Wagen?«, schlägt Keller vor.
»Warum sollten wir?«
Sie will weitergehen, aber er hält sie am Ellbogen fest. »Soll ich etwa Ihre Freundin Haley Saxon wegen gewerbsmäßiger Prostitution verhaften lassen?«, fragt er. »Ihren Laden für immer dichtmachen?«
Jetzt lässt sie sich zum Auto führen. Er öffnet ihr die Beifahrertür, und sie steigt ein. Er geht ums Auto herum und setzt sich auf den Fahrersitz.
Nora blickt demonstrativ auf die Uhr. »Ich will um viertel nach eins ins Kino.«
»Reden wir über Ihren Freund.«
»Meinen Freund?«
»Oder ist Barrera Ihr >Klient<? Oder Ihr >John<?«
»Er ist mein Liebhaber«, sagt sie. Ohne zu zucken.
»Bezahlt er Sie dafür?«
»Das geht Sie nichts an.«
»Wissen Sie, wovon Ihr Liebhaber lebt?«
»Er ist Restaurantbesitzer.«
»Dass ich nicht lache.«
»Sagen wir, ich hege Sympathie für Beschäftigungen, die von der Gesellschaft als illegal betrachtet werden.«
»Klar, okay«, sagt Keller. »Wie steht's mit Mord? Haben Sie auch dafür Sympathie?«
»Adán hat niemanden umgebracht.«
»Fragen Sie ihn nach Ernie Hidalgo«, sagt Keller. »Und da wir schon dabei sind, fragen Sie ihn nach Pilar Méndez. Er ließ ihr den Kopf abschneiden. Und ihre Kinder - wissen Sie, was Ihr Freund mit ihren Kindern gemacht hat? Er hat sie von einer Brücke geworfen.«
»Das ist eine Verleumdung, die von Gúero Méndez verbreitet wird, um -«
»Hat Ihnen das Adán erzählt?«
»Was wollen Sie von mir, Mr. Keller?«
Die typische Geschäftsfrau, denkt Keller. Kommt direkt zur Sache. Sehr gut. Bringen wir unseren Spruch an. Hoffen wir, dass es klappt.
»Ihre Zusammenarbeit«, sagt Keller.
»Sie wollen, dass ich Spitzeldienste -«
»Sagen wir, Sie sind in der einzigartigen Situation, dass Sie -« Sie öffnet die Wagentür. »Ich komme zu spät ins Kino.« Er hält sie am Arm fest. »Gehen Sie zu einer späteren Vorführung.«
»Sie haben nicht das Recht, mich gegen meinen Willen festzuhalten«, sagt Nora. »Ich habe nichts verbrochen.«
»Lassen Sie mich ein paar Sachen erklären«, sagt Keller. »Wir wissen, dass die Barreras Anteile am Geschäft von Haley Saxon halten. Das allein schon bringt sie in Schwierigkeiten. Wenn in ihrem Haus jemals einschlägige Treffen stattgefunden haben, ist das organisierte Kriminalität, ich kann sie für zwanzig Jahre oder für immer hinter Gitter bringen, und Sie sind schuld. Aber Sie haben alle Zeit der Welt, sich bei ihr zu entschuldigen, denn ich stecke Sie in dieselbe Zelle. Können Sie Ihre Einkünfte vollständig belegen, Ms. Hayden? Wissen Sie, mit welchem Geld Ihr >Liebhaber< Barrera Sie bezahlt? Oder wäscht er sein Drogengeld zusammen mit seiner schmutzigen Bettwäsche? Sie stecken tief mit drinnen, Ms. Hayden. Aber Sie können da wieder rauskommen. Sie können sogar Ihre Freundin Haley da rausholen. Ich reiche Ihnen die helfende Hand. Greifen Sie zu!«
Sie schaut ihn an, mit purer Verachtung.
Was in Ordnung ist, denkt Keller. Sie soll mich nicht lieben. Sie soll nur machen, was ich will.
»Wenn Sie Haley verhaften könnten, wie Sie behaupten«, sagt sie ruhig, »dann hätten Sie's schon getan. Und wenn Sie mich verhaften können - bitte schön. Tun Sie, was Sie nicht lassen können!«
Sie will wieder aussteigen.
»Wie ist das mit Parada?«, fragt er. »Ist der auch Ihr Klient?« Denn sie wissen, dass sie ihn häufig in Guadalajara besucht, sogar in San Cristobal.
Sie dreht sich um und funkelt ihn an. »Sie sind ein Dreckstück.«
»Das können Sie annehmen.«
»Nur damit Sie's wissen: Juan und ich sind befreundet.«
»Ach ja?«, fragt Keller. »Wäre er auch Ihr Freund, wenn er wüsste, dass Sie Prostituierte sind?«
»Er weiß es.«
Und liebt mich trotzdem, denkt Nora.
»Weiß er auch, dass Sie sich an einen so miesen kleinen Mordbuben wie Adán Barrera verkaufen? Wird er Ihr Freund bleiben, wenn er das erfährt? Soll ich ihn anrufen? Wir kennen uns von früher.«
Ich weiß, denkt Nora. Er hat mir von dir erzählt. Nur nicht, wie grässlich du bist.
»Tun Sie, was Sie für richtig halten, Mr. Keller. Mir ist es egal. Darf ich jetzt gehen?«
»Für diesmal.«
Sie steigt aus und stakst davon, ihr Kleid umflattert ihre schön gebräunten Beine.
Sie sieht aus, als käme sie vom Rendezvous, denkt Keller.
Du dummes Arschloch, du hast es verpfuscht.
Aber ich würde gern wissen, ob sie Adán von unserem kleinen Rendezvous erzählt.
Mexiko
1994
Adán hat den ganzen Tag auf Friedhöfen verbracht.
Er musste neun Gräber besuchen, neun kleine Altäre bauen, neun aufwendige Mahlzeiten zelebrieren. Neun Familienmitglieder, ermordet von Gúero Méndez, in einer einzigen Nacht, vor kaum einem Monat. Seine Leute, getarnt mit den schwarzen Uniformen der Federales, hatten sie aus ihren Häusern geholt oder auf der Straße gekidnappt, in ihre Schlupflöcher verschleppt und gefoltert, dann ihre Leichen auf die Straße geworfen, auf belebte Plätze, wo die Straßenfeger sie am Morgen fanden.
Zwei Onkel, eine Tante und sechs andere Verwandte - darunter zwei Kinder der Tante.
Eine Cousine arbeitete als Anwältin für das Kartell, aber die anderen hatten mit den Drogengeschäften nicht das Geringste zu tun. Zum Verhängnis wurde ihnen einzig die Verwandtschaft mit Miguel Ángel und Adán und Raúl. Mehr war nicht nötig. Na gut, dasselbe gilt für Pilar und ihre Kinder, denkt Adán. Méndez hat nicht damit angefangen, ganze Familien auszurotten.
Das waren wir.
Folglich haben alle erwartet, dass es so kam. Jeder in Mexiko, der sich in der Drogenszene auskennt. Méndez und sein »Blutiger September«. Die Polizei hat kaum zur Aufklärung der Morde beigetragen. »Nichts anderes war zu erwarten«, lautet die landläufige Meinung. »Sie haben seine Frau und seine Kinder umgebracht.« Und nicht nur umgebracht, sie haben ihm auch den Kopf seiner Frau geschickt und ein Video davon, wie seine Kinder von der Brücke stürzen. Das war zu viel. Selbst für mexikanische Verhältnisse, selbst für die narcotraficantes. Seitdem sind die Barreras in Verruf geraten. Und wenn Méndez jetzt Vergeltung übt, indem er Mitglieder der Barrera-Familie umbringt, dann war das gar nicht anders zu erwarten.
Adán hat also einen anstrengenden Tag. Früh am Morgen zu den Gräbern in Mexico City, dann mit dem Flugzeug nach Guadalajara, um auch dort seinen Pflichten nachzukommen, anschließend hierher nach Puerto Vallaría, wo sein Bruder Raúl - typisch für ihn - eine Party steigen lässt.
»Nun lach doch mal«, ruft ihm Raúl zu, als er den Club betritt. »Heute ist Totentag!«
Klar, sie haben Schläge einstecken müssen. Aber sie haben auch ausgeteilt.
»Vielleicht sollten wir denen auch was ans Grab bringen«, sagt Adán.
»Dann wären wir pleite«, erwidert Raúl, »wenn wir alle füttern müssten, die wir zum Teufel gejagt haben. Sollen sich ihre Familien drum kümmern.«
Die Barreras gegen den Rest der Welt.
Cali gegen Medellin.
Hätte Adán den Deal mit den Orejuela-Brüdern nicht hingekriegt, würden er und Raúl jetzt Blumen und Essen ans Grab gebracht kriegen. Aber dank dem beständigen Nachschub aus Cali haben sie genug Geld und Leute, um den Krieg durchzustehen. Die Schlacht um die Hoheitsgebiete war blutig, aber kurz. Raúl hat die Dealer vor eine eindeutige Wahl gestellt: Wollt ihr Coca-Cola oder Pepsi verkaufen? Ihr müsst euch entscheiden, beides geht nicht. Coke oder Pepsi, Ford oder Chevy, Hertz oder Avis. Entweder oder.
Alejandro Casares zum Beispiel, Immobilieninvestor und Dealer in San Diego, hat sich für Coke entschieden, hat Gúero Méndez die Treue gehalten. Er wurde in seinem Auto gefunden, tot, an einem Feldweg bei San Ysidro. Und Billy Brennan, ein anderer Dealer aus San Diego, lag mit einer Kugel im Kopf in einem Motelzimmer von Pacific Beach.
Die amerikanischen Cops wunderten sich sehr, warum man beiden eine Pepsi-Dose in den Mund gestopft hatte.
Natürlich schlug Méndez zurück. Eric Mendoza und Salvador Marechal votierten beide für Pepsi - ihre verkohlten Leichen wurden in ihren rauchenden Autowracks gefunden, auf einem herrenlosen Grundstück in Chula Vista. Die Barreras zahlten mit gleicher Münze, und für ein paar Wochen wurde Chula Vista zum Sammelpunkt für brennende Autos mit verkohlten Leichen.
Doch die Barreras gaben damit zu verstehen: Das ist unser Hoheitsgebiet. Gúero versucht, es von Culiacán aus zu kontrollieren, aber wir sind hier. Wir sind vor Ort. Wir brauchen nur die Hand auszustrecken, um einen Treffer zu landen - in Baja oder in San Diego. Und wenn Gúero so stark ist, warum schlägt er uns nicht auf seinem eigenen Territorium, in Tijuana? Die Antwort ist leicht, meine Freunde - weil er es nicht kann. Er hockt in seinem Haus in Culiacán, und wenn ihr euch für ihn entscheidet, bitte schön. Er ist dort, und wir sind hier.
Gúeros Untätigkeit ist ein Zeichen der Schwäche, denn die Wahrheit ist, ihm schwimmen die Felle weg. Zwar hat er Sinaloa fest im Griff, aber Sinaloa, das Land, aus dem sie alle kommen, ist von der Welt abgeschnitten. Ohne Zugriff auf sein verlorenes Hoheitsgebiet muss Gúero an el Verde zahlen, damit er seine Ware über Sonora transportieren kann, oder an Abrego, damit er die Golfregion nutzen kann, und man darf darauf wetten, dass ihm die beiden alten Blutsauger für jedes Gramm Kokain einen kräftigen Anteil abzwacken.
Nein, Gúero ist so gut wie erledigt, und wenn er die Verwandten von Adán und Raúl abschlachtet, dann ist das wie das Zappeln des Fisches im Netz.
Heute ist Totentag, Adán und Raúl sind noch am Leben, und das muss gefeiert werden.
Genau das tun sie in ihrer neuen Disco in Puerto Vallarta.
Gúero Méndez pilgert heute zum Friedhof Jardines del Valle in Culiacán, zu einem anonymen Mausoleum mit Marmorsäulen, Basreliefs und einer mit Fresken verzierten Kuppel. Zwei kleine Engelchen. In den Särgen liegen seine Frau und seine Kinder. Ihre Farbfotos hängen verschlossen hinter Glas an der Wand.
Claudia und Gúerito.
Seine zwei angelitos.
Und Pilar.
Seine geliebte Frau.
Auf Abwege geraten, aber doch geliebt. Gúero bringt ihnen Totenopfer.
Scherenschnitte von Skeletten und Schädeln und kleinen Tieren für seine angelitos. Dazu Bonbons und Kekse in der Form von Totenköpfen, mit ihren Namen in Zuckerguss. Dann noch Spielzeug: Kleine Puppen für Claudia, kleine Soldaten für Gúerito.
Pilar hat er Blumen mitgebracht - die traditionellen Chrysanthemen, Ringelblumen und Brandschopf -, geflochten zu Kränzen und Kreuzen. Dazu ein Sarg aus Zuckerfäden und die kleinen Kekse mit Amaranth-Körnern, die sie so sehr gemocht hat.
Er kniet nieder und breitet seine Opfer aus, gießt frisches Wasser in drei Schalen, damit sie sich vor dem Festmahl die Hände waschen können. Draußen spielt eine kleine Kapelle fröhliche Weisen unter den wachsamen Blicken einer ganzen Staffel Sicarios. Gúero legt ein sauberes Handtuch neben jede Schale, baut einen Altar auf, arrangiert sorgfältig die Kerzen und die Schüsseln mit Reis und Bohnen, mit Hühnchen in mole-Sauce, kandiertem Kürbis und Yams. Dann zündet er ein Räucherstäbchen an und setzt sich auf den Boden.
Teilt sein Gedenken mit ihnen.
Die gemeinsamen Erinnerungen an Picknicks, an Badeausflüge zu Bergseen, an ausgelassene Spiele. Er spricht laut mit ihnen, hört ihre Antworten. Eine Musik, die süßer ist als die dort draußen.
Bald komme ich nach, verspricht er Frau und Kindern.
Noch nicht jetzt, aber bald.
Ich muss noch etwas erledigen.
Ich muss noch einen Tisch für die Barreras decken.
Und mit bitteren Früchten beladen.
Mit Totenköpfen aus Zucker, auf denen ihre Namen stehen: Miguel Angel, Raúl, Adán.
Und ihre Seelen zur Hölle schicken. Denn heute ist Totentag.
Die Disco La Sirena, denkt Adán, ist der Gipfel der Geschmacklosigkeit.
Raúl hat den ganzen Schuppen in eine Unterwasserwelt verwandelt. Eine groteske Neon-Nixe (La Sirena eben) lockt über dem Eingang, drinnen künstliche Korallenriffe und Unterwasserhöhlen.
Die linke Wand nimmt ein riesiges Aquarium mit fast zweitausend Litern Meerwasser ein. Allein die Glaswand hat eine atemberaubende Summe gekostet, findet Adán, ganz zu schweigen von den exotischen Fischen. Gelbe, blaue, purpurne Doktorfische zum Stückpreis von 200 Dollar, ein gepunkteter Igelfisch für 300 Dollar, ein 500 Dollar teurer Leopard-Drückerfisch mit zugegeben sehr hübscher gelb-schwarzer Zeichnung. Außerdem mussten es teure Korallen sein, und natürlich hat Raúl auf den abwegigsten Sorten bestanden: Gehirnkorallen, Pilzkorallen, Blumenkorallen und pulsierende Weichkorallen, die in die Höhe greifen wie die Hände eines ertrunkenen Matrosen. Dann »lebende Steine« mit Algen, die in der Beleuchtung purpurn glühen. Schwarzweiß getüpfelte und gestreifte Muränen recken ihre Köpfe aus Felslöchern, Krabben hangeln sich von Stein zu Stein, Garnelen wogen in der elektrisch erzeugten Strömung.
Auf der rechten Seite dagegen plätschert ein echter Wasserfall. (»Das ist doch Schwachsinn«, hat Adán gemeint, als der Wasserfall eingebaut wurde. »Ein Wasserfall unter Wasser?«
»Ich will eben einen, und basta«, hat Raúl erwidert. Dann ist ja alles klar, dachte sich Adán. Er hat ihn eben gewollt.) Und hinter dem Wasserfall versteckt sich eine Grotte mit flachen Felsen, die als Ruhebetten für Pärchen dienen, und Adán ist nur froh, dass die Grotte regelmäßig vom Wasserfall durchgespült wird - aus hygienischen Gründen.
Die rostigen Blechtische des Clubs sind mit Perlmutt aus Meeresmuscheln besetzt, der Tanzboden hat die Farbe von Meeresgrund, und die teure Beleuchtung erzeugt einen blauen Flimmereffekt, als würde alles unter Wasser stattfinden.
Der Spaß hat ein Vermögen gekostet.
»Mach nur«, hat Adán zu Raúl gesagt. »Aber sieh zu, dass der Laden auch Geld bringt.«
»Die anderen laufen doch auch«, hat Raúl geantwortet.
Und da muss ihm Adán zustimmen, bei allem, was recht ist.
Rauls Geschmack mag abscheulich sein, aber er hat ein Händchen für trendige Nachtclubs und Restaurants, die sich rentieren, sogar Gewinn abwerfen und äußerst praktisch für das Waschen der Narco-Dollars sind, die jetzt wie ein großer grüner Strom von Norden geflossen kommen. Die Disco ist rappelvoll.
Nicht nur weil heute Totentag ist. La Sirena ist einfach der Hit, selbst in diesem Seebad mit seinen vielen anderen Discos. Und während der alljährlichen Sauforgie, wenn in Amerika Frühjahrsferien sind, drängen sich hier die College-Kids und geben noch mehr (saubere) Dollars aus.
Aber heute sind fast nur Mexikaner da, genauer gesagt Freunde und Geschäftspartner der Barrera-Brüder, um mit ihnen zu feiern. Ein paar amerikanische Touristen haben sich hierher verirrt, auch eine Handvoll Europäer, aber dagegen ist nichts zu sagen. Heute werden hier keine Geschäfte durchgezogen und auch sonst nicht - überhaupt gilt das ungeschriebene Gesetz, dass die legalen Geschäftsfelder in den Seebädern für alle Drogengeschäfte tabu sind. Keine Drogendeals, keine Konferenzen und vor allem keine Gewalt. Der Tourismus ist der größte Devisenbringer des Landes, gleich nach dem Drogenhandel, also wird niemand so dumm sein, die Amerikaner, Briten, Deutschen und Japaner zu vergraulen, die hier in Mazatlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas und Cozumel mit Dollars, Pfunden, Mark und Yen um sich werfen.
Alle Kartelle betreiben ihre eigenen Nachtclubs, Restaurants, Discos und Hotels in diesen Badeorten, also haben sie Interessen zu wahren, und die wären schlecht gewahrt, wenn ein Tourist von einer verirrten Kugel getroffen würde. Niemand ist hier an blutigen Schießereien interessiert, an Leichen, die in den Straßen liegen. Also haben die Kartelle und die Regierung eine sehr vernünftige Übereinkunft getroffen, und die lautet: Tragt eure Fehden woanders aus. Hier wird so viel Geld gemacht, dass ihr dabei nur stört.
Ihr dürft euch hier austoben, aber immer schön friedlich bleiben.
Und sie toben sich wirklich aus, denkt Adán, der Fabián Martínez gerade mit drei, vier deutschen Blondinen tanzen sieht.
Es ist auch verdammt anstrengend, das Geschäft im Griff zu behalten. Den unablässigen Kreislauf. Der Ware, die nach Norden fließt, des Geldes, das nach Süden fließt. Da sind die ständigen Absprachen mit den Orejuelas, dann der Kokaintransport von Kolumbien nach Mexiko, dann die immer neue Herausforderung, es über die Grenze in die USA zu schmuggeln, in Crack umzuwandeln und an die Dealer zu verkaufen, das Geld einzusammeln, nach Mexiko zu schaffen und zu waschen.
Manches von dem Geld geht fürs Feiern drauf, aber eine Menge wird zum Schmieren gebraucht.
Silber oder Blei. Plata o plomo.
Einer von den Barrera-Leuten geht mit einer Tasche voll Geld zum örtlichen Comandante der Polizei oder Armee und stellt ihn mit einfachen Worten vor die Wahl: »Plata o plomo?«
Mehr ist nicht nötig. Die Bedeutung ist klar - du wirst reich, oder du stirbst. Die Entscheidung liegt bei dir.
Wenn sie sich für den Reichtum entscheiden, geht die Sache an Adán. Entscheiden sie sich für den Tod, geht die Sache an Raúl.
Die meisten entscheiden sich für den Reichtum.
Nicht nur das, denkt Adán, diese Kerle planen das Geld regelrecht ein. Schließlich mussten sie sich auch bei ihren Vorgesetzten einkaufen, oder sie zahlen einen monatlichen Anteil von ihrer mordida. Das ist wie ein Franchise-Unternehmen. Burger King, Taco Bell, McBribes. Das schnelle Geld. Geld für nichts. Nur wegschauen, zufällig woanders sein, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, und der monatliche Geldsegen kommt - pünktlich und steuerfrei.
Und der Krieg, denkt Adán, während er den Tanzenden im blauen Flackerlicht zuschaut, bringt den Staatsdienern weitere Vorteile. Méndez bezahlt seine Polizisten, damit sie unsere Transporte hochgehen lassen, wir bezahlen unsere Polizisten, damit sie Gúeros Transporte hochgehen lassen. Das ist ein guter Deal für alle, bis auf den, der seine Ware verliert. Sagen wir, die Polizei von Baja beschlagnahmt Kokain von Méndez im Wert von einer Million Dollar. Wir zahlen ihnen hunderttausend Dollar »Finderlohn«, sie werden in der Presse als Helden gefeiert und stehen bei den Yankees als gute Jungs da, und nach einer Anstandspause verkaufen sie uns das Zeug, das eine Million wert ist, für fünfhunderttausend Dollar.
Eine echte Win-Win-Situation.
Und das ist nur das, was in Mexiko läuft.
Auch die US-Zöllner müssen dafür bezahlt werden, dass sie wegschauen, wenn Autos voller Coke oder Gras oder Heroin ihren Kontrollpunkt passieren - dreißigtausend kostet das pro Ladung, egal was drinsteckt, und trotzdem gibt es keine Garantie, dass der Transport durchkommt, selbst wenn man Wohnungen direkt an den Kontrollpunkten kauft und dort einen Mann mit Feldstecher und mit Funkkontakt zu den Fahrern hinsetzt, damit sie zu den »richtigen« Warteschlangen dirigiert werden können. Da die Zöllner oft und überraschend ausgewechselt und die Funkfrequenzen abgehört werden, muss man damit rechnen, dass von den zwölf Autos, die man über den Grenzübergang San Ysidro oder Otay Mesa schickt, nur acht oder neun durchkommen.
Geschmiert werden müssen auch die Cops in San Diego, San Francisco, San Bernardino und so weiter. Genauso die Bundespolizei, die Sheriffs. Dann die Beamten und Schreibkräfte in der DEA, die einem stecken können, welche Ermittlungen gerade laufen und welche Technik eingesetzt wird. Manchmal, aber sehr selten, kriegt man auch einen DEA-Agenten auf die Gehaltsliste, aber die sind äußerst dünn gesät, denn zwischen der DEA und den mexikanischen Kartellen herrscht so etwas wie eine Blutfehde, immer noch - wegen der Sache mit Ernie Hidalgo.
Dafür sorgt Art Keller.
Und das ist gut so, denkt Adán. Denn während mich Kellers Racheeifer kurzfristig Geld kosten mag, ist er auf lange Sicht ein Geldbringer. Das ist etwas, was die Yankees einfach nicht sehen oder kapieren - dass sie den Preis hochtreiben und uns reich machen. Ohne diese Vollidioten könnte jeder Trottel Drogen in die USA schmuggeln. Mit einem alten Laster oder einem lecken Kahn. Doch dann würde der Preis so tief sinken, dass er die Mühe nicht mehr wert wäre. Aber so, wie die Dinge stehen, kostet es Millionen, die Ware zu bewegen, und folglich sind die Preise astronomisch. Die Amerikaner kaufen Drogen, die buchstäblich auf den Bäumen wachsen, und verwandeln sie in wertvolles Kapital. Ohne sie wären Kokain und Marihuana nicht teurer als Orangen, und statt Millionen mit Schmuggel zu verdienen, müsste ich mich für ein paar Cents als Arbeitssklave auf den kalifornischen Feldern verdingen.
Und der eigentliche Witz an der Sache: Sogar Art Keller ist eine Ware für mich, denn ich verdiene Millionen damit, dass ich meinen freien Partnern, die ihre Ware über meine Schmuggelrouten transportieren wollen, Schutzmaßnahmen verkaufe, dass ich ihnen Tausende von Dollars abknöpfe für den Schutz durch die von uns gekauften Polizisten, Soldaten, Zöllner, Küstenwachen, für Überwachungs- und Kommunikationstechnik ... Das ist etwas, was den mexikanischen Polizisten gefällt, den amerikanischen aber nicht. Wir sind Partner, mein lieber Art Keller, wir ziehen an einem Strang.
Wir sind Kombattanten im Drogenkrieg.
Wir brauchen einander, sonst würden wir gar nicht existieren.
Adán beobachtet zwei nordisch aussehende Mädchen, die sich an den Wasserfall stellen und ihre T-Shirts nass machen, damit ihre Brüste sichtbar werden - für alle und jeden. Und Bewunderer haben sie die Menge. Die Disco-Musik hämmert, es wird hektisch getanzt und hektisch getrunken. Heute ist Totentag, die meisten hier sind alte Freunde aus Culiacán oder Badiraguato, und wer ein Narco aus Sinaloa ist, hat vieler Toter zu gedenken.
So manches Gespenst tanzt auf dieser Party.
Dieser Krieg fordert seinen Tribut.
Aber, denkt Adán, bald ist er vorbei, dann konzentrieren wir uns wieder aufs Geschäft.
Er kann es kaum erwarten, denn er hat das Drogengeschäft neu erfunden.
Von jeher sind die mexikanischen Kartelle gebaut wie Pyramiden. Wie bei der sizilianischen Mafia gibt es den Boss, dann die Capos, dann die Soldaten, und jede Ebene »liefert« an die nächsthöhere. Die Unteren verdienen kaum etwas, wenn sie nicht noch eine Ebene unter sich aufbauen können, die an sie liefern muss. Und jeder, der kein Volltrottel ist, kennt das Problem einer solchen Pyramide. Wer oben ist, sahnt ab, wer unten ist, guckt in die Röhre. Wenn die Pyramide überhaupt etwas bewirkt, so Adán, dann den Wunsch, auszusteigen und eine eigene Pyramide zu starten.
Außerdem ist die Pyramide viel zu anfällig für Polizeimaßnahmen. Man muss sich nur ansehen, denkt Adán, was mit der amerikanischen Mafia passiert ist. Schon ein kleiner Zuträger, ein unzufriedener Soldat am unteren Ende kann der Polizei die ganze Struktur der Pyramide zu Füßen legen. Alle Bosse der fünf New Yorker Familien sitzen jetzt im Gefängnis, und ihre Familien sind unausweichlich dem Untergang geweiht.
Daher hat Adán die Pyramide durch eine horizontale Struktur ersetzt. Sagen wir, fast horizontal. Seine neue Organisation hat nur zwei Ebenen: oben die Barrera-Brüder, unten alle anderen.
Aber auf derselben Ebene.
»Wir wollen Unternehmer, keine Angestellten«, hat Adán zu Raúl gesagt. »Angestellte kosten, Unternehmer verdienen.«
Mit der neuen Struktur haben sie sich einen großen Pool aus hochmotivierten, reich belohnten, eigenständigen Geschäftsleuten geschaffen, die zwölf Prozent ihres Gewinns an die Barreras abführen, und das mit Kusshand. Es gibt nur eine obere Ebene, an die sie liefern müssen, sie ziehen ihr eigenes Geschäft durch, auf eigenes Risiko, und kassieren ihr eigenes Geld.
Und Adán achtet darauf, dass es sich für sie lohnt. Auf dieses Prinzip hat er sein Baja-Kartell aufgebaut: Er duldet nicht nur, dass seine Leute ihre eigenen Geschäfte aufziehen, nein, er ermutigt sie sogar dazu, indem er ihre »Steuern« auf zwölf Prozent senkt, ihnen günstig verzinstes Startkapital zur Verfügung stellt, ihnen finanzielle Dienstleistungen anbietet - zum Beispiel Geldwäsche - und als Gegenleistung nichts weiter fordert als Treue zum Kartell.
»Zwölf Prozent von vielen«, hat er Raúl erklärt, als er ihm die drastische Steuersenkung vorschlug, »ist mehr als dreißig Prozent von wenigen.« Vorbild war ihm Reagans Steuer-Revolution. Sie konnten mehr Geld kassieren, wenn sie die Steuern senkten, statt sie anzuheben, weil gesenkte Steuern mehr Unternehmer befähigen, ins Geschäft einzusteigen, mehr Geld zu machen und mehr Steuern zu zahlen.
Raúl ist der Meinung, dass der Krieg gegen Méndez mit Blei zu gewinnen ist und nicht mit einem neuen Geschäftsmodell, und wenn man die Dinge so eng sieht wie er, hat er recht. Aber Adán setzt lieber auf die Macht der Ökonomie. Man kann Coke mit dreißig Prozent Gewinn verkaufen oder Pepsi mit zwanzig Prozent. Jeder hat die Wahl. Und die Wahl ist einfach. Man verkauft Pepsi und verdient viel Geld, oder man verkauft Coke und verdient wenig Geld - bis man von Raúl erschossen wird. Und plötzlich wollen alle nur noch Pepsi verkaufen. Man muss schon ein Trottel sein, wenn man das bleierne Coke über die silberne Pepsi stellt.
Silber oder Blei.
Das Yin und Yang des neuen Baja-Kartells.
Hast du mit Adán zu tun, bedeutet das Silber, hast du mit Raúl zu tun, bedeutet das Blei. Ein Geschäftsprinzip, bei dem Gúero Méndez den Kürzeren zog. Er war einfach zu schwerfällig, um mitzuziehen, und als er sich besann, konnte er seine Preise nicht mehr senken, denn die Baja-Region wurde von den Barreras beherrscht, und er musste dreißig Prozent Aufschlag bezahlen, um seine Ware über Sonora oder den Golf in die USA zu schmuggeln.
Nein, das musste auch Raúl eingestehen, der Zwölf-Prozent-Deal war kein Fehler, sondern ein genialer Schachzug.
Und genau das Richtige für Fabián Martínez und seine jungen Freunde.
Die Regeln sind einfach.
Du meldest den Barreras, wenn du Ware durchbringen willst (Kokain, Marihuana oder Heroin), wie viel Kilo es sind und wie hoch der vereinbarte Verkaufspreis ist - meist zwischen 14000 und 16000 Dollar pro Kilo Kokain - und an welchem Tag du die Ware beim amerikanischen Abnehmer abliefern willst. Danach hast du achtundvierzig Stunden Zeit, den Barreras zwölf Prozent des vereinbarten Verkaufspreises zu zahlen. (Der vereinbarte Preis ist nur eine Basisgarantie - wenn du für weniger verkaufst, musst du trotzdem den Anteil für den vereinbarten Preis bezahlen, wenn du einen höheren Preis bekommst, schuldest du den Barreras auch einen höheren Anteil.) Wenn du es nicht schaffst, binnen zwei Tagen mit dem Geld rüberzukommen, solltest du schleunigst mit Adán reden und eine Vereinbarung treffen, oder du kriegst es mit Raúl zu tun, und ... Silber oder Blei.
Für die zwölf Prozent bekommst du nur die Erlaubnis, deine Ware durch das Hoheitsgebiet der Barreras zu transportieren. Wenn du gute Beziehungen zur Polizei, zu den Federales oder zur Armee aufbaust, um den Transport abzusichern, ist das deine Sache. Fliegt der Transport auf, musst du aber trotzdem deine zwölf Prozent zahlen. Wenn du willst, übernehmen die Barreras die Absicherung für dich, aber das kostet extra - den Preis des Schmiergelds plus Verhandlungsgebühr. Dafür ist deine Ware auf der mexikanischen Seite sicher. Wird sie beschlagnahmt, entschädigen dich die Barreras mit dem gesamten Kaufpreis, den du bezahlt hast. Handelt es sich um Kokain, zahlen sie dir also den Preis, den du mit dem Orejuela-Kartell in Cali ausgehandelt hast, nicht den Preis, den du in den USA erzielen wolltest. Und wenn du das Sicherheitspaket der Barreras kaufst, garantieren sie hundertprozentig für deine Lieferung in ihrem Hoheitsgebiet - bis zur Grenze. Kein anderer Drogenschieber wird sie dir abjagen, kein Bandit wird versuchen, sie zu entführen. Dafür sorgen Raúl und seine Sicarios - man muss schon lebensmüde sein, wenn man sich an einer Lieferung vergreift, für deren Sicherheit die Barrera-Brüder garantiert haben.
Auch Finanzdienstleistungen sind im Angebot. Adán will es möglichst vielen möglichst leicht machen, ins Geschäft einzusteigen, indem er die zwölf Prozent niemals im Voraus verlangt. Sie werden erst fällig, wenn die Ware verkauft ist. Aber die Barreras gehen noch einen Schritt weiter. Sie helfen dir bei der Geldwäsche, wenn du die Ware verkauft hast, und dieses Angebot erweist sich als zunehmend profitabel für die Barreras. Der gängige Preis für Geldwäsche liegt bei 6,5 Prozent, aber bestochene Bankiers räumen Adán Mengenrabatt ein, so dass er nur fünf Prozent bezahlt und an jedem Dollar seiner Klienten noch einmal 1,5 Prozent verdient. Natürlich musst du dein Geld nicht von den Barreras waschen lassen, du bist ein selbständiger Geschäftsmann, du kannst machen, was du für richtig hältst. Aber wenn du es woanders versuchst und du beraubt oder betrogen wirst, oder dein Geld wird vom US-Zoll beschlagnahmt, dann ist es dein eigenes Pech, während die Barreras dir für dein Geld garantieren. Was immer du an schmutzigem Geld bei ihnen ablieferst, du kriegst es sauber zurück, innerhalb von drei Werktagen, minus 6,5 Prozent.
Und das ist Adáns »Revolution«. Das Drogengeschäft hält Schritt mit der Entwicklung.
Oder wie hat es ein narcotraficante formuliert? »Miguel Angel Barreras hat uns ins 20. Jahrhundert geführt. Adán führt uns ins 21. Jahrhundert.«
Und ganz nebenbei erledigen wir auch Gúero Méndez, denkt Adán. Wenn er seine Ware nicht bewegt, kann er keine mordida zahlen. Wenn er keine mordida zahlt, kann er seine Ware nicht bewegen. Währenddessen bauen wir ein Netzwerk auf, das schnell, effizient und profitabel ist, indem wir uns auf modernste Technik und modernste Finanzierungsmodelle stützen.
Das Leben meint es gut mit uns, denkt Adán am Totentag.
Totentag? Na großartig, denkt Callan. Als wäre nicht jeder Tag ein Totentag.
Er steht an der Bar von La Sirena und kippt ein paar Drinks. Wenn du was erleben willst, denkt er, versuch mal, in einer mexikanischen Strandbar einen strammen Whiskey zu bestellen. Sag dem Typ, du willst einen richtigen Drink, ohne den beknackten Regenschirm drin, und der guckt dich an, als hättest du ihm die Brille weggenommen.
Wollen wir doch mal sehen, denkt Callan. »Hey, Alter, regnet's hier drinnen?«
»Nein.«
»Wozu brauch ich dann das hier?«
Und wenn ich Saft will, Amigo, bestelle ich Saft. Der einzige Saft, den ich trinke, ist aus Gerste gemacht. Das irische Vitamin C. Das Wasser des Lebens.
Sehr komisch. Besonders, wenn ich bedenke, wovon ich lebe, überwiegend jedenfalls.
Davon, andere Leute über Bord gehen zu lassen. Sorry, Sir, Sie müssen jetzt aussteigen. Ja, aber -
Kein aber. Ab geht die Post.
Jetzt nicht mehr für den Cimino-Clan, aber Sal Scachi führt mir noch die Hand, wenn man so sagen kann.
Callan wollte ganz gemütlich in Costa Rica abwarten, bis sich in New York die Wogen glätteten, da kam auf einmal Scachi zu Besuch.
»Was hältst du davon, nach Kolumbien zu fahren?«, fragte er Callan.
»Was soll ich da?«
»Bei einer Truppe mitmachen, die MAS heißt.«
Muerte a Secuestadores - Tod den Entführern. Scachi erklärt ihm, dass es die MAS seit 1981 gibt, als die linke Guerillatruppe M-19 die Schwester des kolumbianischen Drogenbarons Fabián Ochoa entführte und Lösegeld kassieren wollte.
Tolles Geschäftsmodell, dachte Callan.
Und die haben geglaubt, dass Ochoa für seine Schwester zahlt?
Aber statt zu zahlen, so Scachi, trommelte Ochoa ein paar hundert Geschäftspartner zusammen und holte sich von jedem zwanzigtausend Dollar in bar und zehn ihrer besten Leute. Grob gerechnet war das also eine Kriegskasse von viereinhalb Millionen und eine Armee von zweitausend Killern.
»Das musst du dir mal vorstellen«, sagte Scachi. »Die Jungs warfen Flugblätter über einem Fußballstadion ab, auf denen sie ankündigten, was sie vorhatten.« Und dann auch taten.
Nämlich in Cali und Medellin zu hausen wie tollwütige Hunde, Häuser zu stürmen, Studenten aus den Vorlesungen zu holen und zu erschießen, andere zu verschleppen und zu »verhören«.
Ochoas Schwester wurde unversehrt zurückgegeben.
»Und wozu erzählst du mir das?«, fragte Callan.
Scachi klärte ihn auf. 1985 hat die kolumbianische Regierung einen Waffenstillstand mit den verschiedenen linken Gruppen geschlossen. Die haben sich darauf zur Unión Patriótica vereint und bei den Wahlen von 1986 vierzehn Parlamentssitze erobert.
»Okay«, sagte Callan.
»Überhaupt nicht okay«, erwiderte Scachi. »Diese Leute sind Kommunisten, Sean!«
Darauf ließ Scachi eine Tirade los, die im Kern besagte: Wir haben die Kommunisten bekämpft, um den Leuten die Demokratie zu bringen, doch diese undankbaren Arschlöcher benutzen die Demokratie, um die Kommunisten zu wählen. Damit will er sagen, dachte Callan, dass die Leute Demokratie bekommen sollen, aber nicht zu viel davon.
Sie haben die absolute Freiheit, so zu wählen, wie wir es wollen.
»Die MAS wird dagegen vorgehen«, sagte Scachi. »Sie brauchen einen Mann mit deinen Fähigkeiten.«
Mag ja sein, dachte Callan, aber sie kriegen keinen Mann mit meinen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, was Scachi mit dieser MAS am Hut hat, aber mir geht die Sache am Arsch vorbei.
»Ich glaube, ich gehe zurück nach New York«, sagte Callan. Schließlich hatte Johnny Boy den Clan fest im Griff, und Johnny Boy hatte keinen Grund, Callan seinen Schutz und seine Fürsorge zu verweigern.
»Klar, kannst du machen«, sagte Scachi. »Nur dass da ungefähr dreitausend Haftbefehle auf dich warten.«
»Für was?«
»Für was? Kokainhandel, Schutzgelderpressung, organisierte Kriminalität. Wie ich höre, wollen sie dich auch wegen der Sache mit Big Paulie drankriegen.«
»Du meinst, sie wollen dich wegen der Sache mit Big Paulie drankriegen.«
»Was willst du damit sagen?«
»Dass du mich beauftragt hast.«
»Hör zu, ich krieg das für dich geregelt«, sagte Scachi, »aber es kann nicht schaden, wenn du uns in dieser Sache hilfst.«
Callan wunderte sich, wieso Scachi das für ihn regeln wollte, wenn er sich bereitfand, für einen Haufen antikommunistischer Drogenbosse in den Krieg zu ziehen, aber er stellte keine Fragen, weil er die Antwort lieber nicht wissen wollte. Er nahm das Flugticket, den neuen Pass und meldete sich in Medellin zum Einsatz für die MAS.
Tod den Entführern, das hieß jetzt Tod den siegreichen Kandidaten der Unión Patriótica. Sechs von ihnen kriegten einen Kopfschuss statt einen Sitz im Parlament. (Jeden Tag ist Totentag, denkt Callan, während er jetzt in La Sirena an seinem Drink hängt.)
Danach ging es erst richtig los, erinnert er sich. Zur Vergeltung besetzte die Guerilla M-19 den Justizpalast, und über hundert Menschen, darunter etliche Richter, starben bei der missglückten Rückeroberung des Gebäudes. So kommt das eben, denkt Callan, wenn man Polizisten und Soldaten einsetzt, statt sich Profis zu holen.
Das haben sie allerdings beherzigt, als sie den Führer der Union Patriótica beseitigten. Callan war es nicht, der ihn erschoss, aber er gab dem Mann, der Jaime Pardo Leal umlegte, Feuerschutz. Es war ein guter Treffer - sauber, effizient, professionell.
Doch das war nur der Anfang, wie sich bald herausstellte. Das richtige Morden begann 1988.
Und das Geld kam größtenteils vom Boss selbst - von Pablo Escobar, dem Oberhaupt des Medellin-Kartells.
Anfangs konnte Callan nicht verstehen, wieso sich Escobar und seine Drogenbarone überhaupt für Politik interessierten. Aber dann begriff er, dass die Jungs vom Kartell eine Menge von ihrem Drogengeld in Landkäufe gesteckt hatten, in riesige Rinderfarmen, die sie sich nicht von irgendwelchen linken Landreformern kaputtmachen lassen wollten.
Eine dieser Farmen lernte Callan gründlich kennen.
Im Frühjahr 1987 schickte ihn die MAS nach Las Tangas, einer großen Finca der Brüder Carlos und Fidel Cardona. Ihr Vater war einst, als sie noch Teenager waren, von kommunistischen Guerillas entführt und ermordet worden. Du kannst so viel über Politik reden, wie du willst, dachte Callan, als er die beiden kennenlernte, am Ende stecken immer private Geschichten dahinter.
Las Tangas war weniger eine Finca als ein Militärlager. Callan sah zwar auch ein paar Rinder, aber was er vor allem sah, waren Killer wie er selbst.
Viele waren Kolumbianer, ausgeliehen vom Kartell, aber es gab auch Südafrikaner und Rhodesier, die ihren eigenen Krieg verloren hatten und nun wenigstens diesen hier gewinnen wollten. Dann waren da Israelis, Libanesen, Russen, Iren, Kubaner. Ein ganzes olympisches Dorf für mordlüsterne Ganoven.
Und hart trainiert wurde auch.
Ein Typ, angeblich israelischer Oberst, kam mit einer Bande Briten, alle ehemalige SASler, wie sie zumindest behaupteten. Als guter Ire hasste Callan die Briten und den SAS, aber er musste zugeben, dass diese Tommys wussten, was sie taten.
Mit der 22er war er immer gut zurechtgekommen, doch für diesen Job war mehr vonnöten, und bald hatte er Ausbildung an der M16, der Kalaschnikow, der M6o-Maschinenpistole und dem 90er Scharfschützengewehr von Barrett.
Auch im Nahkampf wurde er trainiert - Töten mit Messer, mit Würgschlinge, mit Händen und mit Füßen. Manche von den Ausbildern waren bei den Special Forces der US-Army gewesen, auch Vietnam-Veteranen waren dabei - Operation Phoenix. Und viele der kolumbianischen Offiziere sprachen englisch, als kämen sie aus Mayberry, USA.
Callan konnte sich jedes Mal ausschütten, wenn einer dieser höheren Offiziere den Mund aufmachte und redete wie ein Südstaatler. Dann kam er dahinter, dass die meisten ihre Ausbildung in Fort Benning, Georgia, bekommen hatten.
In irgendeiner »School of the Americas«.
Ich möchte nicht, wissen, was die da lernen, dachte Callan. Lesen, schreiben, massakrieren. Und dazu etliche widerwärtige Tricks, die sie eifrig an die Tangueros weitergaben - so hießen die Söldner hier.
Auch eine Menge OJT gab es, On-the-Job-Training, und das ging so: Die Gruppe Tangueros wurde losgeschickt, um einen Guerillatrupp aufzureiben. Ein Armeeoffizier hatte Fotos von den sechs Zielpersonen geliefert, die wie normale Campesinos in ihren Dörfern wohnten, wenn sie nicht gerade Guerilla spielten.
Fidel Cardona persönlich führte den Einsatz. Cardona hatte eine leichte Macke, nannte sich »Rambo« und lief auch so rum wie der Typ im Film. Jedenfalls fuhren sie los und legten einen Hinterhalt auf einer Straße, die von den Guerillas benutzt wurde.
Die Tangueros bildeten eine perfekte U-Formation, genau, wie sie es gelernt hatten. Callan passte das gar nicht, im Gebüsch zu liegen, Tarnklamotten zu tragen und in der Hitze vor sich hin zu schmoren. Ich bin ein Stadtmensch, dachte er. Was hab ich in dieser bekloppten Armee zu suchen?
Genauer gesagt, er war nervös. Angst war es nicht, eher eine gewisse Unruhe, weil er nicht wusste, was ihn erwartete. Mit Guerillas hatte er sich bisher noch nicht angelegt. Die sind wahrscheinlich ziemlich clever, dachte er, gut ausgebildet, kennen ihr Terrain und wissen es zu nutzen.
Die Guerillas tappten ahnungslos in das offene U hinein.
Callan hatte eiskalte Killer erwartet, mit Tarnzeug und Kalaschnikows. Doch die sahen aus wie Bauern, trugen alte Hemden, kurze Campesino-Hosen und bewegten sich auch nicht wie Soldaten - absichernd und wachsam. Liefen einfach so die Straße lang.
Callan richtete das Galil-Gewehr auf den Mann ganz links.
Zielte ein bisschen tiefer, auf den Bauch, falls das Gewehr hochriss. Außerdem wollte er dem Mann nicht ins Gesicht sehen. Der hatte so ein Kindergesicht, lachte und redete mit den anderen, wie eben einer mit seinen Kumpels redet, wenn die Arbeit vorüber ist. Also konzentrierte sich Callan auf das Blau seines Hemds, das war wie Zielschießen, als würde er nur auf dieses Ding schießen.
Er wartete, dass Fidel den Startschuss gab, dann drückte er zweimal ab.
Der Mann ging zu Boden. Die anderen auch.
Die armen Schweine hatten nichts geahnt, wussten nicht, wie ihnen geschah. Nur eine Feuersalve aus den Büschen am Straßenrand, und sechs Guerillas lagen tot in ihrem Blut.
Sie hatten nicht mal Zeit, ihre Waffen zu ziehen.
Callan gab sich einen Ruck und ging zu dem Mann, den er erschossen hatte. Der Mann war tot, lag auf dem Bauch. Callan rollte ihn mit dem Fuß auf den Rücken. Sie hatten strikte Order, alle Waffen sicherzustellen - nur dass Callan keine Waffe fand. Alles, was der Mann bei sich hatte, war eine Machete, wie man sie zur Bananenernte braucht.
Auch die anderen Guerillas hatten keine Waffen, wie Callan jetzt sah.
Fidel störte sich nicht daran. Er ging herum, schoss den Toten zur Sicherheit in den Hinterkopf, dann setzte er einen Funkspruch nach Las Tangas ab. Kurze Zeit später kam ein Lkw mit einem Haufen Klamotten, wie sie von den kommunistischen Guerillas getragen wurden, und Fidel befahl seinen Männern, die Toten in die neuen Sachen zu kleiden.
»Ich glaube, ich spinne«, sagte Callan. »Soll das ein Scherz sein?«
Aber Rambo machte keine Scherze. Rambo befahl ihm, seinen Arsch in Bewegung zu setzen.
Callan setzte sich an den Straßenrand. »Ich bin doch kein Leichenwäscher«, sagte er zu Fidel. Saß da und guckte zu, wie die anderen Tangueros die Leichen umzogen und dann Fotos von den toten »Guerillas« machten.
Und auf dem ganzen Rückweg musste er sich das Geschimpfe von Fidel anhören. »Ich weiß, was ich tue!«, schnauzte Fidel. »Ich war auf der Schule!«
»Ich auch«, erwiderte ihm Callan. »Meine Schule hieß Hell's Kitchen. Und weißt du was, Rambo? Die Kerle, die ich dort umgelegt habe, die hatten normalerweise eine Kanone in der Hand.«
Rambo musste sich bei Scachi über ihn beschwert haben, denn ein paar Wochen später tauchte Scachi auf der Ranch auf, um ein »Beratungsgespräch« mit Callan zu führen.
»Wo ist dein Problem?« fragte ihn Scachi.
»Mein Problem ist, dass ich hier simple Bauern erschießen muss«, sagte er. »Die waren unbewaffnet, Sal!«
»Wir drehen doch hier keinen Western«, antwortete Sal. »Einen >Ehrenkodex< gibt's hier nicht. Willst du warten, bis sie mit der Kalaschnikow kommen? Willst du Opfer in Kauf nehmen? Das hier ist ein verdammter Krieg, Sparky!«
»Ja, das merke ich auch.«
»Du wirst doch bezahlt, oder?«, fragt ihn Scachi. Klar, denkt Callan. Ich werde bezahlt. Der Adler kräht zweimal im Monat, in Cash. »Und sie behandeln dich gut, oder?«
Sie behandeln uns wie Könige, muss Callan zugeben. Jeden Abend Steak, wer Lust hat. Bier und Whisky umsonst, Kokain auch, wenn das dein Ding ist. Ab und zu zieht sich Callan ein bisschen was rein, aber ein ordentlicher Drink ist ihm lieber. Viele Tangueros schnupfen das Zeug in Mengen, holen sich dann die Huren, die an den Wochenenden angekarrt werden, und vögeln die ganze Nacht.
Ein paarmal ist Callan auch zu den Huren gegangen. Ein Mann hat Bedürfnisse, aber das war es auch schon, die Befriedigung einer Notdurft. Das waren keine Spitzenkräfte wie im Weißen Haus, sondern meist Indiofrauen von den Ölfeldern im Westen. Nicht mal richtige Frauen, wenn er ehrlich sein sollte. Meist nur Mädchen in billigen Kleidern und mit dicker Schminke.
Beim ersten Mal fühlte er sich hinterher eher traurig als erleichtert. Er war in den Verschlag hinter der Kaserne gegangen, kahle Sperrholzwände und ein Bett mit blanker Matratze. Sie versuchte, ihn aufzugeilen, Sachen zu sagen, die er vielleicht hören wollte, bis es ihm reichte und er sie bat, einfach die Klappe zu halten und zu ficken.
Hinterher lag er da und dachte an die blonde Frau in San Diego -
Nora hatte sie geheißen. Und schön war sie gewesen.
Aber das war in einem anderen Leben, in einer anderen Welt.
Nachdem ihn Scachi auf Vordermann gebracht hatte, berappelte sich Callan und nahm an mehr Einsätzen teil. An einem Flussufer machten die Tangueros sechs weitere unbewaffnete »Guerillas« kalt, dann noch eine Gruppe direkt auf dem Marktplatz eines Ortes.
Fidel hatte ein Wort für die Einsätze.
Limpieza nannte er sie.
Säuberung.
Sie säuberten die Gegend von Guerillas, Kommunisten, Arbeiterführern, Agitatoren - all dem Gesocks. Wie Callan mitkriegte, waren sie nicht die Einzigen, die das machten. Es gab eine Menge andere Gruppen, andere Fincas, andere Ausbildungslager, überall im Land. All diese Gruppen hatten Namen - Muerte a Revolucionarios, ALFA 13, Los Tinados. Innerhalb von zwei Jahren ermordeten sie über dreitausend Linke. Die meisten Morde fanden in entlegenen Dörfern statt, besonders in den Hochburgen des Medellin-Kartells im Tal des Rio Magdalena, wo die männliche Bevölkerung ganzer Dörfer zusammengetrieben und niedergemäht wurde. Oder mit Macheten in Stücke gehauen, wenn ihnen die Munition zu schade war.
Außer den Kommunisten wurden noch eine Menge andere Leute weggesäubert - Straßenkinder, Homosexuelle, Drogensüchtige, Trinker.
Eines Tages rückten die Tangueros aus, um Guerillas zu erledigen, die zwischen zwei Operationsbasen unterwegs waren. Callan und die anderen warteten am Straßenrand auf den Überlandbus, stoppten ihn und holten alle raus, bis auf den Fahrer. Fidel ging die Passagiere durch, verglich ihre Gesichter mit Fotos, die er in der Hand hielt, dann sonderte er fünf Männer aus und ließ sie in den Graben führen.
Callan sah, wie die Männer auf die Knie sanken und zu beten anfingen.
Sie kamen nicht viel weiter als »Nuestro Padre ...«. Ein Trupp Tangueros durchsiebte sie mit Kugeln. Callan wandte sich ab - und sah, wie zwei seiner Kameraden den Busfahrer ans Lenkrad ketteten.
»Was zum Teufel soll das?«, brüllte er.
Mit einem Schlauch saugten sie Benzin aus dem Tank in eine Plastikflasche und schütteten sie über dem Fahrer aus, der um Gnade schrie, während sich Fidel an die Passagiere wandte und ihnen erklärte: »So geht es Leuten, die Guerillas befördern.«
Zwei Tangueros hielten Callan fest, als Fidel ein brennendes Streichholz in den Bus warf.
Callan sah die Augen des Fahrers, hörte seine Schreie und verfolgte, wie sich sein Körper in den tanzenden Flammen verkrümmte.
Der Geruch blieb ihm in der Nase. Für immer.
(Auch hier an der Bar in Puerto Vallaría riecht er das verbrannte Fleisch. Keine noch so große Menge Scotch kann diesen Geruch auslöschen.)
Damals hat Callan eine ganze Flasche getrunken. War sternhagelvoll und fast so weit, seine gute alte 22er rauszuholen, um Fidel umzulegen. Dann beschloss er, dass er zu dieser Art von Selbstmord keine Lust hatte, und begann zu packen.
Ein Söldner aus Rhodesien stoppte ihn.
»Zu Fuß kommst du hier nicht weg«, sagte der Rhodesier. »Die legen dich um, gleich auf den ersten Kilometern.«
Der Kerl hat recht, dachte Callan. Ich würde nicht weit kommen.
»Da ist nichts zu machen«, sagte der Rhodesier. »Red Cloud.«
»Was ist Red Cloud?«, fragte Callan.
Der Mann sah ihn komisch an und zuckte die Schultern, als wollte er sagen: Wenn du das nicht weißt, kann ich dir auch nicht helfen.
»Was ist Red Cloud?«, fragte Callan, als Scachi wieder nach Las Tangas kam, um Callan erneut auf die Sprünge zu helfen. Der verdammte Ire hockte nur noch in der Kaserne und führte lange Gespräche mit Johnnie Walker.
»Von wem hast du das gehört, das mit Red Cloud?«, fragte Scachi.
»Egal.«
»Wie du meinst. Dann vergiss doch einfach, dass du's gehört hast.«
»Scheiße, Sal«, sagte Callan. »Ich hänge hier mit drin, und ich will wissen, was das ist, wo ich mit drinhänge.
Nein, willst du nicht, dachte Scachi.
Und selbst wenn du's wolltest, könnte ich's dir nicht sagen.
Red Cloud war der Tarnname für die koordinierte »Neutralisierung« aller linken Bewegungen in Lateinamerika. Im Grunde also Operation Phoenix, übertragen auf Süd- und Mittelamerika. Meist wussten die lokalen Kommandeure gar nicht, dass auch ihre Einsätze von Red Cloud koordiniert wurden, aber Scachi als Laufjunge von John Hobbs musste dafür sorgen, dass der Informationsfluss klappte, dass die Gelder verteilt, die militärischen Ziele verfolgt wurden und keiner dem anderen dabei auf die Füße trat.
Kein leichter Job, aber Scachi war genau der richtige Mann t dafür. Bei den Green Berets, zwischenzeitlich CIA, dazu Mafia-Mitglied, verschwand Sal immer mal wieder aus der Armee, um als Wasserträger für Hobbs zu arbeiten. Und es gab eine Menge Wasser zu tragen. Red Cloud hatte sich um buchstäblich Hunderte von rechten Milizen und spendablen Drogenbaronen zu kümmern, um tausend Armeeoffiziere und ein paar hunderttausend Söldner, Dutzende von Geheimdiensten und Polizeiorganisationen.
Dazu kam die Kirche.
Sal Scachi war Ritter des Malteserordens und Mitglied von Opus Dei, der fanatisch rechtsgerichteten, antikommunistischen Geheimorganisation für Bischöfe, Priester und engagierte Laien - solche wie Scachi. Die katholische Kirche lag im Widerstreit mit sich selbst, die konservativen Kirchenführer im Vatikan bekämpften die »Befreiungstheologen« - linksgerichtete, oft marxistische Priester und Bischöfe der Dritten Welt -, um die Seele der Kirche zu retten. Opus Dei und die Malteserritter arbeiteten Hand in Hand mit den rechten Milizen, den Armeeoffizieren, sogar mit den Drogenkartellen, wenn nötig.
Und das Blut floss wie der Wein beim Abendmahl.
Meist bezahlt mit amerikanischen Dollars, offen und verdeckt. Die offene Methode war die Militärhilfe für Länder, in denen sich Offiziere zu Todesschwadronen formierten, die verdeckte Methode bestand darin, dass die Amerikaner Drogen kauften und die Drogenkartelle mit diesem Geld die Todesschwadrone unterstützten.
Milliarden Dollar Wirtschaftshilfe, Milliarden Dollar Drogengeld.
In El Salvador ermordeten die Todesschwadrone linke Politiker und Gewerkschafter. 1989 erschossen salvadorianische Armeeoffiziere auf dem Campus der Universität von San Salvador sechs Jesuitenpriester, eine Bedienstete und ihre kleine Tochter mit Scharfschützengewehren. Im selben Jahr überwies die US-Regierung eine halbe Milliarde Dollar Entwicklungshilfe an die salvadorianische Regierung. Bis zum Ende der achtziger Jahre wurden etwa 75 000 Menschen ermordet.
Guatemala verdoppelte diese Zahl.
Dem langen Krieg gegen die marxistischen Rebellen fielen über 150000 Menschen zum Opfer, weitere 40000 verschwanden. Obdachlose Kinder wurden in den Straßen niedergeschossen, Studenten ebenfalls. Ein amerikanischer Hotelier wurde enthauptet, eine Professorin in der Universität erstochen, eine amerikanische Nonne vergewaltigt, ermordet und zu den Leichen ihrer Mitschwestern geworfen. Während all das geschah, sorgten amerikanische Militärs für Ausbildung, Beratung und Ausrüstung, darunter Hubschrauber, mit denen die Mörder zu ihren Einsätzen geflogen wurden. Gegen Ende der achtziger Jahre war US-Präsident George Bush dann so angewidert von dem Gemetzel, dass er die finanzielle und militärische Unterstützung für Guatemala stoppte.
Überall in Lateinamerika war es das gleiche - ein langer Krieg Arm gegen Reich, rechts gegen links, mit den Liberalen in der Mitte wie das Reh zwischen den zwei Scheinwerfern.
Und Red Cloud war immer dabei.
John Hobbs überblickte das Geschehen.
Sal Scachi besorgte das Tagesgeschäft.
Hielt Verbindung zu Armeeoffizieren, die ihre Ausbildung an der School of the Americas in Fort Benning, Georgia, gemacht hatten. Sorgte für Schulung, technische Beratung, Ausrüstung, Information. Stellte den lateinamerikanischen Armeen und Milizen Spezialisten zur Verfügung.
Einer dieser Spezialisten war Sean Callan.
Der Mann ist ein Haufen Scheiße, dachte Scachi, als er sich Callan ansah - langes, fettiges Haar, gelbliche Haut vom vielen Trinken. Nicht das, was man sich unter einem Kämpfer vorstellt, aber der Schein trügt.
Mag er aussehen, wie er will, dachte Scachi, er ist eine Kapazität.
Solche Leute sind rar, also ...
»Ich hole dich hier raus«, hat Scachi gesagt. »Gut.«
»Ich hab einen anderen Job für dich.« Und was für einen, denkt Callan jetzt.
Luis Carlos Galán, der Präsidentschaftskandidat der Liberalen Partei, in den Meinungsumfragen weit vorn, flog im Sommer 89 aus dem Rennen. Bernardo Jaramillo Osa, Führer der UP, wurde erschossen, als er im Frühjahr darauf in Bogotá aus dem Flugzeug stieg. Carlos Pizarro, Präsidentschaftskandidat von M-19, ein paar Wochen später ebenfalls.
Danach wurde Kolumbien zu heiß für Sean Callan.
Nicht aber Guatemala, Honduras und El Salvador.
Scachi schob ihn herum wie einen Springer auf dem Schachbrett. Platzierte ihn mal hier, mal da, benutzte ihn, um Figuren vom Brett zu schießen. Guadelupe Salcedo, Héctor Oqueli, Carlos Toledo - dann noch ein Dutzend weitere. Callan kriegt die Namen nicht mehr zusammen. Er wusste nicht, wer hinter Red Cloud steckte, aber er wusste genau, was der Name bedeutete - Blut, ein Blutdunst, der ihm das Hirn vernebelte, bis er nichts mehr sah.
Dann versetzte ihn Scachi nach Mexiko. »Was soll ich da?«, fragte Callan.
»Eine Weile chillen«, antwortete Scachi. »Ein bisschen als Personenschützer aushelfen. Erinnerst du dich an die Barrera-Brüder?«
Und ob er sich erinnerte. Das war das Tauschgeschäft gewesen, Waffen gegen Drogen, mit dem damals, 1985, alles angefangen hatte. Als Jimmy Peaches hinter dem Rücken von Big Paulie Geschäfte machte und es zu dem seltsamen Ausflug nach San Diego kam.
Klar kann sich Callan an die Barrera-Brüder erinnern. Was ist mit denen?
»Das sind Freunde von uns«, sagte Scachi.
Freunde von uns, dachte Callan. Was für eine seltsame Wortwahl. Das sagen Mafiosi nur über Leute, die zur Mafia gehören. Und mexikanische Drogendealer gehören ganz bestimmt nicht dazu, also was soll der Scheiß?
»Das sind gute Leute«, erklärte Scachi. »Sie sind uns eine große Hilfe.«
Klar, dachte Callan, das macht sie natürlich zu Engeln. Aber er ging nach Mexiko. Wohin sollte er auch sonst?
Jetzt sitzt er also in dieser Strandbar und feiert den Totentag.
Beschließt, sich noch ein paar Drinks zu genehmigen, weil hier sowieso nichts passiert, weil heute Feiertag ist. Und passiert trotzdem was, denkt er, schlage ich mich neuerdings besser, wenn ich ein bisschen blau bin und nicht stocknüchtern.
Er kippt gerade seinen letzten Drink, da sieht er das große Aquarium platzen. Ein gewaltiger Wasserschwall, und zwei Leute fallen um, auf diese besondere Art, wie sie nur umfallen, wenn sie erschossen werden.
Callan sucht Deckung hinter einem Barhocker und zieht die 22er.
Das müssen vierzig schwarz uniformierte Federales sein, die da durch den Eingang drängen, ihre Mi6s aus der Hüfte abfeuern. Die Kugeln schlagen in die falschen Felswände der Grotte ein, und es ist ein Glück, dass die Felsen falsch sind, denkt Callan. Die Kugeln werden geschluckt, statt abzuprallen und Leute zu treffen.
Dann löst einer der Federales eine Handgranate von seinem Schultergurt.
»Hinwerfen!«, brüllt Callan, als könnte ihn jemand hören oder verstehen, und bringt den Mann mit zwei Kopfschüssen zur Strecke, bevor er die Granate entsichern kann. Aber inzwischen hat ein anderer eine Granate in Richtung Tanzfläche geworfen, die wie ein Disco-Feuerwerk explodiert, und jetzt gehen etliche Bargäste zu Boden, brüllend vor Schmerz, während sich die Splitter in ihre Beine bohren.
Die Leute stehen knöcheltief im blutigen Wasser mit den zappelnden Fischen, Callan spürt etwas an seinem Fuß, aber es ist keine Kugel, es ist ein blauer Doktorfisch, und Callan verliert sich kurz in die Betrachtung seiner hübsch schillernden Blaufärbung, während in der Bar die Hölle los ist. Die Gäste schreien und brüllen und drängen nach draußen, doch es gibt keinen Weg hinaus, weil die Federales den Ausgang blockieren.
Und schießen.
Callan ist froh, dass er ein bisschen angesäuselt ist. Er kann umschalten auf Autopilot, auf das Programm »alkoholisierter irischer Auftragskiller«, schon ist er klar im Kopf und weiß, dass diese Federales nicht echt sind. Das ist keine Razzia, das ist ein Überfall, und wenn das dort Polizisten sind, dann haben sie Feierabend und verdienen sich ein bisschen was dazu, für den nächsten Urlaub. Er begreift auch sehr schnell, dass hier niemand rauskommt, nicht lebend jedenfalls, und dass es einen Hinterausgang geben muss, also kniet er sich in die Suppe und schiebt sich auf allen vieren nach hinten.
Es ist der Wasserschwall, der Adán das Leben rettet.
Er wirft ihn vom Stuhl, so dass die ersten Schüsse und Granatsplitter über ihn hinwegzischen. Er will sich hochrappeln, aber dann siegt sein Instinkt, und er bleibt am Boden, hört Kugeln schwirren und sieht staunend, wie sie in die teuren Korallen einschlagen, die jetzt trockengelegt und schutzlos im zerschossenen Aquarium hängen. Er zuckt zurück, als sich eine aufgeschreckte Muräne neben ihm windet, und schaut hinüber zum Wasserfall, hinter dem sich Fabián Martínez gerade in die Hose zwängt, neben einem der deutschen Mädchen, das sich ebenfalls beeilt, ihre Blöße zu bedecken. Und da steht auch Raúl, mit heruntergelassener Hose, und schießt mit der Pistole durch den Wasserfall hindurch.
Die falschen Federales können ihn nicht sehen. Und das ist Rauls Rettung, der unentdeckt vor sich hin ballert, bis die Munition alle ist und er sich bückt, um seine Hose hochzuziehen. Dann packt er Fabián bei der Schulter und sagt: »Los, wir müssen hier raus.«
Denn die Federales dringen in die Bar vor, sie suchen nach den Barrera-Brüdern. Adán sieht sie kommen, springt auf und will nach hinten, rutscht aus und fällt, steht wieder auf, und als er sich aufrichtet, streckt ihm einer der Federales grinsend den Gewehrlauf ins Gesicht, und Adán ist so gut wie tot, als das Grinsen in einem Blutschwall ersäuft und Adán sich beim Arm gepackt und nach unten gezogen fühlt. Dann liegt er wieder im Wasser, dicht an dicht mit einem Yankee, der nur sagt: »Hinlegen, Arschloch.«
Callan nimmt sich jetzt die vordringenden Federales vor, mit kurzen, wirkungsvollen Doppelschüssen - tock-tock, tock-tock-, knallt sie ab wie Enten. Adán wirft einen Blick auf den toten Polizisten und sieht zu seinem Entsetzen, dass die Krabben schon in dem klaffenden Loch herumklettern, das einmal sein Gesicht war.
Callan kriecht nach vorn und holt sich zwei Handgranaten von den erschossenen Federales, lädt schnell nach, kriecht auf dem Bauch zurück, packt Adán und schiebt ihn vor sich her nach hinten, während er mit der anderen Hand weiterschießt.
»Mein Bruder!«, brüllt Adán. »Ich muss meinen Bruder finden.«
»Runter!«, brüllt Callan, als eine neue Feuergarbe aufblitzt. Adán wird in die Wade getroffen, schlägt lang hin, bleibt im Wasser liegen und sieht hilflos zu, wie es sich von seinem Blut rot färbt.
Er kann sich nicht bewegen, wie es scheint.
Sein Verstand sagt ihm, dass er aufstehen muss, aber er ist plötzlich erschöpft, viel zu müde, um sich zu bewegen.
Callan bückt sich, nimmt ihn auf die Schulter und wankt los, auf eine Tür mit der Aufschrift Baños zu. Er ist fast dort, als ihm Raúl die Last von der Schulter nimmt.
»Ich hab ihn«, sagt Raúl.
Callan nickt. Ein anderer Barrera-Wachmann gibt ihnen Deckung, feuert hinter ihnen ins Chaos hinein. Callan tritt die Tür ein und findet sich in der relativen Stille eines kleinen Flurs.
Rechts ist eine Tür mit der Aufschrift Sirenas und dem Umriss einer Nixe, links eine Tür mit der Aufschrift Poseidones und dem Umriss eines Neptuns mit Bart und langen Locken. An der Tür direkt vor ihm steht Salida, und Raúl läuft geradewegs auf diese Tür zu.
Callan schreit »Nein!« und zieht ihn am Kragen zurück. Gerade noch rechtzeitig, weil sofort, wie erwartet, Schüsse durch die geöffnete Tür schlagen. Wer die Leute und die Zeit hat, einen Überfall dieser Größenordnung zu planen, postiert auch ein paar Schützen vor der Hintertür.
Also zwängt sich Raúl durch die Poseidones-Tür. Der andere Wachmann folgt ihm nach. Callan entsichert eine Handgranate, wirft sie durch die Hintertür hinaus, zur Abschreckung für alle, die dort lauern könnten, und verschwindet schnellstens in der Toilette.
Hört die Granate hochgehen, mit einem dumpfen Knall wie ein Paukenschlag.
Raúl setzt Adán auf dem Toilettensitz ab, und Callan untersucht Adáns Bein, während der andere Wachmann die Tür hütet. Die Schüsse haben Adáns Wade glatt durchschlagen, aber man kann nicht erkennen, ob Knochen verletzt wurden. Wenn die Schlagader getroffen ist, wird er verbluten, bevor sie Hilfe holen können.
Die Wahrheit ist, dass keiner von ihnen durchkommen wird, wenn die falschen Federales weiter vordringen, denn sie sitzen in der Falle. Mist, denkt Callan, ich hab immer geahnt, dass ich in einem Scheißhaus krepiere. Er schaut sich suchend um. Nicht mal ein Fenster gibt es hier, wie es sich gehört. Dann blickt er nach oben und entdeckt das Dachfenster, direkt über seinem Kopf.
Eine Toilette mit Dachfenster?
Wieder so eine Designer-Idee von Raúl.
»Die Toiletten sollen aussehen wie Kabinen eines gekenterten Kreuzfahrtschiffs«, hatte er Adán erklärt. »Als war das Ding abgesoffen, verstehst du?«
Also hat das Dachfenster die Form eines Bullauges, und die Toilette ist mit Ausnahme des Waschbeckens und der Kloschüssel so gestaltet, als wäre alles in Schieflage. Genau das brauchst du, denkt Callan, wenn du ein paar Margaritas zu viel hast und pissen musst - einen Anfall von Seekrankheit. Wie viele Gäste sind hier in guter Verfassung reingekommen und haben ihre Drinks ausgekotzt, weil sich plötzlich alles drehte? Aber er hält sich nicht lange bei dem Gedanken auf, denn das Bullauge bietet einen Fluchtweg. Er benutzt das Waschbecken als Fußstütze und stößt das Bullauge auf. Springt nach oben, findet Halt und zwängt sich durch. Schon ist er auf dem Dach, die warme Brise schmeckt nach Salz. Er schaut sich um und ruft durchs Fensterloch nach unten. »Kommt hoch!«
Fabián folgt ihm als Erster, dann hebt Raúl seinen Bruder in die Höhe, und Callan und Fabián ziehen ihn aufs Dach. Raúl hat Schwierigkeiten, sich durch das enge Loch zu zwängen, aber er schafft es gerade noch rechtzeitig, bevor die Federales die Tür eintreten und ihre Magazine leerschießen.
Dann stürmen sie die Toilette, in der Erwartung, Tote zu sehen, Verletzte, die sich röchelnd in ihrem Blut wälzen. Aber sie finden nichts dergleichen und wundern sich noch, bis einer hochblickt und das offene Bullauge sieht. Doch das Nächste, was er sieht, ist Callan, der eine Handgranate hinunterwirft und das Bullauge zuknallt. Jetzt gibt es wirklich Tote und Verletzte, die sich röchelnd in ihrem Blut wälzen.
Callan geht voraus zum Dachrand und schaut in die rückwärtige Gasse, dort steht jetzt nur noch ein Mann Wache, Callan erledigt ihn mit zwei schnellen Schüssen in den Hinterkopf. Zusammen mit Raúl lässt er Adán vom Dach herunter, unten steht schon Fabián und fängt ihn auf.
Dann laufen sie los, zur Seitenstraße, Raúl trägt Adán auf den Schultern, Callan geht voraus, zerschießt die Scheibe eines Ford Explorer, öffnet die Tür und braucht etwa dreißig Sekunden, um ihn kurzzuschließen.
Zehn Minuten später sitzen sie in der Notaufnahme, und als die Schwestern den Namen Barrera hören, stellen sie keine Fragen mehr.
Adán hat Glück - das Schienbein ist nur angekratzt und die Schlagader unversehrt.
Raúl hält seinen linken Arm ausgestreckt, um Blut zu spenden, den anderen Arm braucht er zum Telefonieren. Minuten später sind seine Sicarios entweder auf dem Weg ins Krankenhaus, oder sie durchkämmen die Umgebung von La Sirena nach Gúeros Leuten, die sich dort vielleicht noch herumtreiben. Sie finden niemanden und kommen mit der Nachricht zurück, dass sechs Partygäste getötet wurden und zehn der falschen Federales tot oder verwundet sind.
Aber die Barrera-Brüder haben sie nicht erwischt.
Dank Sean Callan.
»Du hast jeden Wunsch frei«, sagt Adán zu ihm. An diesem Totentag. Du musst es nur sagen. Jeder Wunsch wird dir erfüllt.
Das junge Mädchen bäckt ihm ein besonderes pan de muerte. Totenbrot.
Das traditionelle Zuckerbrötchen mit einer versteckten Überraschung, einer Süßigkeit, die Don Miguel Angel Barrera besonders mag, wie sie weiß, und auf die er sich an diesem Festtag freut. Da es Glück .bringt, wenn man das richtige Brötchen erwischt, macht sie das eine extra für ihn, um sicherzugehen, dass es nicht an den Falschen gerät.
An diesem besonderen Abend soll alles seine Richtigkeit haben.
Sie macht sich mit besonderer Sorgfalt zurecht: ein einfaches schwarzes, aber elegantes Kleid, schwarze Strümpfe, schwarze Pumps. Das Make-up legt sie langsam auf, achtet besonders auf die richtige Anwendung der Mascara und bürstet ihr schwarzes Haar, bis es glänzt. Sie prüft ihr Aussehen im Spiegel, und es gefällt ihr - ihre Haut ist glatt und blass, ihre schwarzen Augen sind besonders betont, ihr Haar fällt in sanftem Schwung auf ihre Schultern.
In der Küche legt sie das besondere pan de muerte auf ein Silbertablett, umgibt es mit Duftkerzen, zündet sie an und trägt das Tablett in seine Esszelle.
Wie majestätisch er aussieht mit seiner kastanienbraunen Hausjacke über dem Seidenpyjama. Don Miguels Neffen haben Sorge getragen, dass er alle Annehmlichkeiten genießen kann, die das Leben im Gefängnis erträglich machen - gute Kleidung, gutes Essen, gute Weine - und auch sie.
Man munkelt, dass Adán deshalb so gut für seinen Onkel sorgt, weil er ein schlechtes Gewissen hat, da er eigentlich froh ist, dass sein Onkel aus dem Rennen ist und ihm die Führung des Kartells nicht streitig machen kann. Und böse Zungen behaupten gar, Adán habe seinen Onkel eigens hinter Gitter gebracht, um sein Erbe anzutreten.
Das Mädchen weiß nicht, ob es stimmt, und es ist ihr egal. Sie weiß nur, dass Adán Barrera sie davor bewahrt hat, in einem Bordell von Mexico City zu enden, und stattdessen zur Gespielin seines Onkels erkoren hat. Angeblich soll sie einer Frau ähneln, die Don Miguel einmal geliebt hat.
Und das ist mein großes Glück, denkt sie.
Don Miguel stellt keine allzu hohen Anforderungen. Sie kocht und wäscht für ihn, steht ihm für seine männlichen Bedürfnisse zur Verfügung. Es stimmt, er schlägt sie, aber nicht so oft und brutal wie ihr eigener Vater, und sie muss ihm nicht so häufig zu Willen sein. Er schlägt sie, und er nimmt sie sich, und wenn er seinen floto nicht aufrichten kann, wird er wütend und schlägt sie, bis es ihm wieder gelingt.
Anderen ergeht es da schlimmer, denkt sie sich.
Und die Bezahlung durch Adán ist recht großzügig.
Aber nicht so großzügig wie ...
Sie verjagt den Gedanken aus ihrem Kopf und überreicht Don Miguel das Zuckerbrötchen. Mit zitternden Händen. Tío bemerkt es.
Ihre zarten Hände zittern, als sie das Tablett vor ihm abstellt, und ihre Augen sind feucht, als wäre sie kurz vorm Weinen. Aus Kummer?, fragt er sich. Oder vor Angst? Er blickt ihr prüfend in die Augen, dann kurz auf das pan de muerte - und weiß Bescheid.
»Es sieht schön aus«, sagt er und betrachtet das Brötchen. »Danke.«
Ist da ein Zögern in ihrer Stimme?
»Bitte setz dich.« Er steht auf und hält ihr einen Stuhl hin. Sie setzt sich, ohne die Hände von der Stuhlkante zu lösen.
»Bitte schön. Nimm du den ersten Happen«, sagt er und setzt sich wieder.
»O nein, das ist für Sie.«
»Ich bestehe darauf.«
»Ich kann nicht.«
»Ich bestehe darauf.«
Es ist ein Befehl.
Sie kann sich nicht widersetzen.
Also bricht sie ein Stück von dem Brötchen ab und führt es an die Lippen. Oder versucht es. Denn ihre Hand zittert viel zu sehr, und die Tränen, mag sie sich noch so sehr beherrschen, laufen ihr über die Wangen und ruinieren ihr Make-up.
Sie blickt in an und schluchzt: »Ich kann nicht.«
»Und doch wolltest du mir das zu essen geben.« Sie schnieft, Rotzblasen kommen aus ihrer Nase. Er reicht ihr die Leinenserviette. »Wisch dir die Nase ab«, sagt er. Sie gehorcht.
»Jetzt iss das Brot, das du für mich gebacken hast.«
»Bitte nicht«, stammelt sie und senkt den Blick.
Sind meine Neffen schon tot?, fragt sich Tío. Gúero würde so einen Anschlag nur wagen, wenn Adán und Raúl keine Gefahr mehr für ihn sind. Also sind sie entweder schon tot oder kurz davor - oder Gúero hat auch diese Sache verpfuscht. Hoffen wir's, denkt er und nimmt sich vor, mit seinen Neffen Verbindung aufzunehmen, sobald er diese leidige Angelegenheit hinter sich hat.
»Mendez hat dir viel Geld geboten, was?«, fragt er. »Einen Neuanfang für dich und deine ganze Familie, was?« Sie nickt.
»Du hast kleine Schwestern, oder?«, fragt er weiter. »Dein Vater, dieser Trunkenbold, missbraucht sie, oder? Mit dem Geld von Méndez kannst du sie da rausholen, stimmt's?«
»Ja.«
»Ich verstehe.«
Mit neuer Hoffnung schaut sie ihn an.
»Iss«, sagt er. »Es wird ein gnadenvoller Tod. Du wolltest doch nicht, dass ich langsam und qualvoll sterbe, oder?«
Sie sträubt sich, das Stück Brot in den Mund zu schieben. Ihre Hand zittert, kleine Krümel kleben an ihren grellroten Lippen. Und nun fallen dicke Tränen auf das Brot und lösen den Zuckerguss auf, mit dem sie das Brötchen so sorgfältig dekoriert hat.
»Iss.«
Sie steckt den Happen in den Mund, aber sie bekommt ihn nicht herunter, also gießt er Rotwein ein und drückt ihr das Glas in die Hand. Sie nippt an dem Wein, das scheint zu helfen, und spült den Happen herunter. Dann beißt sie noch einmal ab und spült auch den nächsten Happen herunter.
Er beugt sich über den Tisch und streicht ihr mit dem Handrücken übers Haar. »Ich weiß, ich weiß«, sagt er tröstend, während er ihr einen weiteren Happen an den Mund hält. Sie öffnet den Mund, nimmt den Happen an, und nach dem nächsten Schluck Wein setzt die Wirkung des Strychnins ein. Ihr Kopf ruckt zurück, ihre Augen quellen hervor, aus dem weit geöffneten Mund dringt ihr Todesröcheln.
Ihr Leiche lässt er den Hunden zum Fraß vorwerfen.
Parada zündet sich eine Zigarette an.
Nimmt einen tiefen Zug, bevor er sich bückt, die Schuhe anzieht und sich wundert, warum er mitten in der Nacht geweckt wird und was es mit der »dringenden persönlichen Angelegenheit« auf sich hat, die nicht bis zum Morgen warten kann. Er lässt dem Bildungsminister von seiner Haushälterin ausrichten, er soll es sich in seinem Arbeitszimmer bequem machen, er wird gleich kommen.
Parada kennt Cerro seit vielen Jahren. Während Cerros Amtszeit als Gouverneur von Sinaloa war er Bischof in Culiacán und hat zwei der legitimen Kinder Cerros getauft. Und hatte nicht Miguel Angel Barrera beide Male Pate gestanden?, fragt sich Parada. Ach ja, Barrera war auch zu ihm gekommen, als es um das Seelenheil und die Zukunft eines unehelichen Kindes von Cerro ging, denn der Gouverneur hatte ein junges Mädchen vom Lande verführt. Na, wenigstens haben sie sich für mich entschieden statt für die Abtreibung, und das spricht unbedingt für den Mann.
Aber, denkt er, während er den alten Pullover überzieht, wenn er wieder ein junges Mädchen geschwängert hat, mache ich ihm die Hölle heiß. In seinem Alter sollte man sich beherrschen und aus seinen Fehlern lernen. Und überhaupt: Warum muss das unbedingt - er blickt auf die Uhr - um vier Uhr morgens geklärt werden?
Er klingelt nach der Haushälterin. »Kaffee bitte, für zwei. Ins Büro.«
In letzter Zeit hat er viel mit ihm verhandelt, er hat gestritten, geworben, gebettelt, gedroht, denn er möchte, dass der Bildungsminister etwas für die Bildung tut: neue Schulen, Lehrbücher, Schulspeisung, mehr Lehrer. Parada hat nicht lockergelassen, ist bis an den Rand der Erpressung gegangen, hat Cerro einmal ermahnt, er solle die ländlichen Gebiete nicht behandeln wie uneheliche Kinder -. eine Bemerkung, der immerhin zwei neue Grundschulen und ein Dutzend neue Lehrer zu verdanken waren.
Vielleicht ist das Cerros Rache, denkt Parada auf dem Weg ins Erdgeschoss. Doch als er Cerro sieht, weiß er, dass es etwas Ernstes ist.
Cerro kommt sofort zur Sache. »Ich habe Krebs. Im Endstadium.«
Parada erstarrt. »Das ist ja furchtbar. Kann man da nichts -«
»Nein. Es gibt keine Hoffnung.«
»Möchten Sie, dass ich Ihnen die Beichte abnehme?«
»Dafür habe ich meinen Pfarrer«, sagt Cerro.
Er überreicht Parada einen Aktenkoffer.
»Das möchte ich Ihnen übergeben«, sagt er. »Ich weiß nicht, wem ich es sonst anvertrauen kann.«
Parada öffnet den Koffer: Papiere und Tonbänder. »Ich verstehe nicht«, sagt er.
»Ich bin Mitwisser«, sagt Cerro. »Bei einem gewaltigen Verbrechen. Ich kann nicht sterben ... Ich habe Angst zu sterben ... mit dieser Last auf meiner Seele. Ich muss wenigstens versuchen, etwas wiedergutzumachen.«
»In der Beichte wird Ihnen gewiss Absolution erteilt«, antwortet Parada. »Aber wenn das hier irgendwelche Beweise sind, warum kommen Sie damit zu mir? Warum gehen Sie nicht zum Justizminister oder -«
»Seine Stimme ist auf diesen Tonbändern.«
Nun, das ist ein Grund, denkt Parada.
Cerro beugt sich zu ihm hinüber und flüstert. »Der Justizminister, der Innenminister, der Vorsitzende der PRI, der Präsident. Wir alle stecken mit drin.«
Allmächtiger, denkt Parada.
Was ist auf diesen Bändern?
Als er Cerro verabschiedet hat, nimmt er sich den Koffer vor.
Raucht eine Zigarette nach der anderen, hört Bänder ab, stöbert in Dokumenten, Sitzungsprotokollen, Cerros Notizen. Namen, Daten, Orte. Beweise für fünfzehn Jahre Korruption. Nein, nicht nur Korruption. Das wäre der traurige Normalfall - das hier ist schlimmer. Mehr als schlimm - es gibt keine Worte dafür.
Auf den allereinfachsten Nenner gebracht: Sie haben Mexiko an die narcotraficantes verkauft.
Er hätte es nicht für möglich gehalten, doch er hört es mit eigenen Ohren, auf dem Mitschnitt eines Banketts zur Wahlkampffinanzierung für den gegenwärtigen Präsidenten - 25 Millionen Dollar Spenden. Beweise für die Ermordung der Wahlleiter, für den Wahlbetrug selbst. Die Stimmen des Präsidentenbruders und des Justizministers, während sie ihre Verbrechen planen. Und die Aufforderung an die Narcos, für alles aufzukommen, für die Beseitigung der Gegner zu sorgen, den amerikanischen Agenten Hidalgo zu foltern und verschwinden zu lassen.
Und was verbirgt sich hinter Operation Kerberos? Eine Verschwörung mit dem Ziel, Drogengelder in die Finanzierung der nicaraguanischen Contras fließen zu lassen?
Oder Operation Red Cloud? Rechtsradikale Mordkommandos, die von den kolumbianischen und mexikanischen Drogenkartellen und sogar von der mexikanischen Regierungspartei PRI finanziert werden?
Kein Wunder, dass Cerro die Hölle fürchtet. Er hat selbst geholfen, sie herbeizuführen.
Und jetzt verstehe ich auch, warum er mir die Dokumente übergeben hat. Der Präsident, sein Bruder, der Innenminister, Miguel Ángel Barrera, García Abrego, Gúero Méndez, Adán Barrera, hohe Offiziere aller Sparten, Parteiführer - es gibt in Mexiko niemanden, der bereit oder fähig wäre, Konsequenzen zu ziehen.
Also kommt er damit zu mir. Damit ich es weitergebe.
Aber an wen?
Als er eine neue Zigarette anzündet, stellt er zu seiner Überraschung fest, dass ihm das Rauchen zuwider ist. Der ekelhafte Geschmack im Mund. Er geht hinauf ins Bad, putzt sich die Zähne, dann duscht er so heiß, dass es weh tut, und während ihm das Wasser in den Nacken prasselt, überlegt er, ob es klug ist, diese Sachen an Arthur Keller zu übergeben.
Er hat die Verbindung zu dem Amerikaner aufrechterhalten, der jetzt leider in Mexiko unerwünscht ist, und der Mann ist immer noch heiß entschlossen, die Drogenkartelle zu Fall zu bringen. Aber überleg's dir genau, sagt er sich. Ist Keller wirklich der richtige Mann angesichts der schockierenden Tatsache, dass die CIA mit den Barreras gemeinsame Sache macht, um die Contras zu finanzieren? Hat Keller die Macht, dagegen vorzugehen, oder wird das von der gegenwärtigen US-Regierung verhindert? Oder von jeder US-Regierung, da sie ja alle auf die NAFTA schwören?
NAFTA, denkt Parada. Der Abgrund, auf den wir zumarschieren, im Gleichschritt mit den Amerikanern. Aber es gibt eine Hoffnung. Die Präsidentschaftswahlen stehen bevor, und der neue Kandidat der PRI - der zwangläufig gewinnen wird - scheint ein guter Mann zu sein. Luis Donaldo Colosio kommt aus dem linken Flügel, er hört auf die Stimme der Vernunft. Parada hat schon mit ihm gesprochen, der Mann ist sympathisch.
Und wenn das Beweismaterial, das mir Cerro überbracht hat, geeignet ist, die Dinosaurier der PRI zu entmachten, könnte Colosio die Chance bekommen, seine ehrlichen Anliegen zu verwirklichen. Soll ich ihm das Material geben?
Nein, denkt Parada. Colosio darf sich nicht offen gegen seine Partei stellen - das würde ihn die Nominierung kosten.
Also wer?, fragt sich Parada, während er sich einseift und mit der Rasur beginnt. Wer besitzt die Unabhängigkeit, die Macht, die moralische Autorität, um öffentlich zu enthüllen, dass sich die gesamte Regierung eines Landes von den Drogenkartellen kaufen ließ? Wer?
Und plötzlich weiß er es.
Es gibt nur einen, der dafür in Frage kommt.
Er wartet bis zum frühen Vormittag, dann ruft er Antonucci an und erklärt ihm, er habe wichtige Informationen für den Papst.
Opus Dei wurde 1928 von dem reichen spanischen Juristen und Expriester Josemaria Escrivá gegründet, weil er darunter litt, dass die Madrider Universität zu einer Brutstätte des Linksradikalismus geworden war. Er litt so sehr, dass sich seine neue Organisation im Spanischen Bürgerkrieg auf die Seite Francos stellte und das Franco-Regime auch in den nachfolgenden dreißig Jahren stützte. Der Gedanke war, konservative, begabte Laien zu rekrutieren, die in Regierungsämter, in Presse- oder Wirtschaftskarrieren strebten, sie mit den »traditionellen« katholischen Werten zu durchtränken - besonders mit antikommunistischen Affekten - und sie dann in ausgewählten Bereichen für die Kirche arbeiten zu lassen.
Salvatore Scachi - Oberst der Special Forces, CIA-Mann, Malteserritter und eingefleischter Mafioso - ist auch ein verdientes und bewährtes Opus-Dei-Mitglied. Er erfüllt alle Anforderungen - besucht täglich die Messe, beichtet nur vor Ordenspriestern und ist regelmäßiger Gast in den Einrichtungen des Ordens.
Außerdem ist er ein vorbildlicher Soldat. Er hat die gute Sache gegen den Kommunismus in Vietnam verfochten, in Kambodscha und im Goldenen Dreieck. Er hat in Mexiko gekämpft, in Mittelamerika für Kerberos, in Südamerika für Red Cloud - alles Operationen, die der Befreiungstheologe Parada vor der Welt zu enthüllen droht. Jetzt sitzt Scachi in Antonuccis Büro und überlegt, was mit den Dokumenten geschehen soll, die Kardinal Parada an den Vatikan weitergeben will.
»Sie sagen, Cerro war bei ihm«, fragt Scachi bei Antonucci nach.
»So hat es Parada mir gesagt.«
»Cerro weiß genug, um die ganze Regierung zu stürzen«, sagt Scachi.
Und noch einiges mehr.
»Wir können den Heiligen Vater nicht mit diesen Dingen behelligen«, erklärt Antonucci. Dieser Papst ist ein großer Förderer von Opus Dei, er hat sich sogar dazu verstanden, Padre Escrivá seligzusprechen, und das ist der erste Schritt zu seiner Heiligsprechung. Ihn mit, Beweisen für die Beteiligung von Opus Dei an den etwas schärferen Maßnahmen gegen die kommunistische Weltverschwörung zu konfrontieren wäre, gelinde gesagt, unangemessen.
Schlimmer noch würde der Skandal die gegenwärtige Regierung treffen, und das zu einer Zeit, da die Kirche in Mexiko auf dem besten Wege ist, ihren vollen Rechtsstatus wiederzuerlangen. Nein. Diese Enthüllungen würden die Regierung erschüttern und den ketzerischen liberalen Theologen in die Hände arbeiten - all den »nützlichen Idioten«, die den Kommunisten zur Macht verhelfen könnten.
Es ist überall dasselbe, denkt Antonucci - dumme, irregeleitete liberale Priester verhelfen den Kommunisten zur Macht, um dann von ihnen abgeschlachtet zu werden. So war es auch in Spanien, weshalb der selige Escrivá seinen Orden überhaupt erst gegründet hat.
Als Mitglieder von Opus Dei sind Antonucci und Scachi bestens mit dem Konzept des kleineren Übels vertraut, und für Sal Scachi steht außer Frage, dass das kleinere Übel der Korruption dem großen Übel des Kommunismus vorzuziehen ist. Er hat dabei auch die NAFTA im Blick, die im Kongress noch immer umstritten ist. Wenn Paradas Enthüllungen ans Licht kämen, wäre das katastrophal für die NAFTA, und ohne NAFTA käme es nicht zur Herausbildung eines mexikanischen Mittelstands, der einzigen nachhaltigen Barriere gegen die Ausbreitung des Kommunismus.
Jetzt sagt Antonucci: »Wir haben hier die Möglichkeit, etwas Großartiges für die Seelen von Millionen Gläubigen zu leisten - wenn wir uns um die mexikanische Regierung verdient machen, kann es uns gelingen, dem mexikanischen Volk die alleinseligmachende katholische Kirche zurückzugeben.«
»Indem wir diese Informationen unterdrücken.«
»Genau so.«
»Aber das ist nicht so einfach«, sagt Scachi. »Parada wird sein Wissen ausspielen, wenn er nicht begreift -«
Antonucci erhebt sich. »Diese profanen Angelegenheiten muss ich den Laienbrüdern des Ordens überlassen. Davon verstehe ich nichts.«
Das ist Sal Scachis Metier.
Adán hütet das Bett in Rauls großer, festungsartig ausgebauter estancia. Sie heißt Rancho las Bardas und liegt abseits der Straße von Tijuana nach Tecate.
Die Häuser von Adán und Raúl sind von einer drei Meter hohen Mauer mit Natodraht und Glasscherben umgeben. Überragt wird die Mauer von Wachtürmen an allen vier Ecken. Besucher passieren zwei Tore aus massivem Stahl, die Wachen sind mit Kalaschnikows, M-50-Maschinenpistolen und chinesischen Granatwerfern ausgerüstet.
Um überhaupt zur estancia zu gelangen, muss man von der Landstraße abbiegen und zwei lange Meilen über eine ungepflasterte Straße fahren, aber so weit kommt es gar nicht, weil die Abzweigung rund um die Uhr von Zivilpolizisten bewacht wird.
Hierhin haben sich die Brüder nach dem Überfall auf die Disco zurückgezogen, und jetzt herrscht höchste Alarmstufe. Die Wachen patrouillieren Tag und Nacht, die Umgebung wird mit Jeeps überwacht, Nachrichtentechniker fangen alle Funkkontakte und Handyverbindungen auf.
Draußen vor Adáns Schlafzimmerfenster sitzt Manuel Sánchez wie ein wachsamer Hund. Jetzt sind wir Zwillinge, denkt Adán, weil wir beide humpeln - ich hoffentlich nur vorübergehend. Aber wegen seiner Behinderung habe ich den Mann in all den Jahren als Bodyguard behalten, seit damals, als wir beide gefoltert wurden, in den schlimmen Zeiten von Operation Condor.
Sánchez wird seinen Posten nicht verlassen - nicht mal zum Essen, nicht mal zum Schlafen.
Setzt sich einfach an die Mauer, das Gewehr auf den Knien, oder steht auch mal auf und humpelt an der Hauswand auf und ab.
»Ich hätte dort sein müssen, patron«, hat er zu Adán gesagt, und die Tränen liefen ihm übers Gesicht. »Ich hätte bei Ihnen sein müssen.«
»Du bist fürs Haus und die Familie zuständig«, hat ihn Adán beschieden. »Und du hast mich noch nie im Stich gelassen.« So wird es auch bleiben.
Er weicht nicht von Adáns Fenster. Die Köchin bringt ihm Tortillas mit refritas und Paprika, Schüsseln mit scharfen albóndigas, die isst er draußen vorm Fenster. Don Adán hat ihm das Leben gerettet, hat sein Bein gerettet, Don Adán und seine Frau und Tochter sind im Haus, und wenn Gúeros Sicarios hier auftauchen sollten, kriegen sie es mit Manuel Sánchez zu tun.
An Manuel Sánchez kommt keiner vorbei.
Adán ist froh, dass er da ist, und sei es nur, damit sich Lucia und Gloria sicher fühlen. Sie mussten eine Menge durchmachen, wurden mitten in der Nacht von Adáns Sicarios geweckt und aufs Land gebracht, ohne auch nur einen Koffer packen zu können. Die Aufregung hat bei Gloria zu schweren Atemstörungen geführt, ein Arzt musste eingeflogen werden, mit verbundenen Augen, und sie betreuen. Die teure und empfindliche medizinische Ausrüstung - Atemgeräte, Sauerstoffzelte, Luftbefeuchter -, alles musste mitten in der Nacht abtransportiert werden, und selbst jetzt noch, Wochen später, zeigt Gloria Symptome.
Als sie ihn dann humpeln sah, unter Schmerzen, war es ein neuer Schock für sie, und er hat sich geschämt, weil er ihr etwas von einem Motorradunfall vorlog und ihr erzählte, sie würden eine Weile auf dem Land bleiben, weil die Luft hier besser für sie sei.
Aber sie ist nicht dumm. Sie sieht die Wachtürme, die Gewehre, die Wachen, und bald wird sie verstehen, dass die Familie sehr reich ist und daher Schutz braucht.
Dann wird sie die unbequemen Fragen stellen.
Und unbequeme Antworten erhalten.
Papa, wovon lebst du eigentlich?
Wird sie es verstehen?, fragt sich Adán. Er ist unruhig, gereizt. Mir hängt dieses Warten langsam zum Hals heraus, sagt er sich. Und um ehrlich zu sein - mir fehlt Nora. Im Bett und am Tisch. Wie schön wäre es, könnte ich über all das mit ihr reden.
Am Tag nach dem Überfall konnte er sie telefonisch benachrichtigen. Fernsehen und Zeitungen hatten von der Sache berichtet, und er wollte ihr mitteilen, dass es ihm gutging. Dass es ein paar Wochen dauern würde bis zum Wiedersehen und, wichtiger noch, dass sie sich bis auf weiteres von Mexiko fernhalten solle.
Sie hat genauso reagiert wie erwartet, wie erhofft. Nahm beim ersten Klingeln ab, und er hörte die Erleichterung in ihrer Stimme. Dann machte sie auch gleich Witze - er sei selbst schuld, wenn er sich von einer Sirene auf Abwege führen lasse.
»Gib mir Bescheid«, hat sie gesagt, »und ich komme.«
Wenn ich das nur könnte, denkt er und streckt ächzend sein Bein. Du ahnst ja nicht, wie sehr du mir fehlst.
Im Bett hält er es nicht mehr aus. Behutsam setzt er die Füße auf den Boden und steht auf. Mit Hilfe des Stocks schafft er es bis zum Fenster. Was für ein herrlicher Tag! Die strahlende Sonne wärmt, die Vögel singen - es ist eine Lust zu leben. Sein Bein heilt gut und schnell, ohne Entzündung, bald ist er wieder voll belastbar. Das ist auch dringend nötig, es gibt viel zu tun, die Zeit drängt.
Und er hat Grund zur Sorge. Der Überfall auf La Sirena, der Umstand, dass sich Gúeros Leute als Federales tarnen konnten - all das muss Hunderttausende an Schmiergeld gekostet haben. Und wenn sich Gúero stark genug fühlt, gegen das Gewaltverbot in Badeorten zu verstoßen, bedeutet das, dass er über unerwartet große Reserven verfügt.
Aber wieso?, fragt sich Adán. Wie kann der Mann noch Ware umschlagen, wenn ihm das Barrera-Kartell alle Wege versperrt? Und wieso bekommt Gúero Unterstützung von der Bundespolizei, den Federales?
Hat er sich etwa mit Abrego verbündet? Hätte er den Überfall jemals ohne Ábregos Zustimmung gewagt? Und wer Ábregos Zustimmung hat, hat die Unterstützung von el Bagmán, dem Bruder des Präsidenten, und damit der gesamten Regierung.
Sogar in Baja gibt es Krieg zwischen den Polizeikräften. Die Barreras haben die Provinzpolizei auf ihrer Seite und Gúero die Federales. Die Polizei von Tijuana verhält sich mehr oder weniger neutral, aber es gibt eine neue Truppe in der Stadt, die Taktische Sondereinheit, die von keinem anderen als dem unbestechlichen Antonio Ramos geführt wird. Und wenn der sich mit den Federales verbündet...
Gott sei Dank sind bald Wahlen, sagt sich Adán. Seine Leute haben schon mehrere diskrete Annäherungsversuche an den PRI-Kandidaten Colosio unternommen, sind aber stets abgeblitzt. Doch wenigstens hat Colosio zu erkennen gegeben, dass er radikal gegen den Drogenhandel vorgehen will, dass er, wird er denn gewählt, Gúero Méndez und die Barreras mit gleichem Eifer verfolgen wird.
Aber bis dahin heißt es, wir allein gegen den Rest der Welt, denkt Adán.
Und dieses Mal gewinnt die Welt.
Callan gefällt das gar nicht.
Er sitzt auf der Rückbank eines gestohlenen feuerwehrroten Suburban - dem Lieblingsvehikel der Narco-Cowboys -, zusammen mit Raúl Barrera, der sich durch die Avenidas von Tijuana kutschieren lässt, als wäre er der Bürgermeister persönlich. Der Chauffeur ist ein Offizier der Provinzpolizei, und neben ihm sitzt ein weiterer Offizier. Callan musste sich diese lächerliche mexikanische Cowboykluft antun - mitsamt Stiefeln, schwarzem Hemd mit Perlmuttknöpfen und weißem Cowboyhut.
So führt man doch keinen Krieg, denkt er. Warum machen die das nicht wie die Sizilianer - immer schön bedeckt halten, auf Chancen lauern. Die Mexikaner sind offenbar anders. Das sind Machos, die trumpfen auf und zeigen Flagge.
Offenbar legt Raúl es darauf an, gesehen zu werden.
Daher wundert sich Callan nicht weiter, als er die zwei schwarzen Suburbans sieht, die von hinten nahen, vollbesetzt mit Federales. Aber es beunruhigt ihn schon. »Ah, Raúl...«
»Hab sie schon gesehen.«
Er befiehlt dem Chauffeur, rechts abzubiegen, in eine Seitenstraße, die sich an einem riesigen Flohmarkt entlangzieht.
In dem zweiten schwarzen Suburban sitzt Gúero. Er sieht die feuerwehrrote Yuppie-Kutsche rechts abbiegen und glaubt, Raúl Barrera auf dem Rücksitz zu erkennen.
Aber der Clown lenkt ihn ab.
Ein dummes, lachendes Clownsgesicht ist auf die Mauer des Flohmarkts gemalt, der sich über zwei Querstraßen erstreckt. Weiß geschminkt, rote Nase, Clownsperücke und an die neun Meter hoch. Gúero blinzelt irritiert, dann wendet er sich wieder dem Kerl auf dem Rücksitz des roten Suburban mit kalifornischem Nummernschild zu, und er ist todsicher, dass er Raúl Barrera vor sich hat.
»Überholen«, befiehlt er.
Der vorausfahrende schwarze Suburban überholt den roten und drängt ihn ab. Gúeros Suburban kommt von hinten und keilt ihn ein.
Scheiße, denkt Callan, als ein Offizier der Federales aus dem vorderen Suburban steigt und auf sie zukommt, mit gezückter M16, und zwei seiner Leute direkt hinter ihm. Das ist keine Verkehrskontrolle. Er rutscht ein bisschen tiefer, zieht behutsam die 22er und versteckt sie unter dem linken Unterarm.
»Alles unter Kontrolle«, sagt Raúl.
Callan ist sich da nicht so sicher, denn aus den Fenstern der zwei Suburbans ragen Gewehrläufe wie Musketen aus den Planwagen in einem alten Western, und wenn nicht gleich die Kavallerie einreitet, denkt er, bleibt nicht viel von uns übrig.
Scheiß-Mexiko.
Gúero lässt die Scheibe herunter, schaltet die Kalaschnikow auf »Trommelfeuer« und richtet sie auf Raúl.
Der am Steuer sitzende Polizeioffizier kurbelt das Fenster herunter und fragt: »Gibt's ein Problem?«
Ja, offensichtlich, denn der comandante fedérale hat Raúl entdeckt und richtet die M16 auf ihn. Callan feuert aus der Hüfte.
Zwei Schüsse durchlöchern die Stirn des Comandante.
Noch bevor er fällt, fällt die M16 zu Boden.
Jetzt schießen auch die zwei Offiziere, direkt durch die Frontscheibe. Raúl sitzt hinten, ballert an den Ohren seiner zwei Vordermänner vorbei, er schießt und brüllt, was das Zeug hält, denn wenn das sein Abgang wird, soll es ein stilvoller werden. Noch viele Jahre lang sollen die narcocorridos seinen heroischen Abgang besingen.
Nur dass es keiner wird.
Gúero hat den knallroten Suburban gesehen, nicht aber den Ford Aerostar und den VW Jetta, die ihm mit einigem Abstand folgten, und jetzt kommen diese zwei ebenfalls gestohlenen Fahrzeuge angebraust und blockieren die Federales.
Dem Aerostar entsteigt Fabián Martínez, und er durchsiebt einen von den Federales, der unter seinem schwarzen Suburban Deckung sucht, mit der Kalaschnikow. Dessen Kollege, der begreift, dass sie in der Klemme sitzen, will seine Haut retten, indem er dem verletzten, um sein Leben flehenden Polizisten den Gnadenschuss verpasst - ihm zwischen den erhobenen Händen hindurch mitten ins Gesicht schießt - und dann Fabián erwartungsvoll anschaut.
Fabián erledigt ihn mit zwei Kopfschüssen.
Feiglinge kann er nicht gebrauchen.
Callan zerrt Raúl zurück auf den Sitz und brüllt: »Nichts wie weg!«
Er öffnet die Tür und rollt sich heraus, schießt unter dem Auto durch, auf alles, was schwarze Hosenbeine hat, während Raúl über ihn hinwegsteigt, dann schießen sie sich den Weg frei, Richtung Boulevard.
Was für ein Schlamassel, denkt Callan.
Aus allen Himmelsrichtungen kommt Polizeiverstärkung, motorisiert und zu Fuß. Federales, Provinzpolizei, lokale Polizei, und keiner weiß, wer gegen wen kämpft, es ist der reinste Affenzirkus.
Keiner weiß, auf wen er schießen soll, und keiner will getroffen werden. Fabians Leute haben zumindest ein klares Ziel, sie schießen auf die Federales, die den Ärger verursacht haben. Aber das sind harte Jungs, sie schießen zurück, die Kugeln schwirren in alle Richtungen, dann steht da noch ein Volltrottel mit seiner Sony-Kamera, filmt das Ganze und überlebt nur dank der Gnade, die Idioten und Besoffenen zuteilwird, doch eine Menge Leute müssen sterben.
Drei Federales sind tot, drei verwundet. Zwei Barrera-Leute und ein Provinzpolizist haben ihren Geist aufgegeben, zwei weitere wälzen sich in ihrem Blut, dann sind da noch sieben Unbeteiligte, die ebenfalls etwas abbekommen haben. Und inmitten dieser Szenerie der surreale Anblick eines Bischofs, der zufällig in der Nähe war und nun den Toten die Sakramente erteilt und den Verletzten geistlichen Beistand gewährt. Inmitten der Rettungswagen, Polizeifahrzeuge und Übertragungswagen. Es sind alle da, nur Schneewittchen und die sieben Zwerge fehlen.
Doch dem Clown ist das Lachen vergangen.
Es ist ihm förmlich aus dem Gesicht geschossen worden, seine rote Nase ist von Löchern zernarbt, seine Augen haben neue Pupillen bekommen, so dass er jetzt schielt.
Gúero ist verschwunden - die Schießerei hat er auf dem Boden seines Suburban abgewartet, um sich dann unbemerkt davonzuschleichen.
Aber eine Menge Leute sehen Raúl. Schulter an Schulter mit Callan tritt er den Rückzug an, ballert aus seiner Kalaschnikow, während Callan präzise Doppelschüsse aus seiner 22er abgibt.
Callan sieht, wie Fabián in den Aerostar springt und ihnen rückwärts fahrend entgegenkommt - mit zerschossenen Reifen. Die blanken Felgen schlagen Funken auf dem Pflaster, als er neben ihnen hält und »Einsteigen« brüllt.
Warum nicht, denkt Callan. Er ist noch nicht richtig drin, da gibt Fabián Gas, rast weiter rückwärts und' kracht gegen einen weiteren Suburban, der die Kreuzung blockiert. Er ist voll besetzt mit Zivilpolizisten, die Mi6-Sturmgewehre im Anschlag.
Callan ist erleichtert, als Raúl die Kalaschnikow fallen lässt und lächelnd die Hände hebt.
Währenddessen treffen Ramos und seine Jungs am Ort des Geschehens ein, um aufzuräumen, doch zu spät, die Gesuchten sind längst verschwunden. Die ganze Straße wimmelt wie ein Ameisenhaufen, alles schreit durcheinander, und Ramos hört heraus, dass die Polizei einen Barrera verhaftet hat.
Sicher Adán.
Nein, Raúl.
Scheißegal, denkt Ramos. Wichtig ist, welche Polizeieinheit ihn verhaftet hat und wohin sie ihn gebracht haben. Wenn es die Federales waren, haben sie ihn wahrscheinlich schon erschossen, wenn es die Provinzpolizei war, haben sie ihn in Sicherheit gebracht, doch wenn es die städtische Polizei war, hat Ramos vielleicht noch die Chance, einen Barrera-Bruder zu erwischen.
Sein Favorit ist Adán.
Raúl kommt gleich danach.
Ramos befragt die Augenzeugen, bis ihn ein Offizier der städtischen Polizei informiert, dass Zivile der städtischen Mordkommission einen der Barreras und zwei seiner Begleiter verhaftet haben.
Ramos springt ins Fahrzeug und rast los, zur Polizeistation.
Die Zigarre im Mundwinkel, die Uzi im Anschlag, stürmt er das Büro - und sieht jemanden durch die Hintertür verschwinden. Er will ihm einen Schuss nachschicken, aber ein Mann von der Mordkommission fällt ihm in den Arm.
»Bleib locker«, sagt der Mann.
»Wer zum Teufel war das?«, fragt Ramos.
»Wer zum Teufel war wer?«
»Der Kerl hat eben einen Haufen Polizisten erschossen«, sagt Ramos. »Oder ist euch das egal?«
Offenbar ja, denn die Jungs von der Mordkommission blockieren die Tür, um Raúl, Fabián und Callan entkommen zu lassen, und wenn sie sich dafür schämen, so lassen sie sich wenigstens nichts anmerken.
Adán verfolgt die Sache im Fernsehen.
Der Schlagabtausch von Sinaloa ist Thema des Tages.
Reporter berichten atemlos, Adán sei verhaftet worden - oder sein Bruder, je nachdem, welchen Sender er einschaltet. Aber alle Sender beklagen, dass schon wieder wehrlose Bürger im Herzen einer Großstadt Opfer von Schießereien zwischen rivalisierenden Drogenbanden wurden. Und dass endlich etwas getan werden muss, um der Gewalt zwischen den Drogenkartellen ein Ende zu bereiten.
Stimmt, denkt Adán. Irgendwas muss passieren. Mit viel Glück haben wir zwei Überfälle überstanden, aber wie lange können wir uns auf unser Glück verlassen?
Mit anderen Worten, wir sind am Ende.
Und wenn ich tot bin, wird Gúero Jagd auf Lucia und Gloria machen und sie abschlachten. Außer, ich kriege raus, wo Gúero seine neue Schlagkraft hernimmt - und kann etwas dagegen unternehmen.
Wo nimmt Gúero diese Schlagkraft her?
Ramos und seine Truppe stürmen ein Lagerhaus direkt an der Grenze. Der Tipp, den sie erhalten haben, erweist sich als wertvoll, sie finden stapelweise vakuumverpacktes Kokain. Ein Dutzend von Gúeros Leuten sind festgenommen und gefesselt, und Ramos bemerkt, dass sie verstohlene Blicke auf den Gabelstapler werfen, der in einer Ecke geparkt ist.
»Wo ist der Zündschlüssel?«, fragt Ramos den Verwalter.
»Im Schreibtisch.«
Ramos holt sich den Schlüssel, besteigt den Gabelstapler, fährt ein Stück zurück und traut seinen Augen nicht. Ein Schacht tut sich vor ihm auf. »Ich glaube, ich spinne!« ruft Ramos. Er springt ab, packt den Verwalter. »Sind da Leute drin? Irgendwelche Fallen?«
»Nein.«
»Wenn doch, komme ich zurück und leg dich um.«
»Ich schwöre.«
»Beleuchtung?«
»Si.«
»Anschalten!«
Fünf Minuten später klettert Ramos in den Schacht, in der einen Hand die Uzi, mit der anderen hält er sich an den Sprossen fest, die nach unten führen.
Zwanzig Meter tief.
Der Tunnel, aus Stahlbeton gebaut, ist etwa zwei Meter hoch und gut einen Meter breit. An der Decke ziehen sich Leuchtstoffröhren entlang, ein Gebläse sorgt für frische Luft. In den Boden sind schmale Gleise eingelassen, auf denen kleine Loren stehen.
»Jesus Christus!«, staunt Ramos. »Nur eine Lok fehlt - noch.«
Er macht sich auf den Weg durch den Tunnel, nordwärts, Richtung USA. Dann fällt ihm ein, dass er besser die andere Seite informieren sollte, bevor er die Grenze übertritt, und sei es unterirdisch. Er kehrt um und erledigt ein paar Anrufe. Zwei Stunden später macht er sich erneut auf den Weg durch den Tunnel, dicht gefolgt von Art Keller. Und hinter ihnen ein Trupp von der Taktischen Sondereinheit und eine Schar DEA-Agenten.
Auf der amerikanischen Seite erwartet sie ein ganzes Heer von Uniformierten: DEA, INS, ATF und Zoll. Sie stehen über das Gelände verteilt und warten darauf, den Tunnelausgang zu stürmen, sobald die exakte Position durchgegeben wird.
»Nicht zu glauben«, sagt Shag Wallace, als sie den Schacht hinabsteigen. »Da hat jemand richtig Geld angefasst.«
»Da hat jemand richtig Geld durchtransportiert«, antwortet Keller und wendet sich an Ramos. »Bist du sicher, dass es Méndez war, nicht die Barreras?«
»Gúero Mendez«, antwortet Ramos.
»Der hat wohl The Great Escape gesehen«, meint Shag.
»Sag mir Bescheid, wenn wir zur Grenze kommen«, sagt Ramos zu Keller.
»Da müsste ich raten«, erwidert Keller. »Mein Gott, wie lang ist denn das Ding?«
Fast fünfhundert Meter müssen sie laufen, bis der Tunnel an einem Schacht endet. Eiserne Sprossen führen hinauf zu einer verriegelten Luke.
Keller gibt die Position per GPS durch. Jetzt rollen die Truppen an.
»So«, sagt er und blickt den Schacht hinauf. »Wer will als Erster?«
»Das hier ist dein Hoheitsgebiet«, sagt Ramos.
Keller klettert also voran, Shag folgt ihm auf dem Fuße, beide halten sich mit einer Hand an der Leiter fest, während sie den Riegel öffnen.
Das muss ein ziemlicher Aufwand sein, denkt Keller, die Ware hier hinaufzuhieven. Wahrscheinlich bilden sie eine Kette auf der Leiter. Und planen schon den Lift.
Die Luke hebt sich, Licht fällt in den Schacht.
Keller entsichert seine Pistole und zwängt sich hoch.
Chaos.
Männer huschen umher wie Kakerlaken, wenn das Licht angeht, und die Jungs von der Eingreiftruppe sammeln sie ein, legen sie auf den Fußboden und fesseln ihnen mit Kabelbindern die Hände auf dem Rücken.
Eine Konservenfabrik, stellt Keller fest.
Drei schmucke Fließbandanlagen, Stapel leerer Dosen, Maschinen zum Verschließen und Etikettieren. Keller liest einen Aufkleber: Caliente Chili Peppers. Und da liegen tatsächlich Berge von roten Paprikaschoten, die darauf warten, aufs Fließband befördert zu werden.
Aber auch zu Ziegeln gepresstes Kokain.
Offenbar zur Eindosung bereit, denkt Keller.
Russ Dantzler begrüßt ihn mit den Worten: »Gúero Méndez - der liebe Onkel mit dem Puderzucker.«
»Wem gehört die Fabrik?«, fragt ihn Keller.
»Halt dich fest. Den Gebrüdern Fuentes.«
»Ist das dein Ernst?«
»Mein voller Ernst.«
Three Brothers Foods heißt ihre Firma. Nun ja. Die Gebrüder Fuentes besitzen großen Einfluss unter der mexikanischen Bevölkerung Kaliforniens und sind wichtige Sponsoren der Demokratischen Partei. Ihre Sattelschlepper verteilen Konserven aus San Diego und Los Angeles über die gesamten Staaten.
Ein perfektes Vertriebsnetz für Gúeros Kokain.
»Genial, nicht wahr?«, sagt Dantzler. »Sie bringen das Kokain durch den Tunnel in die Fabrik, verpacken es in Konservendosen und liefern es, wohin sie wollen. Ich frage mich, ob da auch Verwechslungen vorkommen - ob da jemand in Detroit eine Büchse Paprikaschoten kaufen wollte und stattdessen 350 Gramm Schnupfpulver bekam. Also was machen wir nun mit den Fuentes-Brüdern?
»Hochgehen lassen«, sagt Keller.
Das kann spannend werden, denkt er. Diese Brüder sind nicht nur Hauptsponsoren der Demokraten, sie unterstützen auch den Wahlkampf von Luis Donaldo Colosio.
Siebenunddreißig Sekunden später ist Adán informiert.
Jetzt wissen wir, wie Méndez sein Kokain über die Grenze bringt, denkt er. Er unterläuft sie einfach. Und wir wissen auch, woher er seine Schlagkraft bezieht. Er hat den Präsidentschaftsanwärter Colosio gekauft.
Das wär's dann also.
Gúero hat sich die Regierung gekauft, und wir sind erledigt. Dann klingelt das Telefon. Sal Scachi bietet ihm Hilfe an.
Als er die Bedingungen nennt, sagt Adán sofort nein. Es ist ein eindeutiges, unerschütterliches, absolutes Nein. Einfach undenkbar. Außer...
Adán nennt seine Gegenforderung.
Die Verhandlungen ziehen sich über Tage hin, aber am Ende sagt Scachi ja.
Jetzt muss alles schnell gehen.
Ist mir nur recht, denkt Adán.
Doch wir brauchen Leute, um das durchzuziehen.
Kinder, Halbwüchsige, Teenager.
Und die schaut sich Callan nun an.
Er sitzt in einem Keller von Guadalajara, das ganze Haus ist ein einziges Waffenlager. Nicht nur russische und amerikanische Sturmgewehre, auch schweres Geschütz: Maschinengewehre, Granatwerfer, dazu schusssichere Westen. Callan sitzt auf einem Alu-Klappstuhl und besieht sich die kleinen Chicano-Ganoven aus San Diego, die verfolgen, wie Raúl ein Foto an die Wand pinnt.
»Merkt euch diese Visage«, sagt Raúl. »Das ist Gúero Méndez.«
Die Teenies sind hingerissen. Erst recht, als Raúl mit theatralischer Geste in eine Tasche greift und Geldbündel auf dem Tisch aufstapelt.
»Fünfzigtausend amerikanische Dollar«, tönt Raúl. »In cash. Und das bekommt derjenige von euch, der ...«
Er macht eine Kunstpause.
»... Gúero Méndez den Todesschuss versetzt.«
Sie gehen auf Gúero-Jagd, erklärt er ihnen. Sie bilden kleine bewaffnete Auto-Konvois, machen sich auf die Suche nach Méndez, und wenn sie ihn aufspüren, setzen sie ihre geballte Feuerkraft ein, um ihn zur Hölle zu schicken. Wo er auch hingehört.
»Noch Fragen?«, ruft Raúl.
Ja, ein paar, denkt Callan. Zum Beispiel, wie soll es diese Kindertruppe mit Gúeros Profikillern aufnehmen? Ich meine, ist das unser letztes Aufgebot? Ist das alles, was das Barrera-Kartell mit all seinem Geld, mit all seinem Einfluss auf die Beine stellen kann? Einen Haufen minderjähriger Hobbyganoven aus San Diego?
Die sind doch ein einziger Witz, die tragen T-Shirts mit Aufschriften wie Flaco, Dreamer, Poptop oder - so wahr mir Gott helfe - Scooby Doo. Fabián hat sie direkt aus dem Barrio geholt, angeblich sind das eiskalte Killer, die sich ihre Lorbeeren schon verdient haben.
Kann ja sein, denkt Callan. Aber es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du mal kurz auf der Hasch-Party einer feindlichen Gang aufkreuzt oder ob du es mit einer Crew von Berufskillern aufnimmst.
Die pissen sich doch in die Hosen vor Panik und knallen sich gegenseitig ab, die schießen auf alles, was auch nur zuckt. Nein, Callan kann es nicht fassen: Was soll dieser Kinderkreuzzug? Was zum Teufel hat sich Raúl dabei gedacht? Das gibt ein gewaltiges Schlamassel, er kann nur hoffen, dass a) Méndez dadurch aufgescheucht wird und zur Strecke gebracht werden kann, b) dass er das erledigen kann, bevor er sich eine verirrte Kugel einfängt.
Dann fällt ihm ein, dass er selbst erst siebzehn war, damals in Hell's Kitchen, als er Eddie Friel erledigte. Klar, aber das war was anderes. Du warst anders. Diese Kids sehen mir nicht aus wie Killer.
Also will er Raúl am liebsten fragen: »Bist du besoffen? Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Aber er entscheidet sich für eine praktische Frage.
»Woher wissen wir überhaupt«, fragt Callan, »dass Méndez in Guadalajara ist?«
Weil ihn Parada darum gebeten hat.
Weil Adán Parada darum gebeten hat, Méndez darum zu bitten.
»Ich möchte Schluss machen mit der Gewalt«, erzählt er seinem alten Pfarrer.
»Dann hören Sie einfach auf«, erwidert Parada.
»Das ist eben nicht so einfach«, sagt Adán. »Deshalb brauche ich Ihre Hilfe.«
»Meine Hilfe? Was soll ich denn tun?«
»Zwischen uns und Gúero Frieden stiften.«
Adán weiß, dass er Paradas Schwachpunkt getroffen hat - dieser Bitte kann kein Geistlicher widerstehen.
Obwohl er nun eine schwierige Wahl treffen muss. Er ist kein Trottel, er weiß, dass er am Ende den Drogenkartellen dient, wenn es ihm wider jede Erwartung gelingt, eine Versöhnung herbeizuführen. So gesehen würde er - entgegen seinem Gelübde - dazu beitragen, das Böse zu verewigen. Andererseits hat er auch gelobt, das Böse zu besänftigen, und eine Einigung zwischen den beiden Kartellen könnte Gott weiß wie viele Morde verhindern. Und wenn er gezwungen ist, zwischen dem Übel des Drogenhandels und dem Übel des Tötens abzuwägen, bleibt ihm keine andere Wahl, als auf Adáns Bitte einzugehen. »Sie wollen also mit Gúero reden?«
»Ja«, sagt Adán. »Aber wo? Gúero kommt nicht nach Tijuana, und ich fahre nicht nach Culiacán.«
»Würden Sie nach Guadalajara kommen?«
»Wenn Sie für meine Sicherheit garantieren können.«
»Würden Sie dann für Gúeros Sicherheit garantieren?«
»Ja«, sagt Adán. »Aber nur, solange er für meine Sicherheit garantiert.«
»Das war nicht meine Frage«, sagt Parada ungeduldig. »Meine Frage war, ob Sie mir versprechen können, dass Sie ihm nicht das Geringste antun.«
»Ich schwöre es. Bei meiner Seele.«
»Ihre Seele, Adán, ist schwärzer als die Hölle.«
»Immer eins nach dem anderen, Padre.«
Parada versteht die Botschaft. Ein einziger Lichtstrahl, der ins Dunkel dringt, kann vielleicht irgendwann die ganze Seele erleuchten. Wenn ich nicht daran glauben würde, denkt er, wäre es aus mit mir. Wie kann ich mich also verweigern, wenn mich dieser Mann, der so viele Menschen auf dem Gewissen hat, um einen Lichtstrahl bittet?
»Ich werde es versuchen, Adán«, sagt er. Aber leicht wird es nicht, denkt er beim Auflegen des Hörers. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Fehde zwischen den beiden Kartellen gehört habe, ist es so gut wie aussichtslos, Gúero zu einem Friedensschluss mit den Barreras zu bewegen. Doch es könnte auch sein, dass er all des Mordens müde ist.
Es kostet ihn drei volle Tage, überhaupt zu Méndez durchzudringen. Er telefoniert mit alten Bekannten in Culiacán und streut die Nachricht aus, dass er mit Gúero reden will. Drei Tage später ruft Gúero bei ihm an.
Parada hält sich nicht mit Vorreden auf: »Adán Barrera will Frieden mit Ihnen schließen.«
»Ich bin nicht an Frieden interessiert.«
»Das sollten Sie aber.«
»Er hat meine Frau und meine Kinder ermordet.«
»Dann ist es umso dringlicher.«
Gúero sieht zwar keine Logik darin, aber er sieht eine Gelegenheit. Während ihn also Parada bearbeitet, zu einem Treffen in Guadalajara drängt, an einem öffentlichen Ort, mit ihm selbst als Vermittler, während er ihm mit dem »ganzen moralischen Gewicht der Kirche« seine Sicherheit garantiert, wittert Gúero die Chance, die Barreras aus ihrer Festung herauszulocken. Schließlich ist der Anschlag in La Sirena gescheitert, und mit San Diego hat er nun auch gewaltigen Ärger bekommen.
Also hört er zu, während der Priester ununterbrochen auf ihn einredet, ihm versichert, dass auch seine Frau und seine Kinder den Frieden gewollt hätten, er zerdrückt sogar eine Krokodilsträne und erklärt sich dann mit erstickter Stimme zu einem Treffen bereit.
»Ich werde es versuchen, Padre«, sagt er leise. »Ich ergreife die Chance, Frieden zu schließen. Können wir zusammen beten, Padre. Geht das auch telefonisch?«
Und während Parada von Jesus Christus erfleht, dass er die beiden Kontrahenten mit dem Licht des Friedens erfülle, erfleht sich Gúero von Santo Jesús Malverde etwas ganz anderes.
Es diesmal nicht zu vermasseln.
Raúl wird es gewaltig vermasseln, denkt Callan, wenn er sich dieses Spektakel ansieht, das er in Guadalajara mit seiner Chaostruppe veranstaltet. Es ist einfach nur lächerlich, im Konvoi durch die Stadt zu fahren, wie eine Formation von Schlachtschiffen, um das Feuer zu eröffnen, falls sie Gúero aufspüren.
Callan darf sich als Meister seines Fachs bezeichnen. Er ist der Mann, der zwei der »Fünf Familien« um ihre Oberhäupter gebracht hat, und er will Raúl erklären, wie man es macht. (»Wenn du rauskriegst, wann er wo sein wird, bist du vorher da und lauerst ihm auf.«) Aber Raúl hört ihm nicht zu, ist stur wie ein Bock, fast so, als wollte er das Fiasko absichtlich herbeiführen. Er lächelt nur und sagt: »Bleib cool, Mann, und halt dich bereit, wenn's losgeht.«
Eine ganze Woche lang kreuzt die Armada der Barreras durch die Stadt, Tag und Nacht, immer auf der Suche nach Gúero Méndez. Andere sind währenddessen mit Lauschen beschäftigt. Raúl hat Spezialisten angeheuert, die die allerneueste Technik nutzen, um den Handy-Verkehr abzuhören und Botschaften abzufangen, die Gúero mit seinen Leuten austauscht.
Gúero steht ihm in nichts nach. Auch er hat seine Technik-Freaks, die versuchen sollen, den Handy-Verkehr der Barreras zu überwachen. Beide Seiten spielen dieses Spiel, wechseln ständig die Handys und die Schlupfwinkel, beobachten die Straßen und den Funkverkehr und versuchen gegenseitig, sich aufzuspüren und zu vernichten, bevor Parada das Friedenstreffen ansetzt, das nur zu einer hochriskanten Schießerei ausarten kann.
Beide Seiten sind eifrig hinter Informationen her, die ihnen einen strategischen Vorteil verschaffen könnten - welche Wagen der Feind fährt, wie viele Leute er in der Stadt hat, wer sie sind, mit welchen Waffen sie sich ausrüsten, wo sie sich verstecken, welche Strecken sie fahren. Sie haben Spione ausgesandt, die ermitteln sollen, welche Polizisten von wem geschmiert werden, wann sie im Dienst sind, ob sich Federales in der Stadt aufhalten, und wenn ja, wo.
Beide Seiten hören Paradas Telefongespräche ab. Vor allem wollen sie in Erfahrung bringen, wo er das Friedenstreffen ansetzt, damit sie dem Gegner zuvorkommen können. Aber der Kardinal lässt keinen in die Karten gucken, aus ebendiesem Grund, und weder Méndez noch die Barreras wissen Genaues.
Rauls Abhörspezialist landet dennoch einen Treffer.
»Gúero benutzt einen grünen Buick«, berichtet man Raúl.
»Einen Buick?«, fragt Raúl mit Abscheu. »Woher weißt du das?«
»Sein Fahrer hat eine Werkstatt angerufen. Wollte wissen, wann der Buick fertig ist. Ein grüner Buick.«
»Welche Werkstatt?«
Als sie dort ankommen, ist der Buick schon abgeholt worden. Also geht die Suche weiter. Tag und Nacht.
Adán bekommt einen Anruf von Parada.
»Morgen um vierzehn Uhr dreißig im Hidalgo Airport Hotel«, sagt Parada. »Wir treffen uns in der Lobby.«
Adán weiß schon Bescheid, weil er das Gespräch abhören ließ, das Paradas Chauffeur mit seiner Frau führte, um den Ablauf des nächsten Tages zu besprechen. Und das Gespräch bestätigt, was Adán ebenfalls schon wusste - dass Kardinal Antonucci um dreizehn Uhr dreißig aus Mexico City einfliegen und Parada ihn vom Flughafen abholen wird. Sie wollen sich im Hotel zu einer Besprechung treffen, dann wird Antonucci von Paradas Fahrer zum Flughafen zurückgebracht, und Parada bleibt im Hotel - um die Friedensverhandlungen zwischen Méndez und Adán zu leiten.
Adán weiß das schon länger, aber es hat keinen Sinn, Raúl früher als nötig zu informieren.
Aus gutem Grund hat er sich mit seinen Leuten von Raúl separiert und seinen eigenen Schlupfwinkel eingerichtet. Jetzt geht er in den Keller, wo er sein Killerkommando untergebracht hat. Diese Sicarios hat er in den letzten Tagen einfliegen lassen, aus verschiedenen Richtungen, er hat sie unauffällig vom Flughafen abgeholt und im Keller einquartiert. Die Mahlzeiten werden in kleinen Stückzahlen bei verschiedenen Restaurants bestellt oder oben in der Küche zubereitet. Keiner darf das Haus verlassen. Alles läuft äußerst professionell. Ein Dutzend Uniformen der Provinzpolizei von Jalisco liegen ordentlich aufgestapelt auf den Tischen. Schusswesten und Sturmgewehre sind einsatzbereit.
»Der Ablauf wie besprochen«, sagt Adán zu Fabián. »Sind deine Leute bereit?«
»Ja.«
»Jetzt darf nichts schiefgehen.«
»Keine Sorge.«
Adán nickt und überreicht ihm ein Handy, von dem er weiß, dass es abgehört wird. Fabián tippt eine Nummer ein, sagt: »Es geht los. Seid dreizehn fünfundvierzig vor Ort« und schaltet es aus.
Gúero empfängt die Nachricht zehn Minuten später. Den Anruf von Parada hat er schon erhalten, jetzt auch die Bestätigung, dass ihnen Adáns Leute am Flughafen auflauern werden.
»Ich denke, wir fahren ein bisschen früher los«, sagt Gúero zu seinen Sicarios.
Die Abfänger abfangen.
Bei Raúl klingelt das sichere Handy - Adán gibt ihm Bescheid. Raúl geht hinunter in den Schlafraum und weckt die schlafenden Jungs.
»Alles abgeblasen«, verkündet er. »Morgen geht's zurück nach Hause.«
Die Jungs sind sauer, enttäuscht, der süße Traum von coolen fünfzigtausend Dollars geht den Bach runter. Warum denn?, wollen sie wissen.
»Keine Ahnung«, sagt Raúl. »Ich glaube, er hat rausgekriegt, dass wir ihm auf den Fersen sind, und ist zurück nach Culiacán. Regt euch nicht auf, das nächste Mal klappt's dann.«
Raúl muss sie ein bisschen aufmuntern. »Wisst ihr was? Wir fahren früher los und machen einen Abstecher zur Mall.«
Ein kleiner Trost, aber wenigstens etwas. Die Mall im Zentrum von Guadalajara gehört zu den größten der Welt. Schon fangen sie an, sich zu erzählen, was sie dort kaufen wollen.
Raúl geht mit Fabián nach oben.
»Du weißt, was du zu tun hast?«
»Klar.«
»Und hast du den Nerv?«
»Klar hab ich den.«
Oben geht Raúl zu Callan ins Zimmer.
»Morgen fliegen wir zurück nach Tijuana«, sagt er.
Callan atmet auf. Die ganze Sache war sowieso verkorkst, von Anfang an.
Raúl gibt ihm die Flugtickets. »Gúero will uns heute am Flughafen abfangen«, sagt er wie nebenbei. »Wie meinst du das?«
»Er denkt, wir wollen Frieden mit ihm schließen«, sagt Raúl. »Er denkt, unsere Mannschaft besteht aus einem Haufen Kids, und er kann uns einfach niedermähen.«
»Da denkt er richtig.«
Raúl schüttelt den Kopf und grinst triumphierend. »Wir haben dich, und wir eine ganze Killer-Crew in Uniformen der Provinzpolizei.«
Na gut, denkt Callan. Das beantwortet wenigstens die Frage, was die Barreras mit den Kids vorhatten. Die dienten nur als Köder.
Und du auch.
»Halt die Augen offen und das Pulver trocken«, ermahnt ihn Raúl.
Das braucht er mir nicht zu sagen, denkt Callan. Die meisten Toten, die er kennt, sind deshalb tot, weil sie das nicht beherzigt haben. Sie sind leichtsinnig geworden, oder sie haben den falschen Leuten vertraut.
Callan wird nicht leichtsinnig.
Und er vertraut keinem.
Parada vertraut allein auf Gott.
Er steht früher auf als sonst, geht hinüber zur Kathedrale und liest die Messe. Vorm Altar kniend bittet er Gott um Beistand, um die Weisheit, an diesem besonderen Tag das Rechte zu tun. Und beendet sein Gebet mit »Dein Wille geschehe«.
Wieder in der Residenz, rasiert er sich noch einmal und wählt seine Kluft - mit besonderer Sorgfalt. Denn schon sein Auftritt enthält eine Botschaft für Antonucci. Und Parada möchte die richtige Botschaft aussenden.
Seltsamerweise ist in ihm eine Hoffnung aufgekeimt, die Hoffnung auf eine Versöhnung mit der Kirche. Warum auch nicht? Wenn Adán und Gúero Frieden schließen können, dann können es auch Antonucci und Parada. Es ist lange her, dass er so viel lebendige Hoffnung verspürt hat. Wenn diese Regierung durch eine bessere abgelöst wird, können vielleicht auch Konservative und Befreiungstheologen aufeinander zugehen. Wege der Zusammenarbeit suchen, für eine gerechtere Welt und den Segen Gottes.
Er zündet eine Zigarette an und macht sie gleich wieder aus.
Ich sollte lieber aufhören, denkt er. Und sei's nur, um Nora eine Freude zu machen. Genau der richtige Tag. Ein Tag des Neubeginns.
Er wählt eine schwarze Soutane und legt ein großes Kreuz an. Gerade genug, um Antonucci gnädig zu stimmen, aber nicht so zeremoniell, dass Antonucci auf die Idee kommen könnte, er sei zu den Konservativen umgeschwenkt. Entgegenkommend, aber nicht servil, denkt er, zufrieden mit seiner Wahl.
Gott, wie gut täte mir jetzt eine Zigarette! Er hat richtig Lampenfieber wegen seiner heutigen Begegnungen. Antonucci muss über die ungeheuerlichen Enthüllungen Cerros informiert werden, dann muss er auch noch zwischen Adán und Gúero vermitteln. Wie schaffe ich es, Frieden zu stiften? Frieden zwischen einem Mann, dessen Familie ermordet wurde, und einem, der, Gerüchten zufolge, der Mörder seiner Familie ist?
Vertrau nur auf Gott. Er wird dir die rechten Worte eingeben.
Aber eine Zigarette wäre jetzt doch angebracht.
Nein, kommt nicht in Frage.
Und ein paar Pfunde muss ich auch abwerfen.
In einem Monat fährt er zur Bischofskonferenz nach Santa Fe, dort will er Nora treffen. Das wird ein Spaß, denkt er, ihr als schlanker Nichtraucher entgegenzutreten. Na gut, vielleicht nicht schlank, aber ein bisschen schlanker.
Ein paar Stunden widmet er sich seiner Büroarbeit, dann sagt er dem Fahrer Bescheid und holt den Aktenkoffer mit Cerros Dokumenten aus dem Safe.
Es wird Zeit, zum Flughafen zu fahren.
In Tijuana bereitet Padre Rivera eine Taufe vor. Legt die Soutane an, segnet das Weihwasser und füllt sorgfältig die Papiere aus. Als Letztes trägt er die Taufpaten ein. Adán und Lucía Barrera.
Als die Eltern mit dem Täufling kommen, tut Rivera etwas Ungewöhnliches.
Er schließt die Kirchentür.
Vorm Flughafengebäude steht die Kindercrew von Raúl Barrera.
Beladen mit Einkaufstüten, als hätten sie es darauf abgesehen, die ganze Mall leerzukaufen. Raúl hat ein bisschen Geld verteilt, um sie über die abgeblasene Jagd mit Abschussprämie hinwegzutrösten. Und sie haben getan, was Kinder eben tun, wenn sie Geld in der Tasche haben.
Sie haben es ausgegeben.
Callan sieht den Trupp und schüttelt den Kopf.
Flaco trägt ein Fußballtrikot von Chivas Rayadas del Guadalajara, das Preisschild baumelt noch am Kragen. Außerdem hat er zwei Paar Nikes erstanden, einen neuen Nintendo Gameboy und ein halbes Dutzend Spiele dazu.
Dreamer hat alles in Klamotten angelegt. Drei neue Basecaps, eine über die andere gestülpt, thronen auf seinem Kopf, gekauft hat er auch eine Wildlederjacke und einen Anzug - seinen ersten -, den er ordentlich zusammengefaltet in einer Kleidertasche trägt.
Scooby Doo war die ganze Zeit im Spiele-Center. Dieser Klebstoffschnüffler, denkt Callan, hatte doch schon vorher einen glasigen Blick, und jetzt ist es noch schlimmer, weil er zwei geschlagene Stunden lang Tomb Raider, Mortal Kombat und Assassin 3 gespielt hat und seitdem an einem riesigen Slurpee nuckelt.
Poptop ist besoffen. Während die anderen shoppen waren, hat er sich ein Bier nach dem anderen reingeschüttet, und als sie ihn endlich fanden, war es zu spät. Zu dritt mussten sie ihn in den Van schleifen, der sie zum Flughafen brachte, und unterwegs wurde dreimal gehalten, damit er sich ordentlich auskotzen konnte.
Und jetzt findet dieser Hosenscheißer sein Flugticket nicht, sie müssen seinen Rucksack durchwühlen, in der Hoffnung, dass er es irgendwo verkramt hat.
Na toll, denkt Callan. Wenn wir Gúero Méndez weismachen wollten, dass wir eine lahme Truppe sind, haben wir ganze Arbeit geleistet.
Da haben wir also einen Haufen Kids mit Bergen von Gepäck und Einkaufsbeuteln. Die hängen hier vor dem Terminal ab, und Raúl versucht, Ordnung in die Bande zu bringen, während Adán mit seinen Leute anrückt. Das Ganze sieht aus wie das chaotische Ende einer Klassenfahrt. Die Kids lachen und blöken sich gegenseitig an, Raúl verhandelt mit dem Bodenpersonal, ob sie gleich hier am Außenschalter einchecken können oder ob sie ihr ganzes Gepäck in die Halle schleppen müssen. Dreamer trottet los, um nach Gepäckkarren zu suchen, und brüllt Flaco zu, er soll mitkommen, und Flaco brüllt Poptop an: »Wo hast du dein Ticket, du Blödmann!«, worauf Poptop ein Gesicht macht, als müsste er gleich wieder kotzen, aber was da aus seinem Mund spritzt, ist keine Kotze, das ist Blut.
Callan liegt schon flach am Boden, im Blick einen grünen Buick, aus dessen Seitenfenstern Gewehrläufe ragen. Er zieht seine 22er, gibt zwei Schüsse auf den Buick ab und rollt sich hinter einem geparkten Auto in Deckung, während eine Kalaschnikow-Salve dort auftrifft, wo er eben noch lag, vom Beton abprallt und die Außenmauer des Terminals verziert.
Der saudumme Scooby Doo steht einfach nur da, nuckelt an seinem Slurpee-Strohhalm und staunt über dieses Videogame mit der unheimlich realistischen Graphik. Im Moment fragt er sich, ob sie die Mall überhaupt verlassen haben und wie dieses supergeile Game heißt. Callan wagt sich kurz aus der Deckung, reißt Scooby zu Boden, sein Slurpee klatscht auf den Betonweg, und da es ein Himbeer-Slurpee ist, kann man ihn kaum von Poptops Blut unterscheiden, das sich ebenfalls über den Beton ergießt.
Raúl, Fabián und Adán lassen ihre schwarzen Reisetaschen fallen, holen ihre Kalaschnikows raus und nehmen den Buick unter Feuer.
Die Kugeln prallen ab - sogar von der Frontscheibe -, Callan merkt, dass der Buick gepanzert ist, setzt noch zwei Schuss ab und lässt sich wieder fallen. Jetzt öffnen sich die linken Türen des Buick, Gúero und zwei seiner Leute mit Kalaschnikows steigen aus, benutzen den Buick als Deckung und ballern drauflos.
Callan wird taub, er kann nichts mehr hören, in ihm ist völlige Stille, während er sorgfältig auf Gúeros Kopf zielt und gerade im Begriff ist, abzudrücken - als sich ein weißes Auto in die Schusslinie schiebt. Der Fahrer scheint gar nicht zu merken, was hier läuft, scheint zu glauben, hier wird mal wieder ein Film gedreht, und fährt genervt durchs Setting, weil er nun mal zum Flughafen will. Ein paar Meter vor dem Buick parkt er ein. Was Fabián zu alarmieren scheint.
Er läuft auf die weiße Limousine zu, vorbei am Buick, und nimmt sie unter Beschuss, offenbar in der Annahme, dass sie Verstärkung für Gúero bringt, und Callan will ihm Feuerschutz geben, aber die weiße Limousine steht genau in seiner Schusslinie, also schießt er lieber nicht, für den Fall, dass dort irgendwelche Zivilisten drinsitzen und nicht Gúeros Sicarios.
Aber jetzt wird der Buick von der anderen Seite unter Feuer genommen, von falschen Provinzpolizisten, wie Callan sieht, sie zwingen Gúero und seine Männer, hinter dem Buick Deckung zu suchen, so dass Fabián seinen Sturmlauf unbeschadet fortsetzen kann.
Parada sieht ihn nicht mal kommen, sein Blick ist auf die blutige Szene gerichtet, die sich vor ihm abspielt. Überall liegen Menschen, einige reglos, andere kriechen auf dem Bauch, schleppen die Beine nach, er kann so schnell gar nicht unterscheiden, wer tot ist, wer verwundet oder wer nur Schutz vor den Kugeln sucht, die aus allen Richtungen kommen. Er sieht einen jungen Mann, direkt neben ihm auf dem Bürgersteig, er liegt auf dem Rücken, aus seinem Mund quellen blutige Schaumblasen, seine Augen sind aufgerissen vor Schmerz und Panik. Ein Sterbender, denkt Parada. Er will aussteigen, ihm die Sakramente erteilen.
Pablo, sein Fahrer, hält ihn fest, aber er ist ein schmächtiges Kerlchen, Parada schüttelt ihn einfach ab und brüllt »Verschwinde von hier!« Pablo will ihn nicht im Stich lassen. Er duckt sich unters Steuer, so tief es geht, hält sich die Ohren zu, während Parada aussteigt. Während Fabián auf ihn zugerannt kommt und mit dem Gewehr auf seine Brust zielt.
Callan sieht es.
Du Idiot, denkt er, das ist der Falsche. Er sieht, wie sich der beleibte Parada aus dem Auto zwängt, sich aufrichtet und zu Poptop will, er sieht, wie ihm Fabián den Weg versperrt und seine Kalaschnikow hebt. Callan springt auf und brüllt »NEIN!«
Springt über die Motorhaube, rast auf Fabián zu, brüllt »FABIAN, NEIN! DOCH NICHT IHN!«
Fabián wirft einen Seitenblick auf Callan, und Parada nutzt die Gelegenheit, den Gewehrlauf zu packen und nach unten zu drücken. Fabián will das Gewehr losreißen, drückt dabei ab und trifft Parada in den Knöchel, mit dem nächsten Schuss ins Knie, aber Parada ist in Rage, er scheint es nicht mal zu spüren, und das Gewehr lässt er nun erst recht nicht los.
Weil er leben will. Sein Lebenswille ist stärker als je zuvor, das Leben ist gut, weiß er, die Luft ist herrlich, es gibt noch so viel zu tun. Er will zu diesem sterbenden jungen Mann und seiner Seele Frieden schenken. Er will Jazz hören. Will Nora lächeln sehen, will noch eine Zigarette, eine gute Mahlzeit genießen. Er will niederknien, mit dem Herrn im Gebet vereint. Aber nicht mit ihm gehen, noch nicht, zu viel zu tun, er muss kämpfen. Klammert sich mit seinem ganzen Leben an den Gewehrlauf.
Fabián hebt den Fuß, tritt dem Bischof gegen die Brust, dass er rückwärts taumelt, gegen das Auto, dann feuert er eine Salve auf ihn ab.
Parada spürt, wie das Leben aus ihm weicht, während er neben dem Auto niedersinkt.
Callan kniet sich neben den sterbenden Priester.
Der schaut zu ihm auf und murmelt etwas, was Callan nicht versteht.
»Wie?«, fragt er. »Was haben Sie gesagt?«
»Ich vergebe dir«, sagt Parada.
»Wie?«
»Gott vergibt dir.«
Der Priester macht das Kreuzzeichen, dann sackt seine Hand nach unten, ein letztes Zucken durchfährt ihn.
Callan kniet neben dem toten Priester, als Fabián das Gewehr hebt und Parada zweimal seitlich in den Kopf schießt. Blut spritzt gegen den weißen Autolack. Zusammen mit Büscheln weißen Haars.
Callan dreht sich zu ihm um und sagt: »Er war schon tot.«
Fabián ignoriert ihn, er beugt sich ins Auto, nimmt einen Aktenkoffer vom Beifahrersitz und geht mit ihm davon. Callan sitzt neben Parada, hält seinen zerschmetterten Schädel in den Armen und weint wie ein Kind. »Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt?«
Die Schlacht, die um ihn tobt, nimmt er nicht mehr wahr.
Adán hingegen kriegt nicht mit, dass Parada erschossen wurde, er ist damit beschäftigt, die Exekution von Gúero Méndez zu vollenden, der sich hinter den Buick duckt und gerade begreift, dass der Kampf verloren ist. Zwei seiner Leute sind hinüber und auch das Auto, trotz aller Panzerung, es erzittert unter dem Geprassel der Schüsse, die es treffen, es wird nicht mehr lange standhalten. Mehrere Scheiben sind geborsten, die Reifen sind zerschossen, und es ist nur eine Frage der Zeit, dass der Tank explodiert. Die Barreras mit ihren falschen Polizisten bilden eine erdrückende Übermacht, und das mit der Kindertruppe war genau das, was er vermutet hat - Blödsinn. Sie haben ihn von drei Seiten eingekreist, und wenn sie den Kreis schließen, ist es vorbei, dann fährt er zur Hölle. Wäre ihm nur recht, wenn er Adán und Raúl mitnehmen könnte, aber das wird nicht klappen, also gibt's jetzt nur eins: Schnell weg von hier und auf ein nächstes Mal hoffen.
Aber wegzukommen ist gar nicht so leicht. Es gibt nur eine winzige Chance. Er holt eine Tränengasgranate vom Rücksitz des Wagens, wirft sie übers Dach in Richtung der Barreras und brüllt seinen vier verbliebenen Sicarios zu, dass sie loslaufen sollen, was sie auch tun, am Terminal entlang, nach hinten schießend.
Adáns Mannschaft hat eine Menge Hardware, aber Gasmasken sind nicht dabei, sie husten und röcheln, Adáns Augen brennen wie Feuer, er will sich unbedingt auf den Beinen halten, aber dann sieht er ein, dass es keine gute Idee ist, erstens, weil er nichts sieht, zweitens, weil ihm die Kugeln um die Ohren fliegen, also geht er in die Knie.
Raúl gibt nicht auf. Mit flammenden Augen, brennender Nase setzt er, aus der Hüfte schießend, der fliehenden Méndez-Mannschaft nach. Eine seiner Salven trifft Gúeros wichtigsten Mann in den Rücken und wirft ihn um, aber Raúl muss tatenlos zusehen, wie Gúero ein Taxi kapert, den Fahrer hinauswirft und mit Vollgas davonprescht, kaum dass seine drei verbliebenen Sicarios zu ihm ins Taxi gesprungen sind.
Raúl schießt auf das Auto, aber er verfehlt die Reifen, und Gúero verlässt den Parkplatz mit eingezogenem Kopf, während ihm Adáns falsche Polizisten einen Kugelhagel nachsenden.
»Du verdammter Hurensohn!«, brüllt ihm Raúl nach.
Er dreht sich um und sieht Callan neben dem toten Bischof sitzen.
Erst denkt er, Callan wurde getroffen. Der Mann heult und ist über und über mit Blut beschmiert, und Raúl mag alles mögliche sein, aber er ist nicht undankbar. Er weiß, wie viel er Callan zu verdanken hat, also hockt er sich neben ihn und will ihm hochhelfen.
»Komm schon!«, brüllt er, »wir müssen weg!« Callan antwortet nicht.
Er stößt ihn mit dem Gewehrkolben an, dann zieht er ihn kurzerhand hoch, stellt ihn auf die Füße und zerrt ihn Richtung Terminal. »Beeilung!«, schreit er in die Runde. »Das Flugzeug wartet nicht!«
Draußen auf der Rollbahn steht die Aeromexico, Flug Nr. 211 nach Tijuana, mit fünfzehn Minuten Verspätung. Aber sie wartet.
Die falschen Polizisten streifen ihre Uniformen ab und stehen plötzlich in Zivil da, sie legen ihre Waffen auf den Boden und gehen ganz gemächlich zum Abflugschalter. Dann kommen die Barreras mit den Überlebenden der Kindercrew und den Profis in die Halle. Sie müssen über Leichen steigen - nicht nur Poptop und die zwei Sicarios von Méndez mussten dran glauben, auch sechs Unbeteiligte. Die Halle ist ein einziges Chaos. Menschen weinen und schreien, Sanitäter arbeiten sich zu Verwundeten durch, und mitten im Durcheinander steht Kardinal Antonucci und ruft: »Beruhigen Sie sich doch! Beruhigen Sie sich doch!
Was ist denn passiert? Kann mir jemand sagen, was hier passiert ist?«
Er hat Angst, hinauszugehen, sich mit eigenen Augen zu überzeugen, er hat ein unangenehmes Gefühl im Magen, es ist wirklich ein Skandal, ihn einer solchen Lage auszusetzen. Scachi hatte nicht mehr von ihm verlangt, als zum Treffen mit Parada zu fahren, und nun wird er hier mit solchen Szenen konfrontiert. Und ist beschämt und erleichtert zugleich, als ein junger Mensch an ihm vorbeiläuft und seine Frage beantwortet.
»Wir haben Gúero Méndez fertiggemacht! El Tiburón hat ihn fertiggemacht!«
Der Barrera-Trupp geht in aller Ruhe auf das Flugzeug zu und bildet eine ordentliche Schlange, damit alle ihre Tickets zeigen können, wie bei jedem normalen Flug. Sie erhalten ihre Bordkarten, steigen die Gangway hinauf und betreten das Flugzeug. Adán Barrera trägt immer noch seine Reisetasche mit der Kalaschnikow, aber die geht als normales Handgepäck durch, zumal er Business Class fliegt.
Probleme hat nur Raúl, weil er den bewusstlosen Callan auf der Schulter trägt.
Die Stimme der Flugbegleiterin zittert, als sie sagt: »So kann der Mann nicht an Bord.«
»Er hat ein Ticket«, sagt Raúl.
»Aber -«
»Business Class.« Er überreicht ihr das Ticket und geht an ihr vorbei, die Gangway hoch. Findet Callans reservierten Platz und lässt ihn auf den Sitz plumpsen, dann breitet er eine Decke über sein blutverschmiertes Hemd und sagt zu der geschockten Stewardess: »Zu viel gefeiert.«
Adán setzt sich neben Fabián, der zum Cockpit hinüberruft: »Worauf wartet ihr?«
Der Pilot schließt einfach die Kabinentür.
Als das Flugzeug landet, werden sie von Flughafenpolizei empfangen und durch einen gesonderten Ausgang zu bereitstehenden Fahrzeugen eskortiert. Und Raúl gibt nur einen einzigen Befehl aus.
Verdrückt euch.
Callan weiß auch so, was er zu tun hat.
Er lässt sich vor seinem Haus absetzen, geht unter die Dusche, zieht sich saubere Sachen an, steckt sein Geld ein und nimmt ein Taxi zum Grenzübergang San Ysidro. Er läuft zu Fuß über die Brücke und betritt die Vereinigten Staaten. Einer von vielen Gringos, die sich auf der Avenida Revolución die Kante gegeben haben.
Neun Jahre war er weg.
Jetzt ist er zurück in einem Land, wo er als Sean Callan zur Fahndung ausgeschrieben ist, wegen organisierter Kriminalität, Drogenhandel, räuberischer Erpressung und Mord. Es ist ihm schon egal. Lieber hier als eine Minute länger in Mexiko. Er steigt in den knallroten Shuttle und fährt bis ins Zentrum von San Diego.
Anderthalb Stunden später hat er ein Waffengeschäft gefunden, in der Fourth, Ecke J, wo er im Hinterzimmer eine 22er bekommt, ohne seine Papiere zu zeigen. Dann besorgt er sich eine Flasche Scotch und mietet sich für eine Woche in einem Billighotel ein.
Schließt die Tür ab und fängt an zu trinken. Ich vergebe dir, hat der Priester gesagt. Gott vergibt dir.
Nora ist in ihrem Schlafzimmer, als sie die Nachricht hört.
Sie liest, im Hintergrund läuft CNN, als sie einen Satzfetzen aufschnappt: »... gleich mehr über den tragischen Tod des höchstrangigen mexikanischen Geistlichen. Bleiben Sie dran.«
Ihr bleibt das Herz stehen, in ihrem Kopf hämmert es, sie tippt während des endlosen Werbeblocks immer von neuem die Kurzwahl von Juans Nummer ein, hofft und betet, dass er abnimmt, dass nicht er gemeint ist, dass er sich meldet - bitte, lieber Gott, mach, dass nicht er es ist -, aber als die Nachrichten weiterlaufen, sieht sie ein altes Foto von ihm, das über die Aufnahmen vom Flughafen geblendet wird. Sie sieht ihn auf dem Bürgersteig liegen.
Sie will schreien, doch es kommt kein Laut.
An normalen Tagen tummeln sich auf den vier Plätzen von Guadalajara die Touristen. Man sieht verliebte Pärchen, Büroangestellte verbringen hier ihre Mittagspause. An normalen Tagen ist die Kathedrale umgeben von Trödlern, die Kreuze feilbieten, Rosenkranzkarten, Gipsheilige und milagros - winzige Tonskulpturen von Knien, Ellbogen und anderen Körperteilen, die geheilte Kranke als Votivgaben in der Kathedrale zurücklassen.
Aber heute ist kein normaler Tag. Heute findet die Trauermesse für Kardinal Parada statt, heute haben sich unter den gelb gekachelten Türmen Tausende von Trauernden versammelt. Über die Plaza winden sich Schlangen von Wartenden, die am Sarg des Märtyrers Parada vorbeidefilieren wollen.
Sie kommen aus ganz Mexiko. Die Städter in teuren Anzügen und zurückhaltend modischer Garderobe, die Campesinos in weißen Hemden und einfachen Kleidern. Auch aus Culiacán und Badiraguato sind Trauernde gekommen, die man an ihrer Cowboykluft erkennt. Viele wurden von Parada getauft, erstkommuniziert, getraut oder haben mit ihm die Eltern zu Grabe getragen, als er noch ein ländlicher Pfarrer war. Auch Regierungsvertreter sind erschienen, in grauen und schwarzen Anzügen, Priester und Bischöfe in ihrer geistlichen Tracht und Hunderte Nonnen im Habit ihres Ordens.
An normalen Tagen ist die Plaza voller Lärm - dem Geschnatter der mexikanischen Passanten, dem Geschrei der Händler, dem Gedudel der Straßenkapellen, aber heute herrscht beklemmende Stille. Außer Gebetsgemurmel ist nichts zu hören - nur vielleicht noch das etwas dumpfere Geraune über eine Verschwörung.
Denn nur wenige glauben der offiziellen Verlautbarung, dass Parada einer Verwechslung zum Opfer fiel, dass er von den Sicarios der Barreras für Gúero Méndez gehalten wurde.
Aber heute wird darüber nur leise getuschelt. Heute ist der Tag der Trauer, und die Tausende, die langsam auf die Kathedrale vorrücken, tun dies mit Schweigen und in leisem Gebet.
Art Keller ist einer von ihnen.
Je mehr er über den Mord an Parada erfährt, umso drängender die Fragen. Parada saß in einer weißen Marquis-Limousine, Méndez in einem grünen Buick. Parada trug eine schwarze Soutane mit großem Brustkreuz (das jetzt fehlt), Méndez war in seiner Cowboykluft erschienen.
Wie konnte man einen zweiundsechzigjährigen, weißhaarigen Zweimetermann in Soutane mit einem blonden, etwa einssiebzig großen Drogenbaron in Cowboykluft verwechseln? Aus allernächster Nähe? Konnte sich ein erfahrener Killer wie Fabián Martínez so sehr irren? Warum hatte das Flugzeug gewartet? Wie konnten die Barrera-Brüder mit all ihren Sicarios unbehelligt an Bord gelangen? Warum wurden sie nach der Landung in Tijuana von der Polizei aus dem Flughafen eskortiert?
Und warum war ein Padre Rivera in Tijuana - der Familienpfarrer der Barreras - bereit zu bezeugen, dass Adán während des Flughafenmassakers von Guadalajara an einer Kindstaufe in Tijuana teilgenommen hat, obwohl Dutzende von Zeugen ihn auf dem Flughafen und im Flugzeug gesehen hatten?
Der Pfarrer wies sogar das Taufregister vor - mit Adáns Namen und Unterschrift.
Und wer war der rätselhafte Yankee, der, ebenfalls von vielen Zeugen beschrieben, den toten Kardinal in den Armen gehalten hat? Der von den Barreras ins Flugzeug getragen wurde und dann verschwand?
Keller spricht ein schnelles Gebet - die Leute hinter ihm drängen nach - und sucht sich einen Sitzplatz in der überfüllten Kathedrale.
Die Totenmesse ist lang. Immer mehr Trauernde gehen ans Pult und verkünden, was sie Padre Juan zu verdanken haben, die große Kathedrale wird von Schluchzen erfüllt. Eine Atmosphäre der Trauer, des Gedenkens.
Bis der Präsident an der Reihe ist.
Er musste natürlich kommen. Der Präsident, das gesamte Kabinett, hohe Regierungsbeamte. Erwartungsvolle Stille breitet sich aus, als er ans Pult tritt. El Presidente räuspert sich und beginnt: »Durch eine verbrecherische Tat wurde das Leben eines rechtschaffenen, unbescholtenen, großzügigen Menschen -«
Doch weiter kommt er nicht, weil ein lauter Ruf aus der Menge ertönt: »Justitia!« Gerechtigkeit.
Ein anderer greift den Ruf auf, dann noch einer und noch einer, Sekunden später rufen Tausende, und der Ruf pflanzt sich fort nach draußen, über den Platz.
»Justitia! Justitia! Justitia!«
Mit verständnisinnigem Lächeln tritt der Präsident vom Mikrofon zurück, um zu warten, bis Ruhe einkehrt, aber es kehrt keine Ruhe ein.
»Justitia! Justitia! Justitia!«
Die Rufe schwellen weiter an.
»JUSTITIA! JUSTITIA! JUSTITIA!«
Die Geheimpolizisten werden nervös, verständigen sich zischelnd über ihre Sprechanlagen, aber sie können kaum etwas verstehen wegen der Rufchöre -
»JUSTITIA! JUSTITIA! JUSTITIA!«
- die sich weiter steigern, bis der Präsident von zwei Personenschützern zum Seitenausgang und von dort zu seiner gepanzerten Limousine geführt wird. Die Rufe folgen ihm nach, während der Wagen davonfährt.
»JUSTITIA! JUSTITIA! JUSTITIA!«
Als Parada in der Kathedrale bestattet wird, sind die meisten Regierungsbeamten schon fort.
Keller hat nicht in die Rufe eingestimmt, aber dass die Menschen genug haben von der Korruption und von ihrer Regierung Gerechtigkeit fordern, begeistert ihn. Gut so, sagt er sich. Ich werde meinen Teil dazu beitragen.
Er reiht sich in die Schlange der Trauernden ein und manövriert sich behutsam nach vorn.
Nora Hayden verbirgt ihr blondes Haar unter einem schwarzen Kopftuch, auch sonst trägt sie Schwarz - und ist trotzdem bildschön. Er kniet sich neben sie, hebt die Hände zum Gebet und flüstert: »Sie beten für seine Seele und schlafen mit seinem Mörder?«
Sie antwortet nicht.
»Wie halten Sie das aus?«, sagt Keller und steht auf. Ihr leises Weinen bleibt hinter ihm zurück.
Gegen Morgen fliegt der Oberkommandierende der mexikanischen Bundespolizei, begleitet von fünfzig ausgesuchten Sondereinsatzkräften, nach Tijuana, und bis zum Nachmittag sind sie aufgeteilt in schwerbewaffnete, kampfbereite Sechsergruppen, die mit gepanzerten Suburbans und Dodge Rams die Straßen von Colonia Chapultepec durchkämmen. Am Abend haben sie sechs Stützpunkte der Barreras gestürmt, auch Rauls Villa, in der sie ein Waffenlager finden: Kalaschnikows, Pistolen, Splittergranaten, Tausende Schuss Munition. In der riesigen Garage stoßen sie auf sechs gepanzerte Suburbans. Bis zum Ende der Woche haben sie fünfundzwanzig Barrera-Komplizen verhaftet, über achtzig Häuser, Lager und Ranchos gestürmt, die entweder den Barreras oder Gúero Méndez gehören, und zehn Sicherheitsbeamte des Flughafens festgenommen, die den Barreras freies Geleit gaben.
In Guadalajara stößt ein Trupp echter Provinzpolizisten auf ein Auto voller falscher Provinzpolizisten, und die Hetzjagd durch die Stadt endet damit, dass sich zwei der falschen Polizisten in einem Haus verschanzen und sich eine Nacht lang bis in den Morgen hinein eine Schießerei mit Hunderten echten Polizisten liefern - bis einer getötet wird und der andere sich ergibt, aber nicht bevor sie zwei echte Polizisten erschossen und den Kommandeur der Truppe verwundet haben.
Am folgenden Morgen tritt der Präsident vor die Fernsehkameras und verkündet, er sei entschlossen, die Drogenkartelle ein für alle Mal zu zerschlagen. Außerdem teilt er mit, es seien siebzig korrupte Polizeibeamte vom Dienst suspendiert worden und er setze eine Belohnung von fünf Millionen Dollar aus - für Informationen, die zur Festnahme von Adán und Raúl Barrera sowie Gúero Méndez führen, welche allesamt auf der Flucht sind - Aufenthalt unbekannt.
Armee, Bundespolizei und Polizeikräfte aller Provinzen durchkämmen jeden Winkel des Landes - vergeblich.
Sie sind längst über alle Berge. Gúero hat sich nach Guatemala abgesetzt. Die Barreras in die Vereinigten Staaten. Sie wohnen jetzt in La Jolla.
Fabián Martínez stöbert Flaco und Dreamer auf. Sie hausen unter der Laurel Street Bridge in Baiboa Park.
Die Polizei konnte sie nicht finden, aber Fabián ist ins Barrio gegangen, und die Leute haben ihm Sachen erzählt, die sie der Polizei niemals erzählen würden. Wenn sie die Polizei ärgern, werden sie von der Polizei schikaniert, aber wenn sie Fabián ärgern, knallt er sie ab - eiskalt.
Flaco und Dreamer pennen also unter der Brücke, als Flaco eine Schuhspitze in den Rippen spürt. Er schreckt hoch, weil er denkt, es ist ein Polizist oder ein Schwuler, aber es ist Fabián.
Mit großen Augen sitzt er da und starrt ihn an, voller Angst, eine Kugel verpasst zu kriegen, aber Fabián lächelt und sagt: »Hermanitos, jetzt könnt ihr beweisen, dass ihr Mumm habt.«
Und schlägt sich an die Brust.
»Worum geht's denn?«, fragt Flaco.
»Adán braucht euch. Er will, dass ihr noch mal nach Mexiko fahrt.«
Er erklärt ihnen, dass den Barreras die ganze Schuld am Tod des Kardinals angelastet wird, dass die Federales hinter ihnen her sind, ihre Stützpunkte stürmen, ihre Leute verhaften, und dass sie keine Ruhe geben werden, bis sie jemanden haben, dem sie die Schießerei anlasten können.
»Ihr fahrt hin und lasst euch verhaften«, sagt Fabián. »Erzählt ihnen die Wahrheit - wir waren hinter Gúero Méndez her, er hat uns eine Falle gestellt, und Fabián hat aus Versehen nicht ihn, sondern Parada erschossen. Niemand hatte vor, Parada auch nur ein Haar zu krümmen. Etwas in der Art.«
»Ich weiß nicht, Mann«, sagt Dreamer.
»Hört zu«, sagt Fabián. »Ihr seid minderjährig. Und ihr habt nicht geschossen. Ihr kriegt höchstens ein paar Jahre, und eure Familien werden bestens versorgt. Wenn ihr wieder rauskommt, habt ihr euch die Anerkennung und den Respekt von Adán verdient. So was zahlt sich aus wie Zinsen. Flaco, deine Mutter ist doch Zimmermädchen, oder?«
»Ja.«
»Nicht mehr lange«, sagt Fabián. »Wenn du Mumm hast.«
»Ich weiß nicht«, sagt Dreamer. »Mexikanische Bullen ...«
»Ich mach euch einen Vorschlag«, sagt Fabián. »Die Abschussprämie auf Gúero, wisst ihr noch? Fünfzigtausend Dollar. Die teilt ihr euch. Ihr sagt mir nur, wem wir das Geld geben sollen - und fertig.«
Beide sagen, ihre Mütter sollen das Geld bekommen.
Als sie zur Grenze kommen, zittern Flacos Knie so sehr, dass er Angst hat, es könnte Fabián auffallen. Sie schlagen richtig gegeneinander, er kann es nicht stoppen. Er hat Tränen in den Augen, und er kann sie nicht zurückhalten. Er schämt sich gewaltig, obwohl er auch Dreamer auf dem Rücksitz schniefen hört.
Am Übergang hält Fabián und lässt sie aussteigen.
»Ihr habt Mumm«, sagt er. »Ihr seid Kämpfer.«
Ohne Probleme kommen sie durch die Kontrolle und den Zoll und machen sich auf den Weg, weiter südwärts, Richtung Innenstadt. Keine zwei Straßen weiter, und sie werden von Scheinwerfern geblendet, Federales brüllen »Hände hoch!«. Als Flaco die Hände hebt, wirft ihn ein Polizist zu Boden und fesselt ihm die Arme auf den Rücken.
Flaco liegt im Dreck, sein Rücken tut wahnsinnig weh, weil seine Arme so fest zusammengebunden sind, aber das ist gar nichts im Vergleich mit dem, was dann kommt. Der Bulle spuckt ihm ins Gesicht und tritt ihm mit voller Kraft ans Ohr, mit der Spitze seiner Kampfstiefel, und Flaco denkt, sein Trommelfell explodiert.
Der Schmerz in seinem Kopf geht ab wie ein Feuerwerk. Von ganz weit hört er eine Stimme, und die Stimme sagt: »Das ist nur der Anfang, mein Sohn.« Die Hauptsache kommt noch.
Noras Telefon klingelt, es ist Adán. »Ich muss dich sehen.«
»Fahr zur Hölle.«
»Es war ein Unfall«, sagt er. »Ein Irrtum. Ich muss es dir erklären. Gib mir eine Chance. Bitte!«
Sie will auflegen, .verachtet sich dafür, dass sie's nicht tut, und verspricht ihm ein Treffen, in derselben Nacht, am Strand von La Jolla, am Wachturm 38.
Im Schatten des Wachturms sieht er sie näher kommen. Allein, wie es aussieht.
»Du weißt, mein Leben liegt in deinen Händen«, sagt er. »Wenn du die Polizei benachrichtigt hast...«
»Er war dein Pfarrer«, sagt sie. »Dein Freund. Mein Freund. Wie konntest du -«
Er schüttelt den Kopf. »Ich war gar nicht dort. Ich war zu einer Taufe in Tijuana. Es war ein Unfall, er ist ins Kreuzfeuer geraten -«
»Die Polizei sagt etwas anderes.«
»Die Polizei ist von Méndez gekauft.«
»Ich hasse dich, Adán.«
»Bitte sag das nicht.«
Er sieht so traurig aus, denkt sie. Einsam. Verzweifelt. Sie möchte ihm gern glauben.
»Schwöre«, sagt sie. »Schwöre mir, dass du die Wahrheit sagst.«
»Ich schwöre es.«
»Beim Leben deiner Tochter.«
Den Gedanken, sie zu verlieren, hält er nicht aus.
Er nickt. »Ich schwöre.«
Sie streckt ihm die Hände entgegen, er nimmt sie in die Arme. »Mein Gott, Adán, ich bin so verzweifelt.«
»Ich weiß.«
»Ich habe ihn geliebt.«
»Ich weiß«, sagt Adán. »Ich auch.« Und das Traurige daran ist, denkt er, dass es stimmt.
Sie müssen in einer Deponie sein, denn es riecht nach Müll.
Und es muss Morgen sein, weil er die Sonne im Gesicht spürt, durch die schwarze Kapuze hindurch. Sein linkes Trommelfell ist geplatzt, aber mit dem guten Ohr hört er Dreamer jammern. »Bitte, bitte. Nein, nein, bitte ...«
Ein Gewehrschuss, und er hört nichts mehr von Dreamer.
Dann spürt Flaco einen Gewehrlauf an der Schläfe, neben seinem guten Ohr. Der Polizist lässt den Gewehrlauf an seiner Schläfe kreisen, damit Flaco weiß, worum es sich handelt. Flaco hört, wie der Hahn gespannt wird.
Flaco schreit.
Ein trockenes Klicken.
Flaco pisst sich ein. Die warme Pisse läuft ihm an den Beinen hinab, seine Knie knicken ein, er windet sich auf dem Boden wie ein Wurm, versucht wegzukommen von dem Gewehrlauf an seiner Schläfe, dann hört er wieder den Gewehrhahn und wieder ein trockenes Klicken, und eine Stimme sagt: »Vielleicht beim nächsten Mal, du kleines Arschloch.«
Klick!
Flaco scheißt sich in die Hose.
Die Federales brüllen und johlen. »Mann, was für'n Gestank! Was hast du gestern gefressen, du Scheißer?« Wieder hört Flaco den Hahn klicken. Dann den Schuss.
Die Kugel schlägt neben seinem Ohr in den Boden ein. »Hebt ihn auf«, sagt die Stimme.
Aber die Federales wollen ihn nicht anfassen, weil er sich eingeschissen hat. Schließlich haben sie einen Einfall. Sie nehmen Dreamer die Kapuze ab und den Knebel aus dem Mund und zwingen ihn, Flaco die eingedreckten Hosen auszuziehen. Dann geben sie ihm einen nassen Lumpen, damit er seinem Freund die Scheiße abwischen kann.
Flaco flüstert: »Tut mir leid, tut mir leid.«
»Schon gut.«
Sie bringen die beiden zurück in den Van, dann zurück in ihre Zelle. Werfen sie auf den nackten Betonfußboden, knallen die Tür zu und lassen sie ein Weilchen schmoren.
Die beiden liegen auf dem Fußboden und heulen.
Als eine Stunde später die Tür aufgeht, fängt Flaco an, unkontrolliert zu zittern.
Der Polizist wirft beiden einen Schreibblock und einen Stift hin und sagt ihnen, sie sollen alles aufschreiben.
Am nächsten Morgen stehen ihre Geschichten in den Zeitungen.
Sie bestätigen, was die Polizei vermutet hat: Der Kardinal wurde das Opfer einer Verwechslung, er musste sterben, weil ihn amerikanische Banditen mit Gúero Méndez verwechselten.
El Presidente erscheint wieder im Fernsehen, begleitet von General León, und verkündet, dass diese Nachricht die Regierung in ihrer Entschlossenheit bestärkt, einen gnadenlosen Krieg gegen die Drogenkartelle zu führen. Einen Krieg, der nicht enden wird, bevor die Verbrecher bestraft und die narcotraficantes vernichtet sind.
Flacos Zunge hängt schlaff heraus.
Sein Gesicht ist dunkelblau angelaufen.
Er hat eine Schlinge um den Hals und hängt an einem Heizungsrohr der Zelle.
Neben ihm baumelt Dreamer.
Der Gerichtsmediziner liefert den Befund: Gemeinschaftlicher Selbstmord. Die jungen Männer konnten nicht mehr mit der Schuld leben, Kardinal Parada umgebracht zu haben. Die Verletzungen an ihren Hinterköpfen, erzeugt mit einem stumpfen Gegenstand, interessieren den Gerichtsmediziner nicht.
San Diego
Keller wartet auf der amerikanischen Seite.
Durch das Nachtsichtgerät sieht die Gegend merkwürdig grün aus. Überhaupt eine merkwürdige Gegend, denkt er. Nichts als staubige Hügel und steinige Canyons. Das Niemandsland zwischen Tijuana und San Diego.
Jede Nacht spielen sich hier verrückte Szenen ab. Am Abend sammeln sich die Mojados am trockenen Flutkanal, der entlang der Grenze verläuft, und warten auf die Dunkelheit. Und wie auf Signal überklettern sie alle den Zaun. Es ist ein Mengenspiel. Die Illegalen wissen, dass die Grenzer nur ein paar Leute festhalten können, die anderen kommen durch und können sich einen Billigjob als Obstpflücker, Tellerwäscher oder Farmarbeiter suchen.
Heute ist die nächtliche Hatz schon vorüber. Keller hat dafür gesorgt, dass sich die Grenzwachen von diesem Abschnitt fernhalten. Er erwartet einen Flüchtling, als Gast der Vereinigten Staaten, der keinen regulären Übergang benutzen kann. Es wäre zu gefährlich. Die Barreras lassen die Übergänge rund um die Uhr überwachen, und diesen Mann dürfen sie nicht sehen.
Unruhig blickt er auf die Uhr. Es ist ein Uhr zehn, zehn Minuten über die Zeit. Vielleicht hat sich der Mann im schwierigen Gelände verlaufen, ist in einem Canyon stecken geblieben, den falschen Hang hinauf oder ...
Nur Geduld, sagt er sich, Ramos ist bei ihm, und Ramos kennt die Gegend wie seinen Hinterhof, was sie ja auch irgendwie ist.
Vielleicht hat der Mann beschlossen, doch lieber den Barreras zu vertrauen. Vielleicht hat er Angst bekommen, einen Rückzieher gemacht. Oder Ramos war nicht schnell genug, und er liegt jetzt im Straßengraben, mit einer Kugel im Kopf oder, wahrscheinlicher noch, mit einem Schuss in den Mund, wie bei Informanten üblich.
Endlich ein Licht, das dreimal aufblinkt. Er entsichert den Dienstrevolver und steigt in den Canyon, die Taschenlampe in der einen Hand, den Revolver in der anderen. Nach einer Minute erkennt er zwei Gestalten. Eine große, dicke und eine kleine, schmächtige.
Der Pfarrer sieht bemitleidenswert aus. Er trägt keine Soutane, sondern ein Kapuzenshirt, Jeans und Turnschuhe. Durchaus angemessen, denkt Keller.
Aber er wirkt verfroren und ängstlich. »Padre Rivera?«, fragt Keller. Rivera nickt.
Ramos tätschelt ihm den Rücken. »Kopf hoch, Padre. Sie haben richtig entschieden. Die Barreras hätten Sie früher oder später ermordet.«
Das zumindest will er ihn glauben machen. Auf Kellers Drängen hat er sich an den Pfarrer gewandt. Hat ihn beim morgendlichen Joggen angesprochen und ihn gefragt, ob er Frischluftfanatiker sei, ob er auch weiterhin frische Luft atmen wolle. Dann hat er ihm Fotos von Rauls Folteropfern gezeigt und fröhlich hinzugefügt, genauso könne es ihm ergehen, da er doch Pfarrer sei, und überhaupt.
Die können sich gar nicht leisten, Sie leben zu lassen, hat er dem Padre gesagt. Sie wissen zu viel. Sie elende, verlogene, kriecherische Spottgeburt eines Priesters. Ich kann Sie retten, hat ihn Ramos beruhigt, als Rivera in Tränen ausbrach. Aber es muss schnell gehen - heute Nacht -, und Sie müssen mir vertrauen.
»Er hat recht«, sagt Keller jetzt und nickt Ramos zu. Und wenn es stimmt, dass Augen lächeln können, dann lächeln Ramos' Augen jetzt.
»Adios, viejo«, sagt Ramos zu Keller. »Adiós, alter Freund.«
Keller nimmt Rivera beim Handgelenk, führt ihn behutsam zu seinem Wagen. Der Padre lässt sich führen wie ein Kind.
Chalino Gusmán alias el Verde, patrón des Sonora-Kartells, betritt sein Lieblingsrestaurant in Ciudad Juarez, um zu frühstücken. Jeden Morgen bekommt er hier seine huevos rancheros, und würde er nicht diese auffälligen grünen Stiefel aus Eidechsleder tragen, könnte man ihn für einen der Farmer halten, die der harten, sonnenverbrannten roten Erde ihren Lebensunterhalt abzutrotzen versuchen.
Aber die Kellner wissen es besser. Sie geleiten ihn zu seinem gewohnten Tisch im Vorgarten, bringen ihm den Kaffee zusammen mit der Morgenzeitung. Und füllen Thermoskannen mit heißem Kaffee für die Sicarios, die draußen in ihren Autos warten.
Drüben, direkt hinter der texanischen Grenze, liegt El Paso, Gusmáns Umschlagplatz für Tonnen von Kokain, Marihuana und auch ein bisschen Heroin. Jetzt nimmt er sich die Zeitung vor. Nicht dass er lesen kann, aber er tut gern so, außerdem mag er die Bilder.
Über den Zeitungsrand spähend verfolgt er, wie einer seiner Sicarios auf einen schwarzen Ford Bronco zugeht, um ihn zu verscheuchen. El Verde ärgert sich ein bisschen - die Einheimischen wissen, dass sie hier um diese Zeit nichts zu suchen haben. Das muss ein Auswärtiger sein, denkt er, als der Sicario an die Seitenscheibe des Bronco klopft.
In diesem Moment geht die Bombe hoch und reißt el Verde in Stücke.
Don Francisco Uzueta alias Garcia Abrego, patrón des Golf-Kartells und der Federación, reitet auf seinem Palominohengst dem jährlichen Festumzug des Dorfes Coquimatlán voraus. Er führt den Hengst im Paradeschritt, die Hufe klappern auf dem Kopfsteinpflaster der engen Straße, und er selbst trägt seine prächtigste Cowboytracht, so wie es dem patrón des Dorfes zukommt. Den juwelenbesetzten Sombrero schwenkend, nimmt er die Jubelrufe der Bevölkerung entgegen.
Und sie hat Grund zum Jubeln. Don Francisco hat eine Ambulanz gebaut, die Schule, den Spielplatz. Sogar die Klimaanlage für die neue Polizeistation hat er spendiert.
Jetzt lächelt er huldvoll und sonnt sich in der Verehrung seiner Untertanen. Den Lauf des M6o-Maschinengewehrs, der aus einem Dachfenster ragt, sieht er nicht.
Die erste Salve beseitigt das Lächeln - zusammen mit dem ganzen Gesicht. Die zweite reißt ihm die Brust auf. Der Palomino scheut und wirft Abrego ab.
Der tote Abrego liegt am Boden, seine Hand umklammert den Zügel.
Der dreiundzwanzigjährige Mechaniker Mario Aburto steht mitten in der Menschenmenge, die sich in der Armensiedlung Lomas Taurinas versammelt hat.
Lomas Taurinas, eine Ansammlung von zusammengenagelten Hütten, liegt am Rand des Flughafens von Tijuana in einer schlammigen Senke, dahinter erheben sich die kahlen Berge. Wer in Lomas Taurinas nicht am Staub erstickt, versinkt im Schlamm, der von den erodierten Hängen herabfließt und manchmal auch die Hütten mitnimmt. Bis vor kurzem noch bedeutete fließendes Wasser für die Bewohner, dass sie ihre Hütte über einem der vielen kleinen Rinnsale gebaut hatten und so tatsächlich fließendes Wasser im Haus hatten, aber dann wurden in der Siedlung Wasser- und Stromleitungen verlegt - eine Dankesgeste der Regierungspartei. Doch nach wie vor ist der schlammige Untergrund eine Kloake, eine langsam zerfließende Müllkippe.
Luis Donaldo Colosio wird von fünfzehn Personenschützern der Präsidentengarde begleitet. Eine Sondereinheit aus Expolizisten, die zur Absicherung der Wahlkampfveranstaltungen angeheuert wurden, hat sich in der Menge verteilt. Der Kandidat steht auf der Ladepritsche eines Kleinlasters am Fuß des Abhangs, der um ihn herum ansteigt wie ein Amphitheater.
Ramos überblickt die Lage von oben, auch er hat seine Leute verteilt, denn es kann Probleme geben. Die Anwohner sind leicht erregbar, und sie strömen von allen Seiten herbei. Colosios roten Chevy Blazer haben sie schon angegriffen, als er sich durch die Siedlung zum Versammlungsplatz vorarbeitete, und die Rückfahrt könnte sich ebenfalls schwierig gestalten.
Der reinste Affenzirkus ist das hier, sagt sich Ramos.
Aber Colosio steigt nicht in sein rotes Auto, als er die Rede beendet hat.
Er hat sich spontan zu einer Protokolländerung entschlossen. Er will zu Fuß gehen.
Ein Bad in der Menge nehmen, wie er das nennt.
»Er will waaas?«, brüllt Ramos ins Funkgerät, das mit General Reyes von der Präsidentengarde verbunden ist.
»Er will zu Fuß gehen.«
»Das ist Irrsinn!«
»Er besteht darauf.«
»Wenn er das macht«, sagt Ramos, »können wir für nichts garantieren.«
Reyes gehört zum mexikanischen Generalstab und ist Zweiter Kommandeur der Präsidentengarde. Von einem kleinen Provinzpolizisten lässt er sich nichts sagen. »Personenschutz ist nicht Ihr Job«, schnaubt er, »das besorgen wir.«
Colosio wird Zeuge des Wortwechsels.
»Seit wann muss ich mich vorm Volk schützen?«, fragt er.
Ramos sieht hilflos zu, wie Colosio in die Menge eintaucht.
»Haltet die Augen auf!«, warnt er seine Leute über Funk, aber er weiß, dass sie wenig ausrichten können. Sie sind zwar gute Schützen, doch Colosio ist in der wogenden Menge kaum auszumachen, ein potentieller Attentäter schon gar nicht. Nicht nur die Sicht ist schlecht, sie hören auch nichts, weil jetzt die hier so beliebte Cumbia-Musik losdröhnt. Aus riesigen Lautsprechern.
Daher hört Ramos auch keinen Schuss.
Er hat gerade noch gesehen, wie Mario Aburto die Bodyguards beiseitestieß, Colosio an der Schulter packte und ihm mit einer 38er in die rechte Schläfe schoss.
Und während sich Ramos nach unten durchzwängt, bricht das Chaos aus. Mehrere Männer halten Aburto fest und schlagen auf ihn ein.
General Reyes will den am Boden liegenden Colosio zu einem Auto schleppen. Einer seiner Leute, ein Major in Zivil, packt Aburto und zerrt ihn durch die Menge. Der Major wird mit Blut bespritzt, als jemand mit einem Stein auf Aburtos Kopf einschlägt, aber inzwischen haben die Wachmänner des Präsidenten einen schützenden Ring um den Major gebildet, der den Attentäter in einen schwarzen Suburban befördert.
Als sich Ramos dem Suburban nähert, sieht er, dass sich ein Rettungswagen bis hierher durchgekämpft hat, er beobachtet, wie Colosio von Reyes und seinen Leuten auf die Pritsche verfrachtet wird. Dabei stellt er fest, dass Colosio eine zweite Wunde hat, am linken Brustkorb - der Mann wurde nicht nur einmal erschossen, denkt er, sondern zweimal.
Der Rettungswagen jault auf und fährt los.
Der schwarze Suburban will gleich hinterher, aber Ramos hebt sein Gewehr und richtet es direkt auf den Major, der vorn sitzt.
»Polizei!«, brüllt er. »Weisen Sie sich aus!«
»Generalstab! Aus dem Weg!«, brüllt der Major zurück. Und zieht die Pistole.
Keine gute Idee. Sofort richten sich zwölf Gewehre auf ihn.
Ramos tritt von der Beifahrerseite an den Suburban heran und sieht den angeblichen Attentäter hinter den Sitzen liegen, während drei Zivile auf ihn eindreschen.
»Machen Sie auf«, ruft er dem Major zu. »Ich steige ein.«
»Den Teufel werden Sie!«
»Ich will, dass der Mann lebend bei der Polizei abgeliefert wird.«
»Das geht Sie einen Dreck an! Machen Sie den Weg frei!«
»Wenn sich das Auto bewegt, wird geschossen«, ruft Ramos seinen Männern zu.
Er zertrümmert die Seitenscheibe mit dem Gewehrkolben. Der Major zuckt zurück, Ramos greift hinein, öffnet die Tür und steigt ein. Sein Gewehr richtet er auf den Bauch des Majors, der Major zielt mit der Pistole auf Ramos' Gesicht.
»Was soll das?«, fragt der Major. »Bin ich etwa Jack Ruby?«
»Ich passe nur auf, dass Sie's nicht werden. Dieser Mann soll lebend bei der Polizei ankommen.«
»Wir bringen ihn zum Hauptquartier der Federales«, sagt der Major.
»Hauptsache, er kommt lebend an«, wiederholt Ramos. Der Major senkt die Pistole und befiehlt dem Chauffeur, loszufahren.
Menschen sammeln sich vor dem Allgemeinen Krankenhaus von Tijuana, bevor der Rettungswagen eintrifft. Sie bevölkern die Vortreppe, sie weinen, beten, rufen Colosios Namen, halten sein Bild in die Höhe. Der Rettungswagen fährt vorbei, zur Notaufnahme. Ein Hubschrauber ist auf der Straße gelandet und steht dort bereit, mit laufendem Rotor, um den Verletzten in eine Spezialklinik nach San Diego zu bringen.
Aber der Flug findet nicht statt.
Colosio ist bereits tot.
Bobby Kennedy.
Das sieht mir zu sehr nach Bobby aus, denkt Keller.
Der einsame Einzeltäter - ein durchgedrehter Typ. Und zwei Schusswunden. Eine von rechts, eine von links.
»Wie hat der das hingekriegt, dieser Arturo?«, fragt Keller, als , er die Sache mit Shag beredet. »Ein Kopfschuss in die rechte Schläfe, aus nächster Distanz, dann ein Schuss in die linke Brustseite? Wie soll das gehen?«
»Genau wie bei Bobby Kennedy«, sagt Shag. »Colosio hat sich gedreht, als ihn die erste Kugel traf.«
Shag macht es vor. Er wirft den Kopf zurück und dreht sich im Fallen nach links.
»Könnte sein«, sagt Keller. »Aber die Schüsse können auch aus zwei verschiedenen Richtungen gekommen sein.«
»Nicht dieser Schwachsinn wieder!«
»Okay«, sagt Keller. »Wir finden Gúeros Tunnel, decken seine Verbindung zu den Fuentes-Brüdern auf, und die Fuentes-Brüder sind Hauptsponsoren von Colosio. Colosio kommt nach Tijuana, ins Hoheitsgebiet der Barreras, und wird umgelegt. Klingt das nach Schwachsinn?«
»Ich behaupte ja nicht, dass du schwachsinnig bist«, beschwichtigt Shag. »Aber ich glaube, du hast dich verrannt. Du bist zu sehr auf die Barreras fixiert, seit...«
Er verstummt, starrt auf den Schreibtisch.
Keller vollendet den Satz. »Seit sie Ernie umgebracht haben.«
»Eben.«
»Du etwa nicht?«
»Ich will sie alle haben, die Barreras und Mendez«, sagt Shag. Aber wenn die Sache ein bestimmtes Ausmaß erreicht ... ich meine, irgendwann muss Schluss sein.«
Er hat recht, denkt Keller.
Natürlich hat er recht. Am liebsten möchte ich sofort Schluss machen. Aber Wollen und Können sind zwei verschiedene Dinge -
»Wart's ab«, sagt Keller. »Am Ende wird sich zeigen, dass die Barreras hinter dem .Attentat stecken.« Er hat nicht den geringsten Zweifel.
Gúero Méndez liegt in einer Privatklinik, drei der besten Plastischen Chirurgen Mexikos bereiten seine Gesichtsoperation vor. Ein neues Gesicht, denkt Gúero, ein neuer Name, gefärbtes Haar, und der Krieg gegen die Barreras geht weiter.
Der Krieg, den er gewinnen wird, mit Unterstützung des neuen Präsidenten.
Er lässt sich ins Kissen sinken, während ihn die Schwester auf die OP vorbereitet.
»Sind Sie bereit? Sie werden jetzt einschlafen«, sagt die Schwester.
Er nickt. Einschlafen und als neuer Mensch aufwachen.
Sie greift nach der Spritze, entfernt die Gummikappe, sucht seine Armvene und drückt ab. Während die Wirkung einsetzt, streicht sie ihm übers Gesicht und sagt: »Colosio ist tot.«
»Was haben Sie gesagt?«
»Ich habe Nachricht von Adán Barrera - Ihr Freund Colosio ist tot.«
Gúero will hoch, aber sein Körper gehorcht nicht.
»Das Mittel heißt Dormicum«, sagt die Schwester. »In der Überdosis wirkt es als Todesspritze. Sie werden jetzt die Augen schließen und nie wieder öffnen.«
Er will schreien, aber es kommt kein Laut. Er sträubt sich gegen das Einschlafen, doch er spürt, wie ihm alles entgleitet - sein Bewusstsein, sein Leben. Er will die Maske herunterreißen, nach Hilfe schreien, doch seine Muskeln reagieren nicht. Nicht mal den Kopf kann er schütteln, um nein, nein, nein zu sagen.
Wie aus unendlicher Entfernung hört er die Stimme der Schwester: »Schönen Gruß von den Barreras. Sie sollen in der Hölle schmoren.«
Zwei Wachmänner schieben den Wagen mit frischer Bettwäsche bis zur Zellensuite von Miguel Angel Barrera im Gefängnis von Almoloya.
Tío steigt ein, die Wachmänner decken ihn mit Laken zu und rollen ihn aus dem Gebäude, über den Hof, zum Tor hinaus. Ganz einfach und ganz lässig. Wie versprochen.
Miguel Ángel klettert heraus und geht hinüber zum wartenden Lieferwagen.
Zwölf Stunden später lebt er als Pensionär in Venezuela.
Drei Tage vor Weihnachten kniet Adán Barrera vor Kardinal Antonucci.
Der »meistgesuchte Verbrecher Mexikos« lauscht dem lateinischen Sprechgesang des päpstlichen Nuntius, um Absolution für sich und Raúl zu empfangen - wegen ihrer ungewollten Verwicklung in die versehentliche Tötung von Kardinal Juan Ocampo Parada.
Für die Morde an el Verde, Abrego, Colosio und Méndez erhalten sie keine Absolution von ihm. Die bekommen sie von der Regierung. Nein, wir haben sie schon, denkt Adán. So war es ausgemacht, als Gegenleistung für die Beseitigung Paradas.
Wenn ich eure Feinde töte, hatte Adán gefordert, müsst ihr mich auch meine Feinde töten lassen.
Und so ist es gelaufen, denkt Adán. Méndez ist tot, der Krieg ist vorbei. Tío ist aus dem Gefängnis befreit.
Und ich bin der neue patrón.
Die mexikanische Regierung hat die katholische Kirche in ihre alten Privilegien eingesetzt. Einen Aktenkoffer mit verfänglichen Dokumenten hat Adán an den zuständigen Minister weitergeleitet.
Adán verlässt das Privatbüro des Nuntius mit reiner Weste, mit blitzblank geputzter Seele. Eine Hand wäscht die andere.
Silvester. Noch bevor die Korken knallen, hat Nora die Party bei Haley Saxon verlassen.
Sie ist nicht in Stimmung. Die Feiertage waren deprimierend. Die ersten Weihnachten seit neun Jahren, die sie ohne Padre Juan verbringt.
Sie schließt ihre .Wohnungstür auf, und als sie eintritt, legt sich eine Hand über ihren Mund. Die Tasche, in der sie nach dem Pfefferspray wühlt, wird ihr aus der Hand geschlagen.
»Nicht schreien«, sagt Keller. »Ich tue Ihnen nichts.«
Probehalber nimmt er die Hand weg.
Sie dreht sich um, schlägt ihm ins Gesicht, dann sagt sie: »Ich rufe die Polizei.«
»Die Polizei bin ich.«
»Die richtige Polizei.« Sie wählt die Nummer.
»Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden.« Sie legt den Hörer auf. »So ist es besser.«
»Was wollen Sie?«
»Ich will Ihnen etwas zeigen.«
»Sie haben keine Ahnung, wie oft ich das schon gehört habe.«
Er nimmt eine Videokassette aus der Jackentasche. »Haben Sie ein Videogerät?«
Sie lacht. »Ein Amateurvideo? Toll! Wollen Sie mich damit beeindrucken? Oder bin ich da drauf? Erst drohen, dann erpressen. Hören Sie, mein Guter. Davon gibt es Hunderte, und ich sehe ziemlich gut aus auf Video.«
Sie öffnet einen Schrank und zeigt auf das Videogerät. »Wenn es Ihnen Spaß macht.«
Er schiebt die Kassette ein. »Setzen Sie sich.«
»Danke, ich stehe lieber.«
»Ich sagte, setzen Sie sich.«
»Oh, Sie stehen auf Gewalt.« Sie setzt sich aufs Sofa. »Ist es Ihnen so recht?«
»Schauen Sie hin.«
Ihr verächtliches Lächeln gefriert, als ein junger Priester auf dem Bildschirm erscheint. Er sitzt auf einem Klappstuhl, hinter einem Metalltisch. Im Untertitel Datum und Uhrzeit.
»Wer ist das?«, fragt sie.
»Padre Esteban Rivera«, sagt Keller. »Adán Barreras Gemeindepfarrer.«
Im Hintergrund ist Kellers Stimme zu hören, der den Pfarrer vernimmt.
Und sie wird bleich, während sie zuhört.
Können Sie mir sagen, wo Sie am 24. Mai 1994 waren?
Ja.
Sie haben eine Taufe zelebriert. Stimmt das? ja.
In Ihrer Kirche in Tijuana. ja.
Lesen Sie das.
Nora sieht eine Hand, die dem Pfarrer ein Dokument hinschiebt. Er liest es und legt es auf den Tisch zurück. Erkennen Sie das? Ja.
Was ist das?
Eine Taufbescheinigung.
Als Pate ist Adán Barrera eingetragen. Sehen Sie das? Ja.
Das ist Ihre Handschrift, oder? Ja.
Sie haben Adán Barrera als Paten eingetragen und bestätigt, dass er bei der Taufe zugegen war, stimmt das? Ja, das habe ich. Aber es stimmt nicht, oder?
Nora hält den Atem an während der langen Pause, die Rivera für die Antwort benötigt. Nein.
Ihr wird übel.
Sie haben gelogen.
Ja. Ich schäme mich dafür.
Wer hat Sie aufgefordert zu lügen?
Er selbst.
Ist das seine Unterschrift hier?
Ja.
Wann hat er die Unterschrift geleistet?
Das war eine Woche vorher.
Nora beugt sich vor und steckt den Kopf zwischen ihre Knie.
Wissen Sie, wo sich Adán Barrera an dem Tag aufgehalten hat?
Nein.
»Aber wir wissen es, nicht wahr?«, sagt Keller zu Nora. Er steht auf, zieht die Kassette heraus und steckt sie in die Tasche. »Frohes Neujahr, Ms. Hayden.«
Sie blickt nicht auf, als er geht.
Neujahrsmorgen. Als Keller aufwacht, läuft der Fernseher. Er hat einen üblen Kater.
Das verdammte Ding muss die ganze Nacht gelaufen sein. Er schaltet ihn aus, geht ins Bad, schluckt ein paar Aspirin und schüttet ein großes Glas Wasser hinterher. Dann geht er in die Küche und setzt Kaffee auf.
Während der Kaffee brüht, holt er die Zeitung aus dem Flur, dann trägt er Kaffee und Zeitung in die Sitzecke seines sterilen Apartments und setzt sich. Draußen ist ein klarer Wintertag, er sieht den Hafen von San Diego, nur ein paar Straßen entfernt, dahinter Mexiko.
Was für ein Scheißjahr, dieses 1994, denkt er.
Möge das nächste besser werden.
Die Toten auf meiner Silvesterparty sind wieder mehr geworden. Die alten Stammkunden - und nun auch Padre Juan. Niedergemäht in einem Kreuzfeuer, das ich verursacht habe, um den Krieg zu beenden, den ich provoziert habe. Und er hat Gäste mitgebracht, Kinder eigentlich noch, die jetzt auch tot sind, aus der Street-Gang meines alten Barrios.
Die alle haben mit mir gefeiert.
Was für eine Party!
Er liest die Schlagzeile des Tages und registriert ohne großes Interesse, dass das Freihandelsabkommen NAFTA heute in Kraft tritt.
Da kann ich nur gratulieren, denkt er. Der Freihandel wird aufblühen. Die Fabriken werden wie Pilze aus dem Boden schießen, drüben in Mexiko, und die mexikanischen Billigarbeiter werden unsere Tennisschuhe, Designerklamotten, Kühlschränke und andere praktische Dinge herstellen, zu Preisen, die wir uns leisten können.
Wir alle werden fett und glücklich. Was ist dagegen ein toter Priester?
Na schön, ihr habt euer Abkommen, denkt er. Aber ich hab es nicht unterschrieben.
VIERTER TEIL
Die Straße nach Ensenada
10 Der goldene Westen
All the federales say
They could have had him any day.
They only let him go so long
Out of kindness, I suppose.
Townes Van Zandt, Pancho and Lefty
San Diego
1996
Dreckiges Sonnenlicht, gefiltert durch ungeputzte Fenster, zerfetzte Rollos, kriecht auf Callan zu wie ein giftiges Gas, gelb und kränklich. Gelb und kränklich, das trifft auch auf Callan zu - gelb, kränklich, verschwitzt und stinkend. Er liegt verdreht im Bett, seine Laken sind seit Wochen nicht gewechselt, seine Poren versuchen (vergeblich), den Alkohol auszuschwitzen, in den Winkeln seines halboffenen Mundes klebt getrockneter Speichel, sein Gehirn bemüht sich fieberhaft, die zerbröckelnden Reste seines Alptraums gegen das Erwachen zu verteidigen.
Als die Sonne sein Gesicht erreicht, macht er die Augen auf.
Ein neuer Tag im Paradies.
Scheiße.
Eigentlich kann er froh sein, dass er aufgewacht ist, der Alptraum war grässlich, kein Wunder bei dem Suff. Halb erwartet er, in seinem Blut zu liegen. Er träumt von nichts anderem. Ströme von Blut, und ein Alptraum jagt den anderen.
Nicht dass die Wirklichkeit viel besser wäre.
Er blinzelt ein paarmal, um sicherzugehen, dass er wach ist, dann schiebt er langsam die Beine aus dem Bett. Eine Weile bleibt er sitzen und überlegt, ob er sich wieder hinlegen soll, weil die Beine so weh tun. Er greift nach den Zigaretten auf dem Nachttisch, steckt sich mit zitternder Flamme eine an.
Einmal tief inhalieren, einmal kräftig husten, und er fühlt sich schon besser.
Was er jetzt braucht, ist ein Drink. Ein Muntermacher.
Er schaut sich um und entdeckt die leere Seagram's-Flasche zu seinen Füßen.
Verdammte Kacke, das passiert neuerdings immer öfter. Immer öfter? Am Arsch, denkt er. Es passiert jeden Tag, und das seit langem - dass er die ganze Flasche leer macht und sich nichts für den Morgen aufhebt, nicht den Schluck aus bernsteinfarbenem Sonnenlicht. Was nichts anderes heißt als aufstehen. Aufstehen, anziehen und rausgehen, Nachschub besorgen.
In den alten Zeiten - und so lange ist das gar nicht her - brauchte er eine Tasse Kaffee, um seinen Kater loszuwerden. In den noch älteren Zeiten ging er in den kleinen Diner auf der Fourth Avenue, trank einen Kaffee gegen die Kopfschmerzen und ging dann gleich zum Frühstück über - fettige Bratkartoffeln, Eier und Toast: sein »Special«. Dann hörte das mit dem Frühstücken auf - mehr als der Kaffee ging nicht rein - und irgendwann später, ein ganzes Stück weiter auf dem langen Weg nach unten, der eigentlich eine einzige Sauftour war, vertrug er in diesen fürchterlichen Morgenstunden auch keinen Kaffee mehr, sondern nur noch Schnaps.
Also heißt es aufstehen.
Seine Knie knirschen, sein Rücken ist verspannt vom Schlaf in der falschen Position.
Er schlurft ins Bad, bestehend aus Waschbecken, Dusche und Klo, eingezwängt in einen Verschlag. Eine flache Metalllippe trennt den Duschbereich vom Fußboden, und in den Zeiten, als er noch regelmäßig duschte (und er zahlt einen dicken Zuschlag für das Privileg eines eigenen Bads, weil er den Waschraum am Ende des Korridors nicht mit faselnden Irren, alten Syphilitikern, versoffenen Schwuchteln teilen will), überschwemmte das Wasser immer den alten fleckigen Kachelboden. Oder spritzte durch den kaputten Duschvorhang mit dem verblassten Blümchenmuster. Jetzt duscht er nicht mehr so oft, es ist viel zu anstrengend, und das Shampoo ist fast alle, der Rest klebt am Boden der Flasche und will nicht rauskommen - und rübergehen in den Drugstore macht ihm zu viel Mühe. All die Leute nerven ihn, all die Zivilisten zumindest.
Ein dünner Seifenrest hat sich auf dem Boden der Dusche gehalten, ein ausgetrocknetes, streng riechendes Stück Desinfektionsseife liegt neben dem dünnen Hotelhandtuch auf dem Waschbeckenrand.
Er spritzt sich ein bisschen Wasser ins Gesicht.
In den Spiegel schaut er nicht, aber der Spiegel schaut zurück.
Sein Gesicht ist verquollen und fahl, sein schulterlanges Haar strähnig und fettig, sein Bart wird langsam zur Matte.
Ich sehe schon aus wie die Säufer und Junkies vom Lamp District, denkt er. Was bin ich denn anderes? Nur dass ich mir jederzeit Geld aus dem Bankomat holen kann.
Er putzt sich die Zähne.
Wenigstens das. Sonst muss er gleich wieder kotzen von dem ekligen Geschmack im Mund. Also putzt er sich die Zähne und pisst. Anziehen muss er sich nicht - er hat noch die Sachen an, in denen er eingepennt ist, schwarze Jeans, schwarzes T-Shirt. Aber Schuhe muss er anziehen, das heißt wieder zurück aufs Bett, sich nach unten beugen, und als er seine Converse-Stiefel (ohne Socken) endlich zugeschnürt hat, ist er fast schon wieder reif für ein Schläfchen.
Dabei ist es elf Uhr vormittags.
Zeit, in die Gänge zu kommen.
Sich einen Drink zu besorgen.
Er holt die 22er unterm Kissen vor, steckt sie hinterm Rücken in den Hosenbund, lässt das lose und extraweite T-Shirt drüberfallen, greift nach dem Schlüssel und geht hinaus.
Im Flur stinkt es.
Vor allem nach Lysol, das die Hotelbetreiber überall versprühen wie Insektengift, um den Gestank nach Urin, Scheiße, Kotze und sterbenden alten Männern zu übertünchen. Oder wenigstens die Keime abzutöten. Ein hoffnungsloser Fall. So wie dieser ganze Laden, denkt Callan, als er den Liftknopf drückt - ein hoffnungsloser Fall.
Deshalb bin ich ja hier.
Um meinem hoffnungslosen Fall ein Ende zu machen. Das Golden West Hotel. Ein echter Scheißladen.
Die letzte Station vor dem Pappkarton auf der Straße oder der Pathologie.
Weil das Golden West Gutscheine nimmt, von der Wohlfahrt, vom Sozialamt, vom Arbeitsamt, vom Gesundheitsamt - Gutscheine, die man abwohnen kann. Aber wenn der Gutschein abgewohnt ist, heißt es: Sorry Jungs, jetzt müsst ihr auf die Straße, auf die Pappe - oder gleich ins Kühlfach. Wohl denen, die in ihrem Zimmer krepieren. Die haben ihre Ruhe, bis die Miete fällig ist oder bis der Verwesungsgestank unter der Tür durchdringt und stärker wird als das Lysol, bis sich der angewiderte Manager das Taschentuch vor die Nase presst und den Generalschlüssel dreht. Dann folgt der Anruf, der Leichenwagen macht sich träge auf den gewohnten Weg zum Hotel, und wieder tritt ein alter Saufsack seine letzte Reise an.
Es wohnen nicht nur alte Saufsäcke im Golden West. Immer mal wieder verirren sich europäische Touristen hierher, angelockt von den billigen Zimmerpreisen im ansonsten teuren San Diego. Auch junge Amerikaner, die sich für den neuen Jack Kerouac oder Tom Waits halten, fühlen sich von dieser abgefuckten Schäbigkeit angezogen - bis ihnen der Rucksack mit dem Discman und dem ganzen Geld aus dem Zimmer geklaut wird oder bis ihnen ein alter Schwuler im Waschraum an die Wäsche geht. Dann ruft der Möchtegern-Hippie bei Mama an, und Mama gibt an der Rezeption ihre Kreditkartennummer durch, aber wenigstens hat er ein Stück Amerika erlebt, das es anderswo nicht gibt.
Doch die meisten hier sind alte Säufer und Psychos, die in der Lobby vor dem Fernsehen hocken wie eine Ansammlung von Krähen. Machen ihre Bemerkungen, streiten sich um die Sender (es gab Messerstechereien, sogar Tote wegen Rockford oder Gilligans Insel) oder murmeln ihre inneren Monologe zu Szenen, die sich nur in ihrem Kopf abspielen.
Alles hoffnungslose Fälle. Callan muss hier nicht wohnen.
Er hat Geld, er könnte sich was Besseres leisten, aber er hat es so gewollt.
Man kann es Buße nennen, Läuterung oder Fegefeuer - hier ist der Ort, wo er seine Selbstbestrafung zelebriert, in aller Ausführlichkeit, wo er sich langsam, aber sicher zu Tode säuft, nachts im Schlaf schreit, in seinem Angstschweiß liegt, Blut kotzt, jede Nacht stirbt und jeden Morgen von vorn anfängt. Ich vergebe dir. Gott vergibt dir.
Warum musste ihm dieser alte Priester das sagen?
Nach der wüsten Schießerei in Guadalajara hat er sich nach San Diego abgesetzt, sich im Golden West eingemietet und angefangen zu saufen. Anderthalb Jahre später ist er immer noch hier.
Der ideale Ort für Selbsthass. Ihm gefällt es hier.
Der Fahrstuhl hält, ächzend wie ein alter Zimmerkellner. Callan zwängt sich durch die Tür und drückt auf den Knopf unter dem verblichenen L. Das Gitter schließt sich wie eine Zellentür, und der Fahrstuhl quält sich abwärts. Callan ist froh, dass er der Einzige ist - kein französischer Tourist, der alles mit seinen Reisetaschen verstopft, kein amerikanischer College-Boy auf der Suche nach dem wahren Amerika, der ihn mit seinem Backpack rammt, kein ungewaschener Säufer. Scheiße, denkt Callan. Der ungewaschene Säufer bin ich.
Aber egal.
Der Mann an der Rezeption mag Callan.
Und hat allen Grund dazu. Dieser Typ sieht merkwürdig jung aus (zumindest fürs Golden West), er zahlt im Voraus und in bar. Ist ruhig und beschwert sich nicht. Und dann war da die Nacht, als einer mit dem Messer abkassieren wollte. Callan, der auf seinen Schlüssel wartete, musste den Messerstecher nur scharf angucken, da ging der schon zu Boden. Besoffen wie ein Stint und setzt den Kerl einfach außer Gefecht, mit einem fachmännischen Hieb - und fragt ganz höflich noch einmal nach seinem Schlüssel.
Der Mann am Schalter also mag Callan. Klar, er ist ständig besoffen, aber er gehört zu den Säufern, die keinen Ärger machen, und was will man mehr. Daher sagt er »Hi«, als Callan seinen Schlüssel abwirft, Callan sagt ebenfalls »Hi« und läuft weiter zur Tür.
Die Sonne trifft ihn wie ein Schlag.
Vom Dunklen ins Helle, einfach so. Er steht geblendet und kneift die Augen zusammen. Daran gewöhnt er sich nie - so eine Sonne gab es nicht in New York. Und sie scheint immer, in diesem beschissenen San Diego. Sun Diego müsste es heißen. Für einen Regentag würde er glatt sein linkes Ei hergeben.
Als er wieder sieht, läuft er los, in den Gaslamp District. Das war früher ein verlottertes Viertel voller Striplokale, Pornoschuppen und billiger Absteigen, eine heruntergekommene Innenstadtlage eben, doch dann wichen die schäbigen Hotels allmählich den gehobenen Wohnprojekten, und es wurde schick, im »Lamp« zu wohnen.
Callan juckt das alles nicht, er denkt nur an seinen Drink, seine Füße tragen ihn zu einer alten Schmuddelbar, die zufällig überlebt hat. Ein dunkler Schlauch ohne Namen - das Schild ist schon vor Urzeiten verblasst -, eingequetscht zwischen dem letzten Waschsalon des Viertels und einer Kunstgalerie.
Es ist eine Bar für echte Trinker, Amateure und Dilettanten haben hier nichts zu suchen, und von den Profis sitzen etwa zwölf, meist männlich, lockerer verteilt auf den Barhockern oder an den Tischen längs der Wand. Sie kommen nicht wegen der Geselligkeit, um über Sport oder Politik zu diskutieren oder edle Whiskey-Sorten zu verkosten, sie kommen, um sich zu besaufen und so lange besoffen zu bleiben, wie die Leber mitmacht. Ein paar blicken verschreckt auf, als Callan zur Tür hereinkommt und einen Streifen Sonne in die Dunkelheit vordringen lässt.
Aber die Tür ist schnell wieder zu, und alle starren weiter in ihre Drinks, während Callan einen Barhocker besteigt.
Nein, nicht alle.
Am Ende des Tresens sitzt einer, der verstohlen über den Rand seines Glases blickt. Ein alter Mann. Klein, mit Kindergesicht und dichtem, silberweißem Haar. Auf seinem Barhocker sieht er aus wie ein Gnom, und seine Augen blinzeln überrascht, als er den Mann erkennt, der da eben zwei Bier und einen Whiskey bestellt hat.
Es ist zwanzig Jahre her, dass er den zuletzt gesehen hat, damals im Liffey Pub, in Hell's Kitchen. Da hat dieser Mann, damals noch ein Knirps, eine Pistole hinterm Rücken vorgezogen und Eddie »The Butcher« Friel mit zwei Kugeln durchlöchert.
Mickey weiß noch, welche Musik damals spielte. Er selbst hatte die Jukebox gefüttert, um möglichst oft »Moon River« zu hören, bevor er wieder in den Bau einrücken musste. Und er weiß sogar noch, dass er dem Knirps - und der Kerl da drüben ist es wirklich, sogar die Beule an seinem Rücken ist zu sehen - den Tip gegeben hat, die Pistole im Hudson zu versenken.
Mickey ging dann in den Bau, aber er kennt die restliche Geschichte. Dass dieser Knirps - wie hieß er gleich? - danach Matty Sheehan umlegte und einer der Kings von Hell's Kitchen wurde. Dass er und sein Freund Frieden schlossen mit dem Cimino-Clan und für Big Paule Calabrese als Killer arbeiteten. Und dass er dann, wenn die Gerüchte stimmen, Big Paulie umlegte - vor Spark's Steak House, genau zu Weihnachten.
Callan, fällt ihm jetzt ein.
Sean Callan.
Klar, ich erkenne dich, Sean Callan. Aber du mich nicht. Was sehr gut ist.
Mickey Haggerty trinkt aus, klettert vom Barhocker und schlüpft hinaus zur Telefonzelle. Er kennt einen, der sich sehr dafür interessieren wird, dass Sean Callan hier in einer Bar sitzt.
Delirium tremens.
Nun ist es so weit. Eine andere Erklärung gibt es nicht dafür, dass Big Peaches und O-Bop an seinem Bett im Golden West stehen und ihre Pistolen auf ihn richten. Er sieht die Kugeln in den Pistolenläufen, silbrig glänzend und tödlich, weil das Zimmer von der Straßenlampe erhellt wird, einer falschen Gaslaterne, deren Licht die kaputten Rollos nicht abschirmen können.
Das rote Neon vom Pornoshop auf der anderen Straßenseite blinkt wie ein Alarmsignal. Zu spät.
Wenn das kein Deliriums tremens ist, bin ich schon tot, denkt Callan. Trotzdem greift er vorsichtig nach der 22er unter seinem Kissen. Wenn schon, sollen die auch sterben.
»Lass das, du dummer Paddy«, hört er Big Peaches knurren.
Callans Hand erstarrt. Träumt er oder ist er wach? Stehen die beiden wirklich in seinem Zimmer und richten die Pistolen auf ihn? Und warum schießen sie nicht, wenn sie ihn erschießen wollen? Wer im Traum stirbt, stirbt auch im Leben, sagt man, und manchmal sind tot und lebendig gar nicht so leicht zu unterscheiden. Er weiß nur, dass er sich in der Bar volllaufen ließ. Jetzt könnte er tot sein oder lebendig. Oder zurück in Hell's Kitchen - und die letzten neun Jahre waren nur ein Traum.
Big Peaches lacht. »Was ist denn los mit dir? Bist du ein beschissener Hippie geworden? Lange Haare und Bart?«
»Er ist auf dem Sauftrip«, sagt O-Bop. »Das irische Sabbatical.«
»Du hast doch sicher deine kleine 22er unterm Kissen, oder?«, fragt Peaches. »Ist mir egal, ob du besoffen bist, aber pass bloß auf mit deiner Knarre. Wenn wir gekommen wären, um dich kaltzumachen, wärst du gar nicht erst aufgewacht.«
»Was sollen dann die Kanonen?«, fragt Callan.
»Nimm's als übertriebene Vorsichtsmaßnahme«, sagt Peaches. »Du bist schließlich Billy the Kid Callan. Wer weiß, was du hier treibst. Vielleicht bist du auf mich angesetzt. Also rück sie raus. Schön langsam.«
Callan gehorcht.
Überlegt kurz, ob er sie beide wegputzen soll, aber wozu. Außerdem zittert seine Hand.
O-Bop nimmt ihm sanft die Pistole aus der Hand und steckt sie hinter seinen Gürtel. Dann setzt er sich zu ihm und umarmt ihn. »Wahnsinn! Dich noch mal wiederzusehen!«
Peaches setzt sich ans Fußende. »Wo zum Teufel hast du gesteckt? In den Süden sollst du gehen, haben wir gesagt, doch nicht bis zum Südpol, du alter Sack!«
O-Bop sagt: »Du siehst echt Scheiße aus.«
»So fühl ich mich auch.«
»Stimmt, du siehst Scheiße aus«, bestätigt Peaches. »Aber was zum Teufel machst du hier in diesem beschissenen Loch? Jesus! Callan!«
»Habt ihr einen Drink?«
»Klar doch.« O-Bop zieht einen Flachmann Seagram's aus der Tasche und reicht ihn Callan.
Der nimmt einen langen Schluck. »Danke.«
»Ihr verdammten Iren!«, sagt Peaches. »Alles Säufer, durch die Bank!«
»Wie habt ihr mich gefunden?«, fragt Callan.
»Da wir schon von Säufern reden«, sagt Peaches. »Der kleine Mickey Haggerty. Hat dich in diesem Dreckloch von Kneipe gesehen, kurz mal telefoniert, wir kriegen raus, dass du im Golden West wohnst, und können es nicht fassen. Was zum Teufel ist mit dir passiert?«
»'ne Menge.«
»Was du nicht sagst«, meint Peaches. »Was wollt ihr von mir?«
»Pack deine Sachen«, sagt Peaches. »Wir nehmen dich mit.«
»Nach New York?«
»Nein, du Idiot. Wir wohnen jetzt hier. Sun Diego, Baby. Ist wirklich super, die Gegend.«
»Wir bauen eine Crew auf«, erklärt ihm O-Bop. »Ich, Peaches, Little Peaches, Mickey. Und jetzt du.«
Callan schüttelt den Kopf. »Ich bin mit dieser Scheiße fertig.«
»Klar«, sagt Peaches. »Wie man sieht, kommst du hier prima zurecht. Pass auf, reden können wir später. Jetzt nüchtern wir dich erst mal aus, geben dir was Gutes zu essen. Ein bisschen Obst - du glaubst nicht, was es hier an Obst gibt. Nicht nur Pfirsiche. Ich rede von Birnen, Orangen, Grapefruits, so prall und saftig, die sind besser als Sex. Mach schon, O-Bop, such ihm ein paar Klamotten zusammen, dann nichts wie raus hier.«
Callan ist betrunken. Was soll er machen?
O-Bop rafft seine Sachen zusammen, und Peaches geht mit ihm raus.
Wirft einen Hunderter auf den Schalter und sagt dem Manager, es ist alles bezahlt, scheißegal, was es kostet. Und auf dem Weg zum Auto - Peaches hat sich einen neuen Mercedes zugelegt - schwärmen die beiden davon, wie toll es hier ist, dass sie eine heiße Sache am Laufen haben.
Dass hier die Straßen mit Gold gepflastert sind.
Mit echtem Gold.
Die Grapefruit liegt in der Schale wie eine Sonne.
Wie eine dicke, fette, saftige Sonne.
»Iss«, sagt Peaches. »Du brauchst Vitamin C.«
Peaches ist neuerdings ein Gesundheitsfanatiker - wie alle in Kalifornien. Er wiegt immer noch satte drei Zentner, aber jetzt sind die satten drei Zentner solariumsgebräunt, cholesterinarm und reich an Ballaststoffen.
»Ich muss ständig aufs Klo«, erklärt er Callan, »aber ich fühle mich bestens.«
Nicht so Callan.
Er fühlt sich wie ein Mann nach einer mehrjährigen Sauftour. Er fühlt sich wie der Tod, wenn sich der Tod so richtig beschissen fühlt. Und jetzt nervt ihn dieser fette braune Peaches damit, dass er eine Scheiß-Pampelmuse fressen soll.
»Hast du ein Bier?«, fragt Callan.
»Klar hab ich ein Bier«, sagt Peaches. »Aber du hast kein Bier, und du kriegst auch keins, du versoffenes Arschloch. Wir kriegen dich wieder trocken, wirst schon sehen.«
»Wie lange bin ich schon hier?«
»Vier Tage«, sagt Peaches. »Und jede Minute davon war das reinste Vergnügen. Du hast gekotzt, geschrien, gebrabbelt, gebrüllt. Lauter Scheiße.«
Was für Scheiße hab ich gebrüllt?, fragt sich Callan, denn seine Träume waren grässlich und bluttriefend. Die verfluchten Gespenster - und es gab eine Menge davon - wollten einfach nicht verschwinden.
Und dieser elende Priester.
Ich vergebe dir. Gott vergibt dir.
Nein, Padre, macht er nicht.
»Mann, deine Leber will ich lieber nicht sehen«, sagt Peaches jetzt. »Die muss aussehen wie ein alter Tennisball. Übrigens, ich spiel jetzt Tennis, hab ich das erzählt? Jeden Vormittag. Nur dass ich in den letzten vier Tagen stattdessen die Krankenschwester mimen musste. Ja, ich spiele Tennis. Und fahre Rollerblade.«
Dreihundertzwanzig Pfund Big Peaches auf Rollerblades?, denkt Callan. Was da für Unfälle passieren können ...
»Stimmt«, sagt O-Bop. »Wir haben ihm Sattelschlepperreifen an die Blades geschraubt.«
»Fick dich, Topfkratzer«, sagt Peaches. »Ich fahre ziemlich gut.«
»Aber die Leute gehen in Deckung«, sagt O-Bop. »Das kann ich dir sagen!«
»Du könntest auch ein bisschen Bewegung gebrauchen«, sagt Peaches zu O-Bop. »Und du, Saufsack, friss deine verdammte Grapefruit.«
»Wie denn? Muss man die schälen?«, fragt Callan. »Gott, was für ein Idiot. Gib her!«
Peaches nimmt ein Messer, schneidet die Grapefruit in der Mitte durch, zerteilt sie sorgfältig zu Schnitten und legt sie zurück in die Schale. »Jetzt kannst du sie mit dem Löffel essen, du verdammter Barbar. Hast du gewusst, dass das Wort Barbar von den Römern kommt? Heißt so viel wie >Rotschopf<. Und damit haben sie euch gemeint. Ich hab das gestern Abend im - wie heißt das gleich? -, im History Channel gesehen. Find ich spannend, solchen Scheiß.«
Es klingelt, Peaches geht nachsehen, wer da ist.
O-Bop grinst Callan an. »In dem Bademantel sieht er aus wie 'ne alte Mamma mia, findst du nicht? Sogar Titten kriegt er. Jetzt braucht er nur noch kleine rosa Pantöffelchen mit 'nem Puschel obendrauf. Ich komm mir vor wie in 'nem japanischen Horrorfilm. Fettzilla.«
Dann hören sie ihn sagen: »Komm rein, guck dir an, was die Katze gefangen hat.«
Schon kommt Little Peaches rein und schließt Callan in die Arme.
»Die haben's mir schon erzählt, aber ich konnt's nicht glauben. Wo hast du denn die Jahre gesteckt?«
»Meistens in Mexiko.«
»Gibt's dort kein Telefon?«, fragt Little Peaches. »Konntest du nicht mal durchrufen, ein Lebenszeichen von dir geben?«
»Wo sollte ich denn anrufen?« fragt Callan. »Ihr seid im Zeugenschutzprogramm. Wenn ich euch aufspüre, schaffen das auch andere.«
»Die anderen sind alle in Marion«, sagt Peaches.
Wohl wahr, denkt Callan, und das haben sie ihm zu verdanken. Big Peaches, einst alte Schule, hat sich zum sangesfreudigsten Singvogel seit Valachi gemausert. Hat Johnny Boy hinter Gitter gebracht. Lebenslänglich und noch ein paar Jährchen drauf. Aber allzu lange wird er's nicht machen. Wie es heißt, hat er Kehlkopfkrebs.
Andererseits ist es gut, dass Peaches geplaudert hat, denkt Callan. Dann wird er mich nicht bei Sal Scachi verpfeifen, dem es nicht passen wird, dass ich ihm von der Fahne gegangen bin. Callan weiß zu viel über Scachis Jobs - Red Cloud und all das Zeug -, um einfach so auf die Welt losgelassen zu werden. Also ist es gut, dass es keine Verbindung zwischen Scachi und Peaches gibt.
»Fütterst du den Kerl etwa?«, fragt Little Peaches seinen Bruder.
»Ja, genau.«
»Doch nicht diesen Scheiß!«, sagt Little Peaches. »Mein Gott, besorg ihm Sausiche, Prosciutto, Ravioli. Wenn du hier so was findest. Callan, in dem Little Italy, das es hier gibt, treibst du keine Cannoli auf, nicht mal mit dem MG. Und wenn du was zu essen bestellst, kriegst du Dörrtomaten. Was soll das? Nach ein paar Jahren wirst du selber zur Dörrtomate. Hier sind immer achtundzwanzig Grad, und immer scheint die Sonne, selbst nachts. Wie machen die das, häh? Krieg ich hier vielleicht mal 'ne Tasse Kaffee, oder muss ich die bestellen wie im Restaurant?«
»Hier hast du deinen verkackten Kaffee«, sagt Peaches.
»Danke.« Little Peaches legt eine Schachtel auf den Tisch und setzt sich. »Hier. Hab euch Donuts mitgebracht.«
»Donuts?«, fragt Peaches. »Musst du immer meine Diät sabotieren?«
»Dann friss sie nicht. Niemand zwingt dich.«
»Du dummes Arschloch!«
»Aber ich komme nicht mit leeren Händen in das Haus meines Bruders«, sagt Little Peaches zu Callan. »Bringt man Manieren mit, ist man hier ein Arschloch.«
»Ein dummes Arschloch«, korrigiert ihn Peaches und greift sich ein Donut.
»Callan«, sagt Little Peaches. »Iss auch ein Donut. Oder fünf, jeder Donut weniger, den mein Bruder frisst, erspart mir was von seinem Gejaule wegen seiner Figur. Du bist nun mal fett, Jimmy. Ein dicker, fetttriefender Spaghettifresser. Find dich damit ab.«
Sie gehen raus auf die Terrasse, weil sie finden, dass Callan ein bisschen Sonne braucht. In Wirklichkeit denkt Peaches, dass er selbst ein bisschen Sonne braucht, aber er will nicht egoistisch sein. Wozu wohnt man in San Diego, wenn man nicht jede sich bietende Gelegenheit für ein Sonnenbad nutzt?
Also pflanzt er sich in den Liegestuhl, öffnet seinen Bademantel und schmiert sich den Bauch mit Sonnenlotion ein.
»Mit Hautkrebs ist nicht zu spaßen«, sagt er.
Mickey ist weit davon entfernt, mit Hautkrebs zu spaßen. Er setzt sein Yankees-Basecap auf und verzieht sich unter den Sonnenschirm.
Peaches öffnet eine Büchse gekühlte Pfirsiche und schiebt sich ein paar Hälften in den Mund. Callan verfolgt, wie der Saft auf seine fette Brust tropft, sich mit dem Schweiß und der Sonnenlotion vermengt und langsam über seinen Bauch rinnt.
»Jedenfalls gut, dass du wieder da bist«, sagt Peaches.
»Wieso?«
»Wie fändest du ein Verbrechen«, redet Peaches weiter, »wo die Opfer nicht zur Polizei gehen können?«
»Klingt gut.«
»Klingt gut? Für mich klingt es paradiesisch.« Er erklärt Callan, worum es geht.
Die Drogen wandern nach Norden. Von Mexiko in die Staaten.
Das Geld wandert nach Süden. Von den Staaten nach Mexiko.
»Die schaufeln den Schotter einfach in Autos - manchmal zweistellige Millionensummen - und schaffen ihn über die Grenze nach Mexiko«, erklärt Peaches.
»Oder auch nicht«, ergänzt Little Peaches.
Dreimal haben sie die Nummer schon durchgezogen, und jetzt kennen sie ein Drogendepot in Anaheim, in dem Berge von Geld liegen, das nach Mexiko muss. Sie haben die Adresse, die Namen, die Automarke und das Kennzeichen. Sie wissen sogar, wann die Kuriere losfahren wollen.
»Wer gibt euch denn solche Tipps?«, fragt Callan.
»Ein Typ«, sagt Peaches.
Das hat sich Callan schon gedacht.
»Mehr brauchst du nicht zu wissen«, sagt Peaches. »Er kriegt dreißig Prozent.«
»Als würden wir wieder ins Drogengeschäft einsteigen«, meint O-Bop, »nur besser. Wir kassieren ab, ohne das Zeug auch nur anzufassen.«
»Eine einfache, saubere Sache«, meint Peaches. »Hände hoch, Geld her.«
»So wie es der Herrgott gewollt hat«, sagt Mickey.
»Also, Callan«, sagt Little Peaches. »Bist du dabei?«
»Ich weiß nicht«, sagt Callan. »Wem gehört das Geld?«
»Den Barreras«, sagt Peaches mit einem fragenden, etwas lauernden Blick, als gäbe es da ein Problem.
Ich weiß nicht, denkt Callan. Gäbe es da ein Problem?
Die Barreras sind wie Haie, keine Leute, mit denen man sich ohne weiteres anlegt. Zum einen. Zum anderen sind sie »Freunde von uns« - wenn es nach Sal Scachi geht, zumindest.
Aber sie haben diesen Priester ermordet, einfach so. Das war kein Irrtum, das war ein Anschlag. Ein eiskalter Profikiller wie Fabián »el Motherfucking Tiburon« erschießt nicht aus Versehen den Falschen. So was gibt es nicht.
Callan weiß nicht, warum sie es getan haben, er weiß nur, dass sie es getan haben.
Und mich haben sie da reingezogen. Dafür müssen sie zahlen. »Klar«, sagt Callan. »Ich bin dabei.« Die West Side Gang ist wieder vereint.
Von seinem Beobachtungsposten verfolgt O-Bop, wie das Auto auf die Straße hinausfährt.
Es ist drei Uhr morgens, und er steht mit seinem Auto einen halben Block entfernt. Sein Job ist von entscheidender Wichtigkeit: Er soll dem Kurierfahrzeug folgen, ohne bemerkt zu werden, und bestätigen, dass es auf dem Freeway 5 nach Süden fährt. Er tippt eine Nummer in sein Handy und sagt: »Es ist losgefahren.«
»Wie viele Leute?«
»Drei. Zwei vorn, einer hinten.«
Er legt das Handy weg, wartet ein paar Sekunden und startet durch.
Wie besprochen ruft Little Peaches bei Peaches an, Peaches bei Callan und Callan bei Mickey. Sie stoppen die Zeit auf ihren Uhren und warten auf den nächsten Anruf. Mickey hat die durchschnittliche Fahrzeit vom Haus bis zur Freeway-Auffahrt vorher gemessen. Sechseinhalb Minuten. Also wissen sie ziemlich auf die Minute genau, wann der nächste Anruf kommt.
Und wenn der kommt, ist der Plan am Laufen.
Kommt er nicht, müssen sie improvisieren, und das will keiner. Also haben sie angespannte sechs Minuten vor sich. Besonders O-Bop. Von ihm hängt jetzt alles ab, er kann die Sache vermasseln, wenn er entdeckt wird, er muss so fahren, dass er den Kurier sehen kann, aber selbst nicht gesehen wird. Immer mal wieder lässt er sich zurückfallen, einen Block, zwei Blocks. Er blinkt links und schaltet für einen Moment die Scheinwerfer aus, damit sie ihn für ein anderes Fahrzeug halten, wenn er sie wieder einschaltet.
O-Bop macht seinen Job.
Während Little Peaches wartet, anderthalb Stunden weiter südlich am Freeway 5, und schwitzt. Drei Minuten. Vier Minuten.
Big Peaches sitzt in Denny's Imbiss am Rand des Highway, ein bisschen nördlich von Little Peaches. Er verputzt ein Käseomelett mit Bratkartoffeln, Toast und Kaffee. Mickey mag es nicht, wenn sie vor einem Gig was essen. Werden sie angeschossen, kompliziert ein voller Bauch die Dinge, aber Peaches, dem ist das egal. Er denkt, es bringt Unglück, schon vorher daran zu denken, dass was schiefgehen könnte. Als Letztes kommen die fettigen Bratkartoffeln dran, dann wirft er ein paar Kautabletten für die Verdauung ein und nimmt sich den Sportteil vor.
Fünf Minuten.
Callan vermeidet den Blick auf die Uhr.
Er hat sich in ein Motel an der Ortega-Ausfahrt des Freeway 5 eingemietet, liegt auf dem Bett und sieht irgendeinen Film, den er nicht kennt. Warum soll er auch draußen auf dem Motorrad hocken in dieser Kälte. Wenn der Geldtransport auf die 5 hinauffährt, bleibt immer noch genügend Zeit. Auf die Uhr zu sehen ändert gar nichts, das macht nur nervös. Aber nach gefühlten zehn Minuten gibt er auf und schaut nach.
Fünfeinhalb Minuten.
Mickey sieht nicht auf die Uhr. Der Anruf kommt, oder er kommt nicht. Er parkt am Bahnhof von Oceanside, zieht an seiner Zigarette und geht Plan B durch, der in Kraft tritt, wenn der Geldtransport auf eine andere Strecke ausweicht. Eigentlich wäre die Sache dann gelaufen, und sie müssten auf die nächste Gelegenheit warten. Aber weil Peaches trotzdem dranbleiben will, müssen sie improvisieren. Müssen sich von O-Bop die neue Strecke durchgeben lassen, ihnen irgendwie den Weg abschneiden und eine günstige Stelle suchen.
Mickey mag solche Indianerspiele nicht.
Aber die Uhr ignoriert er trotzdem.
Sechs Minuten.
Little Peaches dreht fast durch.
Eine Million Cash haben sie am Haken und -
Das Telefon klingelt.
»Es läuft«, hört er O-Bop sagen.
Der drückt das Knöpfchen an seiner Uhr. Eine Stunde, achtundzwanzig Minuten beträgt die durchschnittliche Fahrzeit von der Auffahrt bis zu seinem Standort. Dann ruft er Peaches an, der zum Handy greift, ohne von der Zeitung aufzusehen.
»Es läuft.«
Peaches sieht auf die Uhr, ruft Callan an und bestellt ein Stück Kirschtorte.
Callan stellt seine Uhr ein, als der Anruf kommt, gibt die Nachricht an Mickey weiter, dann steht er auf und nimmt eine lange, heiße Dusche. Er hat es nicht eilig, will locker und entspannt bleiben, also lässt er sich das heiße Wasser genüsslich auf die Schultern prasseln. Schon macht sich das Adrenalin bemerkbar, aber damit er nicht zu schnell in Fahrt kommt, rasiert er sich ganz langsam und gründlich, und er registriert mit Befriedigung, dass seine Hände nicht mehr zittern.
Auch mit dem Anziehen lässt er sich Zeit. Schwarze Jeans, schwarzes T-Shirt, schwarzes Sweatshirt. Schwarze Socken, schwarze Bikerstiefel, schusssichere Weste. Dann die schwarze Lederjacke, enge schwarze Handschuhe. Bezahlt hat er im Voraus, unterschrieben mit falschem Namen, er kann einfach so verschwinden. Den Schlüssel lässt er im Zimmer liegen.
Für O-Bop ist es jetzt leichter. Nicht leicht, aber leichter, da er weit zurückbleiben kann und nur dann näher heranfahren muss, wenn eine Abfahrt kommt, weil er aufpassen muss, dass sie nicht plötzlich ausscheren und zur 57 oder 22 rüberfahren, zur Laguna Beach Road oder zum Ortega Highway. Aber Peaches hat ganz richtig vermutet, dass diese Jungs geradewegs auf ihr Ziel zusteuern - sie bleiben die ganze Zeit auf dem Freeway nach Mexiko. O-Bop lässt sich zurückfallen, damit er telefonieren kann, ohne abgehört zu werden, und gibt Little Peaches die Einzelheiten durch. »Blauer BMW, UZ 1 832. Drei Leute. Die Taschen sind im Kofferraum.« Letzteres ist nicht so willkommen, weil es einen zusätzlichen Schritt erfordert, wenn sie das Auto gestoppt haben, aber natürlich hat Mickey auch diese Option mit ihnen durchgespielt, weshalb sich O-Bop keine allzu großen Sorgen macht.
Aber Mickey.
Mickey macht sich richtig Sorgen. Er wartet, bis der Bahnschalter öffnet, kauft eine Fahrkarte nach San Diego, dann geht er rüber zur Greyhound-Station und kauft ein Ticket nach Chula Vista. Danach geht er wieder zurück zum Wagen und wartet. Und macht sich Sorgen. Sie haben das Dutzende Male geübt, aber Sorgen macht er sich trotzdem. Zu viele Ungewissheiten. Wenn es nun einen Stau gibt? Wenn Polizei in der Nähe ist? Der Transport von einem zweiten Auto gedeckt wird, von dem wir nichts wissen?
»Wenn meine Tante Eier hätte, wäre sie mein Onkel«, hat Peaches gesagt, als er ihm mit seinen Sorgen kam. Jetzt ist Peaches mit seiner Torte fertig, er trinkt den Kaffee aus, legt Geld hin, Trinkgeld auch (nicht zu viel und nicht zu wenig, schließlich will er nicht auffallen), und geht hinaus zum Auto. Nimmt die Pistole aus dem Handschuhfach, legt sie flach auf den Schoß und prüft die Ladung. Alle Patronen sind noch da, wie zu erwarten, aber es ist eine Gewohnheit, ein Reflex. Am meisten schreckt ihn die Vorstellung, dass er irgendwann abdrückt und das trockene Klicken einer leeren Kammer hört. Er verstaut die Pistole im Knöchelhalfter und startet durch.
Jetzt sind alle auf ihrem Posten: Little Peaches an der Straße nach Calafia, Peaches an der Abfahrt nach Ortega, Callan auf dem Motorrad an der Abfahrt Dana Point, Mickey am Bahnhof von Oceanside, O-Bop auf dem Freeway 5, in sicherem Abstand zum Geldtransport.
Alle an ihrem Platz.
In Erwartung der Beute.
Die geradewegs hineinrollt in die Falle.
O-Bop ruft durch: »Noch eine halbe Meile.«
Little Peaches sieht das Auto vorbeifahren. Senkt den Feldstecher, greift nach dem Handy. »Jetzt.«
Callan fährt raus auf den Highway. »Alles klar.«
Peaches: »Verstanden.« Mickey stoppt die Zeit.
Callan sieht das Auto im Rückspiegel, wird langsamer und lässt sich überholen. Keiner von den Insassen würdigt ihn eines Blickes. Ein einsamer Biker im Morgengrauen, auf der Fahrt nach Süden. Noch zwanzig Minuten bis zur wenig befahrenen Strecke bei Pendieton, wo er die Sache durchziehen will, also bleibt er zurück, behält aber die Rücklichter im Blick. Verkehr gibt es vor allem in Richtung Norden, nicht nach Süden, und die paar Autos, die jetzt noch zu sehen sind, werden hinter San Clemente, dem letzten Ort von Orange County, ebenfalls verschwinden.
Er passiert Basilone Road, die berühmten Surferstrände, dann die zwei Kuppeln des Atomkraftwerks von San Onofre, den Kontrollpunkt für die Nordrichtung des Freeway 5, danach wird es ruhig und leer. Zur Rechten nichts als Dünen und Ozean, jetzt langsam vom blassen Licht der Sonne erfasst, die links über dem Black Mountain aufsteigt.
Callan trägt einen Helm mit eingebautem Headset.
Er sagt ein einziges Wort: »Los?«
Mickey antwortet: »Los.«
Callan dreht voll auf, duckt sich in den Wind und spurtet auf den BMW zu. Zieht mit ihm gleich, ziemlich genau an der geplanten Stelle - auf der langen Geraden vor der Rechtskurve in Richtung Ozean.
Der Fahrer bemerkt ihn erst, als er neben ihm ist. Callan sieht, wie der Fahrer erschrickt und aufs Gas geht. Die Gefahr, wegen Rasens gestoppt zu werden, zählt nicht mehr, jetzt zählt nur noch die Todesangst. Der BMW schießt davon.
Aber nur kurz.
Wozu haben sie sich eine Harley besorgt? Eine Rennsau, die im Wesentlichen aus zwei Rädern, Motor und Sattel besteht? Eine Harley lässt sich von so einer Yuppie-Kutsche nicht abhängen. Erst recht nicht, wenn die Yuppie-Kutsche mit Millionen Dollar beladen ist.
Fahren sie hundertvierzig, fährt er auch hundertvierzig.
Beschleunigen sie auf hundertachtzig, zieht er ohne Mühe mit.
Weichen sie nach rechts aus, bleibt er dran, weichen sie nach links aus, bleibt er dran.
Der BMW erreicht die zweihundert, Callan auch.
Und nun beherrscht ihn das Adrenalin. Es treibt ihn an wie das Benzin den Motor. Fahrer und Maschine sind eins, sie fliegen dahin wie im Rausch, dicht dran am BMW, der nun nach links zieht und ihn rammen will und es beinahe schafft, Callan muss aus der Spur, bei zweihundert, kommt ins Schleudern, kann sich gerade noch fangen, ein Sturz bei diesem Tempo würde von ihm nur eine Blutspur und ein bisschen Hackfleisch übrig lassen. Jetzt hat der BMW zehn Meter Vorsprung, das hintere Seitenfenster öffnet sich, eine Macio schiebt sich raus und fängt an zu ballern wie eine Bordkanone.
Aber wahrscheinlich hat Peaches recht - bei dieser Geschwindigkeit kann man nicht richtig treffen, und Callan weicht aus, schwenkt nach rechts, schwenkt nach links, bis die Jungs im BMW einsehen, dass es besser ist, die Flucht nach vorn anzutreten.
Sie ziehen mit zweihundertzehn, zweihundertzwanzig davon.
Da kommt auch die Harley nicht mehr mit.
Deshalb hat Callan diesen Streckenabschnitt gewählt, eine lange Gerade, die in einer Rechtskurve endet, einer Rechtskurve, die mit diesem Tempo nicht zu meistern ist. Das ist das Gemeine an der Physik, man kann sie nicht außer Kraft setzen. Entweder, man geht vom Gas und lässt sich von dem Biker abknallen, oder man wird von der Straße katapultiert wie ein Düsenjäger vom Flugzeugträger. Nur dass der Düsenjäger nicht fliegen kann.
Da nehmen sie lieber den Biker in Kauf.
Eine schlechte Wahl.
Callan schert nach links aus, und genau am Beginn der Kurve ist er gleichauf mit dem Fahrer, der fast durchdreht, als er die 22er so dicht neben sich sieht. Callan gibt einen Schuss ab, um die Scheibe zu zersplittern, dann -
Plopp plopp.
Immer zwei Schuss, dicht hintereinander, weil der zweite den ersten automatisch korrigiert. Obwohl das in diesem Fall nicht nötig ist. Beide Schüsse treffen genau ins Schwarze.
Die zwei Geschosse schwirren im Schädel des Fahrers umher wie Kugeln im Flipperautomaten.
Deshalb ist die 22er Callans Lieblingswaffe. Die Durchschlagskraft reicht nicht, um den Schädel zweimal zu durchschlagen. Die Kugel fliegt stattdessen kreuz und quer, sucht verzweifelt nach dem Ausgang, lässt noch mal schnell alle Lichter aufblinken, bevor es dunkel wird.
Game over.
Kein Bonusspiel.
Der BMW spielt seine 360 PS aus und fliegt aus der Kurve. Behält aber - deutsche Ingenieurkunst - die Balance. Die zwei anderen Jungs befinden sich noch in Schockstarre, als Callan mit der Harley kommt und -
Plopp-plopp.
Plopp-plopp.
Callan fährt zurück auf den Freeway.
Drei Sekunden später hält Little Peaches hinter dem BMW. Steigt aus, das Gewehr in der linken Hand, für alle Fälle, und öffnet die Fahrertür des BMW. Beugt sich über den toten Fahrer, zieht den Zündschlüssel, geht nach hinten, holt die zwei Aktenkoffer aus dem Kofferraum, lädt sie in sein Auto und fährt auf den Freeway hinaus.
Mindestens ein Dutzend Autofahrer dürften diese Szene in Teilen verfolgt haben, aber keiner hält an oder verfolgt Little Peaches, denn Little Peaches fährt einen Wagen der kalifornischen Straßenwacht, trägt die korrekte Uniform, also muss jeder denken, er hat die Dinge im Griff.
Und das hat er auch.
Fährt in aller Seelenruhe Richtung Süden.
Er muss nicht befürchten, von einer echten Streife gestoppt zu werden, denn kurz vorher, streng nach Mickeys Uhr, hat Big Peaches den Kippschalter einer Fernzündung umgelegt, und ein alter Dodge, der dort in der Gegend stand, geht hoch wie Opas Geburtstagstorte. Als Big Peaches seinem nächsten Job entgegenfährt, hört er schon die Sirenen nahen. Er steuert den Parkplatz einer Golfanlage nördlich von Oceanside an und wartet dort, bis Little Peaches neben ihm hält. Little Peaches nimmt die beiden Aktenkoffer und steigt aus dem Streifenwagen ins andere Auto um. Und während Big Peaches zum Bahnhof von Oceanside fährt, entledigt sich Little Peaches der Uniform.
O-Bop ist an dem gestrandeten BMW vorbeigekommen, daher weiß er, dass die Sache mindestens bis dahin geklappt hat, und steuert die Ausfahrt zum Highway 76 an. Innerhalb des Kleeblatts gibt es einen kleinen Parkplatz, und dort hat sich Callan postiert. Er lässt die Harley stehen und steigt zu O-Bop ins Auto. Zusammen fahren sie zum Bahnhof.
Wo Mickey in seinem Wagen wartet, die Augen auf der Uhr, während die Zeit abläuft.
Entweder die Sache ist gelaufen, oder seine Freunde sind tot, verletzt, verhaftet.
Dann sieht er Little Peaches auf den Parkplatz einbiegen. Sie bleiben im Auto sitzen, bis der Zug angekündigt wird, und sehen ihn kommen, aus Richtung San Diego. Brav in Anzüge gekleidet steigen sie aus, jeder mit Aktenkoffer, einem Pappbecher mit Kaffee und einer kleinen Reisetasche über der Schulter - so wie jeder andere Geschäftsmann, der sich sputet, den Zug nach L. A. zu erwischen. Mickey steckt ihnen die Fahrkarten zu, als sie an seinem Auto vorbeigehen. Erst kurz vor der Abfahrt steigen sie in ihre Züge - Mickey hat diesen Bahnhof ausgesucht, weil sich hier die Züge kreuzen, der Fernzug nach L. A. mit dem Vorortzug nach San Diego. Peaches besteigt mit dem Aktenkoffer den Fernzug, Little Peaches mit seinem Aktenkoffer den Vorortzug.
Als die Züge weg sind, kommen Callan und O-Bop auf den Parkplatz gefahren und steigen aus. Kurzgeschoren wie Marines und in den ältlichen Sachen, wie sie Marines tragen, wenn sie auf Urlaub gehen. Die Seesäcke über der Schulter, laufen sie an Mickeys Auto vorbei, holen sich ihre Tickets und gehen weiter zur Bushaltestelle direkt am Bahnhof. Ein paar Marines aus Pendleton eben.
O-Bop steigt in den Bus nach Escondido, Callan in den Bus nach Hemet.
Peaches hat eine Fahrkarte nach L.A., aber er steigt vorher aus. Kurz vor Santa Ana geht er auf die Toilette, wechselt vom Anzug in kalifornische Freizeitkluft und kommt erst heraus, als der Zug hält. Er steigt aus und mietet sich in einem Motel ein. Little Peaches macht es ganz ähnlich, nur fährt er Richtung Süden, steigt im Surferparadies Encinitas aus und mietet eins der alten Motel-Cottages zwischen Bahnhof und Strand.
Und Mickey fährt einfach zurück in sein Hotel. Er war nirgends dabei, und wenn die Cops ihn aufspüren und ausquetschen wollen, hat er ihnen nichts zu erzählen. Er hält sich brav ans Tempolimit, geht ins Bett und holt ein bisschen Schlaf nach.
Callan und O-Bop fahren bis an ihre Zielorte. O-Bop bezieht ein Liebeshotel neben einem Pornoshop, dort kann er sich vergnügen und hat Beschäftigung, während er in Deckung bleibt. Er legt die Tasche ab und geht gleich nach nebenan, kauft sich Spielchips für zwanzig Dollar und füttert den halben Nachmittag lang die Videoautomaten.
Callan sitzt im Bus und versucht zu vergessen, dass er gerade wieder drei Menschen ermordet hat, aber es geht nicht. Er spürt nicht die gewohnte Leere, er spürt etwas, was er nicht benennen kann.
Ich vergebe dir. Gott vergibt dir.
Dieser Mist geht ihm einfach nicht aus dem Kopf.
Er steigt aus und sucht sich ein Motel. Das Zimmer stinkt nach Desinfektionsmitteln, ist aber besser als das Golden West. Und es hat Kabelfernsehen. Callan wirft sich aufs Bett und guckt Filme.
Er hat vor, ein paar Tage abzutauchen, und wenn sich die Wogen geglättet haben, wollen sie sich in La Jolla treffen, im Sea Lodge, ein bisschen am Strand rumhängen, ein paar Bräute bei Haley Saxon chartern (Peaches sagt wirklich »Bräute«) und mal so richtig feiern.
Callan hat das Mädchen nicht vergessen, das er dort getroffen hat. Nora. Hat nicht vergessen, dass er sie unbedingt wollte, dass Big Peaches sie ihm weggenommen hat. Hat nicht vergessen, wie schön sie war. Wenn er diese Schönheit für sich haben kann, ist sein eigenes Leben vielleicht weniger hässlich. Aber die Sache ist lange her, viel Blut ist seither den Bach runtergeflossen, und Nora gibt es dort längst nicht mehr. Oder?
Aber nach ihr fragen will er auch nicht.
Drei Tage später hängt Peaches am Telefon und gibt eine Bestellung auf wie beim Chinesen. Was willst du haben? Was Blondes, Brünettes oder vielleicht 'ne Schwarze? Sie hocken alle bei ihm im Zimmer, obwohl sie eine ganze Zimmerflucht angemietet haben, direkt am Strand. Keine schlechte Sache, denkt Callan. Du gehst aus dem Zimmer und bist schon am Strand, und er kann sich an diesem wunderbaren Sonnenuntergang ergötzen, während Peaches am Telefon Frischfleisch bestellt.
»Egal«, sagt Callan.
»Und einmal egal«, sagt Peaches in den Hörer. Danach schmeißt er sie raus, weil er noch Geschäftliches zu bereden hat. Also heißt es schwimmen, duschen, ein bisschen was essen und dann bereitmachen für die Bräute.
Der Mann, mit dem Peaches reden will, kommt eine Stunde später, als es schon dunkel ist.
Viel zu bereden gibt es nicht. Peaches reicht ihm einen Koffer mit dreihunderttausend Dollar - das ist sein Anteil für den Tipp, den er gegeben hat.
Art Keller nimmt den Koffer entgegen und geht.
Nichts einfacher als das.
Auch Haley Saxon hat geschäftlich zu tun.
Sie sucht fünf Mädchen fürs Sea Lodge aus, dann wählt sie die Nummer von Raúl Barrera.
Ein paar Mafiosi, die früher mal da waren, sind wieder aufgetaucht und werfen nur so mit Geld um sich. Erinnerst du dich an einen Jimmy Peaches? Genau. Der ist plötzlich zu einer Menge Geld gekommen.
Raúl ist hellwach.
Und natürlich weiß Haley auch, wo sie stecken. Aber meine Mädchen hältst du da raus.
Callan liegt im Bett und sieht dem Mädchen beim Anziehen zu.
Sie ist hübsch, wirklich hübsch - langes rotes Haar, netter Vorbau, netter Arsch -, aber es war nicht sie. Obwohl, sie hat ihm die Hölle heiß gemacht, hat ihm was geboten fürs Geld. Ihm erst einen geblasen, dann einen Ritt vorgelegt, bis er kam.
Jetzt steht sie im Bad und bringt ihr Make-up in Ordnung, sieht im Spiegel, dass er sie beobachtet.
»Wir können noch mal, wenn du willst«, sagt sie.
»Danke, bin zufrieden.«
Als sie weg ist, wickelt er sich ein Handtuch um die Hüfte und geht raus auf die kleine Terrasse. Beobachtet das silbrige Glitzern der Wellen im Mondlicht. Weiter draußen, etwa hundert Meter entfernt, sieht er ein hübsches Sportfischerboot mit strahlender Beleuchtung.
Es wäre verdammt ruhig hier, denkt Callan, wenn ich Big Peaches nicht hören würde, der nebenan noch immer die Puppen tanzen lässt. Und wieder hat er die Dein-Mädchen-gefällt-mir-besser-Nummer durchgezogen. Little Peaches war es egal. Er hatte seine Erwählte schon auf sein Zimmer geschickt und gesagt: Nimm sie dir. Also haben sie Frau und Zimmer getauscht, und deshalb muss sich Callan nun Big Peaches anhören, der ächzt und schnauft wie ein asthmatischer Stier.
Am Morgen finden sie die Leiche von Little Peaches.
Mickey klopft bei Callan, und als Callan »Herein« ruft, packt ihn Mickey einfach bei der Hand und zieht ihn ins Zimmer von Big Peaches. Da sitzt Little Peaches an einen Stuhl gefesselt, die Hände in den Taschen.
Nur dass die Hände nicht mehr an den Armen hängen.
Sie sind abgeschnitten, der Teppich ist von seinem Blut durchtränkt.
Sie haben ihm einen Waschlappen in den Mund gestopft, seine Augen sind vorgequollen. Man muss kein Sherlock Holmes sein, um zu erraten, was hier passiert ist.
Callan hört Big Peaches im Badezimmer heulen und kotzen. O-Bop sitzt auf dem Bett und stützt den Kopf in die Hände.
Das Geld ist natürlich weg.
Im Schrank liegt nichts als ein Zettel. Behaltet die Hände in der eigenen Tasche. Die Barreras.
Peaches kommt aus dem Bad. Sein Gesicht ist rot und nassgeheult, aus seiner Nase kommen Rotzblasen. »So können wir ihn nicht zurücklassen«, jammert er.
»Müssen wir aber«, sagt Callan.
»Die kriege ich«, sagt Peaches. »Und wenn ich dabei draufgehe. Denen zahle ich's heim.«
Sie packen nicht, steigen einfach in ihre Autos und fahren ab. Callan fährt nach Norden, immer geradeaus, an San Francisco vorbei, versteckt sich in einem kleinen Motel.
Raúl Barrera hat sein Geld zurück, bis auf die fehlenden dreihunderttausend.
Das ist das Geld, das an den Tippgeber der Piccone-Brüder ging, so viel ist klar.
Aber - und das muss man Little Peaches lassen, der Mann blieb hart -, er hat nicht verraten, wer es war.
Hat behauptet, er wisse es nicht.
Callan verkriecht sich in Seaside, Kalifornien.
Er sucht sich ein Motel, das aus alten Strandhütten besteht, und zahlt bar. In den ersten Tagen geht er kaum hinaus. Dann beginnt er seine langen Spaziergänge am Meer.
Wo die Brandung immer dieselben Worte raunt.
Ich vergebe dir.
Gott...
11 Die schlafende Schöne
Doch umso mehr war er erstaunt, dass Eva
Noch unerwacht mit wirren Locken lag,
Mit glühenden Wangen, wie von ruhelosem Schlaf wild erhitzt...
John Milton, Das verlorene Paradies
Rancho las Bardas Baja, Mexiko
März 1997
Nora schläft mit dem Herrn der Himmel.
So heißt Adán jetzt in der Drogenszene - el Señor de los Cielos. Der Herr der Himmel.
Und wenn er der Herr ist, ist Nora die Herrin.
Ihre Affäre ist kein Geheimnis mehr. Sie sind fast immer zusammen. Und nicht ganz ohne Ironie wird sie von den Narcos als la Güera bezeichnet, »die Blonde«, Adáns goldhaarige Mätresse, seine Beraterin.
Gúero wurde in Guamuchilito zur letzten Ruhe gebettet.
Die ganze Stadt nahm an der Beerdigung teil.
Auch Adán und Nora. Er im schwarzen Anzug, sie mit schwarzem Kostüm und Schleier. So sah man sie im Trauerzug hinter dem blumengeschmückten Katafalk. Eine Mariachi-Kapelle spielte tränenselige Corridos, während sich die Prozession durch die Stadt bewegte, beginnend an der von Gúero gestifteten Kirche, vorbei an der Klinik und dem Fußballplatz, die ebenfalls von ihm bezahlt sind, bis zum Mausoleum mit den sterblichen Überresten seiner Frau und seiner Kinder.
Er wurde lautstark beweint, Trauernde rannten nach vorn zum offenen Sarg und warfen Blumen hinein.
Sein Gesicht wirkte ruhig, gelassen, fast heiter. Das blonde Haar war glatt zurückgekämmt, und statt der zu Lebzeiten bevorzugten schwarzen Cowboykluft trug er einen teuren anthrazitfarbenen Anzug mit roter Krawatte.
Überall sah man Sicarios - die von Adán und die alten Getreuen von Gúero, .aber ihre Pistolen blieben pietätvoll unter Hemden und Jacken verborgen. Und obwohl Adáns Leute alles scharf im Blick behielten, machte sich niemand allzu große Sorgen, dass es einen Anschlag geben könnte. Der Krieg war vorüber, Adán Barrera hatte gesiegt, und zudem legte er eine bewundernswerte Haltung an den Tag.
Einem Vorschlag Noras war es zu verdanken, dass Gúero in seiner Heimat, bei seiner Familie liegen durfte und dass sie beide demonstrativ an der Beerdigung teilnahmen, an prominenter Stelle. Sie hatte Adán auch geraten, die Kirche, die Klinik und den Sportplatz mit ansehnlichen Geldspenden zu unterstützen. Und ein Gemeindezentrum zu finanzieren, das den Namen des verstorbenen Héctor »Gúero« Méndez Salazar tragen sollte. Und vorher Emissäre auszusenden, die Gúeros Leuten verkündeten, dass Frieden sei, dass es keine Vergeltung geben werde, dass die Geschäfte weiterlaufen würden wie gewohnt. Adán nahm also als Sieger an der Prozession teil, aber er hielt einen Ölzweig in der Hand.
Im Mausoleum kniete er, ebenfalls auf Noras Rat, vor den Bildern von Pilar, Claudia und Gúerito nieder und betete für ihr Seelenheil. Jedem der Toten zündete er eine Kerze an, dann senkte er den Kopf und widmete sich dem stillen Gebet.
Auf die Leute draußen verfehlte diese schäbige kleine Komödie nicht ihre Wirkung. Sie wussten, wie das lief, sie waren gewöhnt an Mord und Totschlag und irgendwie auch an Versöhnung und Vergessen. Als Adán aus dem Mausoleum kam, schien niemand mehr daran zu denken, dass die Toten vor allem auf sein Konto gingen.
Mit Gúero wurden auch die Erinnerungen an den Krieg begraben.
So hatten Adán und Nora es schon bei der Beerdigung von el Verde und García Abrego gemacht, und überall, wohin sie kamen, lief es nach diesem Muster. Mit Nora an seiner Seite eröffnete er Schulen, Kliniken, Spielplätze - und stets im Namen der Verstorbenen. Mit deren früheren Geschäftspartnern traf er sich privat, bot ihnen Frieden, Vergebung, Schutz und verminderte Abgaben an.
Schnell hieß es: Entweder Adán oder Raúl, du hast die Wahl. Die kluge Mehrheit entschied sich für Adán, die weniger Klugen bekamen ein würdiges Begräbnis.
Die Federación war wieder da, und Adán war ihr patrón.
Mit dem Frieden kam der Wohlstand.
Am l. Dezember 1994 wurde der neue mexikanische Präsident in sein Amt eingeführt, und schon am Tag darauf begannen zwei von der Federación kontrollierte Maklerfirmen damit, Staatsanleihen aufzukaufen. In der Woche daraufzogen die Drogenkartelle ihr Kapital aus der mexikanischen Nationalbank ab und zwangen den Präsidenten zu einer Abwertung des Peso um fünfzig Prozent. Darauf, kurz vor Weihnachten, löste die Federación ihre Anleihen ein und brachte die Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs. Feliz Navidad.
Die Federación kaufte Eigentumswerte, Immobilien und Pesos zum Spottpreis auf und wartete ab. Dem mexikanischen Staat war es unmöglich, die Staatsanleihen zu bedienen, er war mit fünfzig Milliarden Dollar verschuldet. Das Kapital floh schneller aus dem Land als ein ertappter Priester aus dem Bordell.
Mexiko war nur noch Tage vom Staatsbankrott entfernt, als die amerikanische Kavallerie einritt - in Gestalt eines Fünfzig-Milliardendollar-Kredits zur Stützung der Wirtschaft. Der US-Präsident hatte keine andere Wahl: Er und sämtliche Kongressabgeordnete bekamen verzweifelte Anrufe von den großen Wahlkampfsponsoren der Citicorp, und sie rückten den Milliardenkredit raus, als wäre es ein Pappenstiel. '
Der neue mexikanische Präsident musste die Drogenbarone förmlich auf Knien anbetteln, die Wirtschaft mit ihren Narco-Dollars wieder in Schwung zu bringen und den Staat wieder zahlungsfähig zu machen. Und die Drogenbarone waren jetzt um Milliarden reicher als vor der »Peso-Krise«, weil die abgewerteten Pesos, die sie in großem Stil aufgekauft hatten, wieder an Wert gewannen, nachdem die Amerikaner mit ihrer gewaltigen Kreditspritze gekommen waren.
Im Wesentlichen,hatte die Federación das Land gekauft, teuer zurückverkauft, dann billig aufgekauft, um Investitionen zu tätigen und abzuwarten, wie sie sich rentierten.
Gnädig nahm Adán die Einladung des mexikanischen Präsidenten an. Der Preis, den er dafür forderte, dass Narco-Dollars zurück ins Land flossen, war ein »günstiges Geschäftsklima«.
Mit anderen Worten: El Presidente konnte lautstark verkünden, er werde den Drogenkartellen das Genick brechen, solange er seinen Worten keine Taten folgen ließ. Denn die hätten nicht den Drogenkartellen, sondern ihm selbst das Genick gebrochen.
Die Amerikaner wussten das. Sie überreichten ihm eine Liste von hohen Parteifunktionären, die von der Federación bezahlt wurden, und plötzlich waren drei von diesen Leuten zu Provinzgouverneuren ernannt, ein weiterer wurde Verkehrsminister, und derjenige, der die Liste erstellt hatte, schoss den Vogel ab: Er wurde der Drogenzar - ernannt zum Chef der Nationalen Behörde zur Drogenbekämpfung.
Alles wie gehabt.
Nein, sogar noch besser. Denn mit den massiven Profiten aus der Peso-Krise kaufte Adán Flugzeuge.
Keine zwei Jahre hat er gebraucht, um eine Flotte aus dreiundzwanzig Boeing 727 aufzubauen - mehr, als die meisten Drittweltländer aufzubieten haben. In Cali mit Kokain beladen, fliegen sie zivile und militärische Flughäfen an, sie landen sogar auf Autobahnen, die vorher gesperrt und von der Armee gesichert werden, bis die kostbare Fracht gelöscht ist.
Die Ware wird auf Kühlschlepper verladen und in grenznahen Lagerhäusern deponiert, wo sie in Portionen aufgeteilt und in Fahrzeugen verstaut wird, die Wunderwerke der Ingenieurkunst darstellen. Eine ganze Industrie ist in der Baja-Region entstanden, unzählige »Bastelkünstler« sind damit beschäftigt, diese Fahrzeuge mit versteckten Hohlräumen zu versehen, mit doppelten Dächern, doppelten Böden, falschen Stoßstangen. Wie in jedem Wirtschaftszweig haben sich Spezialisten herausgebildet - es gibt geniale Bastler und begnadete Schleifer und Maler. Manche schaffen Kunstwerke aus Zweikomponentenkitt, von denen venezianische Stuckateure nur träumen können. Mit den präparierten Fahrzeugen wird die Ware in die USA transportiert, in San Diego oder L. A. gebunkert, dann weitergeleitet nach Seattle, Chicago, Detroit, Cleveland, Philadelphia, Newark, New York und Boston.
Auch per Schiff werden Drogen transportiert - vom mexikanischen Landeplatz zur Küste, wo es vakuumverpackt auf Fischkutter und Privatboote umgeladen und vor der kalifornischen Küste abgeworfen wird, um dann von Schnellbooten und manchmal sogar Tauchern aufgefischt zu werden.
Aber zu Fuß geht es auch. Die Anfänger unter den Großdealern packen das Zeug einfach in Rucksäcke und lassen es von Grenzgängern durch die Kontrollen oder durch den Sperrzaun schmuggeln - gegen das Versprechen einer Prämie von, sagen wir, fünftausend Dollar, wenn es ihnen gelingt, die Ware am vereinbarten Ort abzuliefern. Zum Teil besteht das Grenzland aus Wüste und hohen Bergen, und immer wieder finden Grenzstreifen die Leichen solcher Schmuggler, die verdurstet oder in den Bergen erfroren sind, weil sie nicht genug Wasser oder Decken dabeihatten, wohl aber eine große Ladung Kokain.
Das Kokain wandert nordwärts, das Geld wandert südwärts - dieser Kreislauf hat sich sehr beschleunigt, seit die NAFTA die Grenzkontrollen und den Warenverkehr zwischen USA und Mexiko erleichtert. Und mit dem Warenverkehr auch den Drogenverkehr.
Der ist einträglicher als je zuvor, weil Adán seine neue Marktmacht nutzt, um mit den Kolumbianern bessere Verträge auszuhandeln, die vor allem besagen: Wir nehmen euch das ganze Kokain ab, doch um den Vertrieb kümmern wir uns lieber selbst, vielen Dank. So können wir uns die tausend Dollar Lieferkosten pro Kilo sparen.
Dasnordamerikanische(Drogen-)Freihandelsabkommen, denkt Adán.
Gott segne den Freihandel.
Seit Adán die Geschäfte führt, hat das alte mexikanische Trampolin seine Bedeutung verloren. Warum springen, wenn man fliegen kann? .
Und Adán kann fliegen.
Er ist der Herr der Himmel.
Auch wenn die goldenen Zeiten nicht wiederkehren.
Denn Adán ist Realist genug, um zu wissen, dass nach dem Mord an Parada nichts mehr so sein kann, wie es war. Technisch gesehen steht er immer noch auf der Fahndungsliste, die »neuen Freunde« in Los Pinos haben eine Belohnung von fünf Millionen Dollar auf die Barrera-Brüder ausgesetzt, beim amerikanischen FBI stehen sie auf der Liste der Meistgesuchten, ihre Fotos zieren sämtliche Grenzübergänge und Regierungsämter Mexikos.
Natürlich nur zum Schein. Um die Amerikaner ruhigzustellen. Die mexikanische Justiz ist so eifrig hinter den Barrera-Brüdern her, wie sie bemüht ist, den Drogenhandel zu unterbinden - nämlich gar nicht.
Trotzdem dürfen die Barreras nicht auftrumpfen, dürfen die Justiz nicht vorführen, so lautet die stillschweigende Übereinkunft. Und das heißt: keine Partys mehr, keine Galadinner, keine Discos, keine vorderen Plätze mehr bei Pferderennen und Boxkämpfen. Die mexikanische Regierung muss den Amerikanern glaubhaft versichern können, dass sie die Barreras sofort verhaften würde, wenn sie denn wüsste, wo sie sich verstecken.
Daher wohnt Adán nicht mehr in seinem großen Haus in der Colonia Hipódromo, besucht nicht mehr seine Restaurants, sitzt nicht mehr in der hinteren Ecke, um seine Abrechnungen vorzunehmen. Und all das vermisst er nicht. Weder sein Haus noch die Restaurants. Wohl aber seine Tochter.
Lucia und Gloria sind in die USA übergesiedelt, sie wohnen jetzt in Bonita, einem ruhigen Vorort von San Diego. Gloria besucht die katholische Schule, Lucia die örtliche Kirche. Einmal wöchentlich trifft sie auf dem Parkplatz des Shopping Center mit einem Kurier zusammen, der ihr einen Umschlag mit siebzigtausend Dollar übergibt.
Einmal im Monat fährt Lucia mit Gloria nach Mexiko zu ihrem Vater.
Sie treffen sich in entlegenen Hotels oder auf einem Picknickplatz an der Straße nach Tecate. Adán lebt für diese Treffen. Gloria ist jetzt zwölf, und sie begreift allmählich, warum ihr Vater nicht bei ihnen wohnen kann, warum er nicht in die Vereinigten Staaten darf. Er versucht ihr zu erklären, dass man ihn zu Unrecht bezichtigt, dass die Amerikaner den Barreras alle Sünden der Welt aufbürden wollen.
Aber meistens reden sie über harmlosere Dinge - wie es in der Schule läuft, welche Musik sie hört, welche Filme sie gesehen hat, welche Freundinnen sie hat und was sie zusammen unternehmen. Sie wird natürlich größer, aber auch ihre Missbildungen wachsen mit, sogar schneller als zuvor. Das Gewächs an ihrem Hals zieht ihren ohnehin zu schweren Kopf nach unten und nach links, so dass ihr auch das Sprechen immer schwerer fällt. Manche Kinder in der Schule hänseln sie und nennen sie Elephant Girl. Es ist nun mal so, denkt er. Kinder sind grausam.
Er weiß, dass es sie verletzt, aber sie tut es mit einem Schulterzucken ab.
»Das sind Idioten«, sagt sie. »Mach dir keine Sorgen, ich habe Freunde.«
Aber er macht sich Sorgen - wegen ihrer Gesundheit, wegen ihrer schlechten Krankheitsprognose. Jedes Mal, wenn der Besuch zu Ende geht, muss er mit den Tränen kämpfen. Wenn Gloria im Auto sitzt, redet er mit Lucia, will sie zur Rückkehr nach Mexiko überreden, aber sie geht nicht darauf ein.
»Ich will doch nicht leben wie ein Flüchtling«, sagt sie. Außerdem hat sie Angst in Mexiko, Angst vor einem neuen Krieg, Angst um ihre Tochter.
Das sind schon Gründe genug, aber Adán kennt die wahren Gründe - sie ist voller Verachtung für ihn. Sie schämt sich für ihn, für seinen Lebensunterhalt, will das so weit von sich fernhalten wie nur möglich, will sich ihrer Tochter widmen - in der friedvollen Umgebung eines amerikanischen Vororts.
Aber das Geld nimmt sie trotzdem, denkt Adán. Den Kurier schickt sie nicht weg. Er versucht, den bitteren Nachgeschmack loszuwerden. Und Nora hilft ihm dabei.
»Du musst sie verstehen«, sagt sie. »Sie braucht eine normale Umgebung für ihre Tochter, auch wenn es hart für dich ist.«
Seltsam, denkt Adán. Die Geliebte übernimmt die Rolle der Ehefrau, aber er achtet das sehr an ihr. Sie hat ihm tausendmal gesagt, dass er sein Familienleben wiederherstellen soll, wenn es denn geht, und dass sie sich sofort zurückziehen wird.
Aber Nora ist seine Trösterin.
Wenn er ehrlich ist, muss er zugeben, dass ihm die Entfremdung von seiner Frau die Freiheit verliehen hat, mit Nora zu leben.
Nein, trotz allem: Der Herr der Himmel genießt seinen Höhenflug. Bis -
Der Kokainnachschub stockt.
Nicht plötzlich, sondern allmählich. Wie eine schleichende Dürre.
Schuld ist die verfluchte DEA.
Erst haben sie das Medellin-Kartell geknackt. (Fidel »Rambo« Cardona hat seinen alten Freund Pablo Escobar verraten und die Amerikaner auf seine Spur gehetzt, die ihn dann erledigten.) Danach nahmen sie sich Cali vor. Sie zogen die Orejuela-Brüder aus dem Verkehr, als sie von einem Treffen mit Adán in Cancún zurückkehrten. Beide Kartelle zerbrachen in kleine Stücke - in »Baby Beils«, wie Adán sie taufte.
Was auch ganz klar ist, denkt Adán, unter dem ständigen amerikanischen Beschuss überleben nur die Kleinen und Unauffälligen, die das Radar unterlaufen. Es ist eine folgerichtige Entwicklung, aber eine, die Adán das Leben schwermacht - statt sich mit wenigen großen Partnern ins Benehmen zu setzen, muss er sich nun mit unabsehbar vielen kleinen Lieferanten herumärgern, manchmal sogar mit den Produzenten selbst. Und nach dem Verschwinden der großen Kartelle kann er sich nicht mehr auf die reibungslose, pünktliche Lieferung von Qualitätsware verlassen. Man kann sagen, was man will, denkt Adán, aber so ein Monopol ist wenigstens effizient und verlässlich, während eine prompte und qualitätsgerechte Lieferung durch die Baby Beils eher die Ausnahme als die Regel ist.
Adáns Geschäftsmodell beginnt zu wackeln, erst an der Beschaffungsfront, aber die Probleme setzen sich fort über die Großdealer, die für Transport und Bewachung sorgen, bis hin zu den neuen Vertriebsmärkten in Los Angeles, Chicago und New York, die Adán nach der Festnahme der Orejuela-Brüder übernommen hat. Immer öfter stehen seine teuren und wartungsintensiven Boeings auf den Landepisten in Kolumbien und warten auf die Fracht, die oft zu spät oder gar nicht kommt, und wenn doch, dann nicht in der versprochenen Menge und Qualität. Bald beschweren sich die Straßenkunden bei den Dealern, die Dealer bei den Großdealern, die sich (sehr höflich) bei den Barreras beschweren.
Bis die Lieferungen gänzlich ausbleiben.
Aus dem Strom wird ein Bach, aus dem Bach ein Rinnsal.
Den Grund findet Adán schnell heraus.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Besser bekannt unter dem Kürzel FARC.
Die älteste und langlebigste marxistische Rebellenbewegung Lateinamerikas.
Die FARC kontrolliert die südwestlichen Regionen an den Grenzen zu Peru und Ecuador, wo ebenfalls Kokain produziert wird. Von ihren Stellungen in den nordwestlichen Ausläufern des Amazonas-Regenwalds führt die FARC seit dreißig Jahren Krieg gegen die kolumbianische Regierung, die reichen Landbesitzer und die Ölfirmen, die sich in den erdölreichen Küstenregionen etabliert haben.
Und die Macht der FARC ist im Wachsen'begriffen. Erst vor einem Monat haben die Guerillas einen waghalsigen Angriff auf einen Armeestützpunkt in Las Delicias unternommen. Haben ihn mit Mörsergranaten und Sprengsätzen gestürmt, sechzig Soldaten getötet, die restlichen gefangen genommen. Und die lebenswichtige Verbindungsstraße zwischen dem Südwesten und dem Kernland blockiert.
Seither kontrolliert die FARC nicht nur die Schmuggelrouten aus Peru und Ecuador, sondern auch den Putumajo-Distrikt selbst - dichter Amazonas-Urwald und ein bedeutendes Anbaugebiet für die Coca-Pflanze. Die großen Kartelle hatten lange von solchen Anbaugebieten geträumt und Millionen in die Infrastruktur investiert. Aber just als ihre Anstrengungen Früchte zu tragen begannen, wurden sie vertrieben. Was geblieben ist, sind die chaotischen Baby Beils und über dreihunderttausend Hektar Anbaufläche, die täglich wächst.
Was der Mohn für Sinaloa war, ist das Coca-Blatt für Putumayo - die Quelle allen Reichtums, auf der die Drogenindustrie aufbaut.
Die FARC hat diese Quelle verstopft - und nun bietet sie Adán Verhandlungen an.
Genau die sind auch nötig, denkt Adán und betrachtet die neben ihm schlafende Nora.
Sie spürt Adáns Blick und wacht auf.
»Ich möchte ein bisschen rausgehen«, sagt sie nach einem zärtlichen Morgenkuss.
»Ich komme mit.«
Sie ziehen ihre Morgenmäntel über und treten in den Garten hinaus.
Draußen sitzt Manuel. Wie immer, denkt sie.
Adán hat ihm ein Haus auf dem Anwesen bauen lassen, ein kleines, schlichtes Bauernhaus, das mit Rücksicht auf sein steifes Bein ein wenig verändert und mit Möbeln ausgestattet wurde, die ihm das Aufstehen erleichtern. Dazu ein Jacuzzi - gegen die Schmerzen, die mit dem Alter schlimmer werden. Manuel mag ihn nicht benutzen, wegen der Stromkosten, daher schickt Adán jeden Abend einen Mann hinüber, der ihn einschalten muss.
Manuel erhebt sich von seiner Bank und folgt ihnen in diskretem Abstand, mit seinem typischen Hinken. Für Nora ist er fast eine Karikatur: die Kalaschnikow über der Schulter, mit zwei gekreuzten Bandeliers wie ein altmodischer Bandido, an jeder Hüfte ein Pistolenhalfter und ein riesiges Messer im Gürtel.
Es fehlt nur der große Sombrero und der hängende Schnauzbart, denkt sie.
Schon kommt das Dienstmädchen mit dem Tablett.
Zwei Tassen Kaffee: weiß und süß für ihn, schwarz und ohne Zucker für sie.
Adán bedankt sich, und sie eilt zurück in die Küche, den Blick von Nora abgewandt, weil sie Angst hat, dass die gringa sie mit ihren Augen genauso behext wie den patrón. Denn die Frauen in der Küche behaupten, dass man ihr nur in die Augen sehen muss, und schon verfällt man ihrer Macht.
Anfangs war es schwierig, mit der stummen Ablehnung des Personals und mit Rauls offener Kritik umzugehen. Den stört nicht, dass sich Adán eine Geliebte hält, wohl aber, dass er offen mit ihr zusammenlebt. Nora hat gehört, wie sich die Brüder stritten, und bot ihre Abreise an, doch Adán wollte nichts davon hören. Inzwischen haben sie ihre Beziehung in ruhigere Bahnen gelenkt, und dazu gehört auch der Morgenspaziergang.
Das Anwesen ist wunderschön, findet Nora. Besonders in den Morgenstunden, bevor die Sonne alle Schatten zu Silhouetten reduziert und die Farben überblendet. Zuerst gehen sie in den Obstgarten, weil Adán weiß, wie sehr sie den Zitrusgeruch liebt, der sich mit dem zarten Duft der Mimosen und Jacaranden mischt. Unter lavendelfarbenen Blütendolden gehen sie zum Blumengarten mit seinen Taglilien, Calla, Mohnblüten und dann weiter zum Rosengarten.
Sie liebt den Anblick der feucht glänzenden Blumen, das sanfte Fft-fft-fft des Sprenklers, der alles gut bewässert, bevor die große Hitze einsetzt.
Adán verscheucht einen Pfau aus dem Garten.
Pfauen, Fasane, Perlhühner gibt es hier in Mengen. An einem Morgen ging sie allein in den Garten - Adán war verreist - und sah einen Pfau auf dem Rand des Springbrunnens. Als er sie kommen sah, breitete er seinen Fächer aus - ein herrlicher Anblick.
Und noch mehr Vögel tummeln sich in den Bäumen. Eine erstaunliche Vielfalt an Finken - Adán versucht vergeblich, ihr die Namen beizubringen, aber sie erkennt sie nur an den Gold-, Gelb-, Purpur- und Rottönungen. Neben den verschiedenen Finkenarten gibt es auch den unglaublich hübschen Kieferntangar, der ihr vorkommt wie ein flatternder Sonnenuntergang. Und Kolibris. Um sie anzulocken, wurden bestimmte Blumen gepflanzt und Behälter mit Zuckerwasser aufgehängt. Adán kann die verschiedenen Sorten unterscheiden, doch sie erkennt die Kolibris nur an ihrem Schwirren, ihren schillernden Farben und ihrem überraschenden Auftauchen - ein Schauspiel, das sie nicht missen mag.
»Wollen wir in den Zoo?«, fragt er.
»Unbedingt!«
Adán ist praktisch und handwerklich veranlagt, daher kann er nicht so recht verstehen, warum Raúl so viel Zeit und Geld in seine Menagerie steckt. Für Raúl ist es eine von vielen Spielereien, dass er sich einen Ozelot leistet, zwei Sorten Kamele, einen Gepard, ein Löwenpärchen, einen Leoparden, zwei Giraffen, ein Rudel seltener Hirsche.
Aber keinen weißen Tiger. Den hat er an einen Sammler in Los Angeles verkauft, doch der wurde beim Versuch erwischt, ihn über die Grenze zu schmuggeln. Musste eine Riesenstrafe zahlen, und der Tiger lebt jetzt im Zoo von San Diego.
Während sie also die Menagerie besichtigen, steht schon ein Pfleger mit Früchten bereit, die Nora an die Giraffen verfüttert. Sie liebt die Grazie dieser Tiere, ihre langen Hälse und ihr bedachtsames Schreiten.
Danach geht es weiter zum Hirschgehege. Nora nimmt ihre Kaffeetasse wieder an sich und geht vor Adán her. Ein anderer Tierpfleger öffnet ihr das Gatter und reicht ihr einen Becher mit Leckerbissen zum Verfüttern.
»Guten Morgen, Tomas.«
»Señora.«
Die Hirsche scharen sich um sie, beschnuppern ihren Morgenmantel und drängen sich nach dem Becher.
Als alles verfüttert ist, setzen sich Adán und Nora auf die Ostterrasse, um die Sonne zu genießen. Sie isst eine Grapefruit zu ihrem Kaffee, weiter nichts. Grapefruit frisch aus dem Obstgarten, buchstäblich Minuten vorm Verzehr gepflückt. Er dagegen futtert drauflos wie einer von Rauls Löwen. Einen Riesenteller huevos con machaca, dazu große Stücke Kingfisch und scharfe Chorizo, einen Stapel warme Maistortillas und, auf Noras Drängen, eine Schale Obst. Die frische Salsa, die neben seinem Teller steht, macht ihr den Mund wässrig, aber sie bleibt bei ihrer Grapefruit-Diät.
Er bemerkt es.
»Völlig fettfrei?«, fragt er.
»Die Tortilla, die ich dazu esse, enthält genug Fett.«
»Ein paar Pfunde mehr könntest du vertragen.«
»Du bist aber charmant.«
Er lächelt und widmet sich wieder seiner Zeitung, überzeugen wird er sie ohnehin nicht, denn sie achtet fast so sehr auf ihre Figur wie er. Während er duscht und sich fürs Büro fertig macht, geht sie in den Fitnessraum. Er hat ihr eine Stereoanlage und einen Fernseher eingebaut, weil sie beim Workout gern Unterhaltung hat. Und die Gerätschaften gibt es gleich in doppelter Ausführung, obwohl sie ihn selten dazu überreden kann, mit ihr gemeinsam zu trainieren.
Jeden zweiten Tag joggt sie auf dem langen Fahrweg, der zum Anwesen führt. Nach Protesten des Wachpersonals hat Adán zwei Sicarios gefunden, die mit ihr liefen. Dann protestierte aber sie und meinte, sie fühle sich beobachtet, wenn zwei Männer hinter ihr herliefen, doch in diesem Punkt ließ er nicht mit sich reden.
Wenn sie also joggt, laufen zwei Leibwächter hinter ihr her. Auf seine speziellen Anweisungen hin müssen sie im Wechsel laufen und gehen. Er will nicht, dass sie gleichzeitig außer Atem geraten. Wenn es zum Schusswechsel kommt, soll wenigstens einer von beiden eine ruhige Hand haben. Außerdem wissen sie: »Wenn ihr etwas passiert, seid ihr beide tot.«
Ihre Nachmittage sind lang und ereignisarm. Weil er tagsüber durcharbeitet, muss sie allein zu Mittag essen. Dann macht sie vielleicht eine kurze Siesta, streckt sich auf dem Liegestuhl aus, unter dem Schirm, um der Sonne zu entgehen, und aus demselben Grund verbringt sie die Nachmittage im Haus, liest Zeitschriften und Bücher, lässt aus lauter Langeweile das mexikanische Fernsehen laufen und wartet eigentlich nur darauf, dass Adán zum Abendessen kommt.
Heute sagt er: »Ich muss auf eine Geschäftsreise. Sie könnte etwas länger werden.«
»Und wohin?«
Er schüttelt den Kopf. »Nach Kolumbien. Die FARC will mit mir verhandeln.«
»Ich möchte mitkommen.«
»Zu gefährlich.«
Das sieht sie ein. Sie wird dann so lange nach San Diego fahren. Shoppen, die neuesten Filme sehen, sich mit Haley treffen. »Aber du wirst mir fehlen«, sagt sie. »Du mir auch.«
»Gehen wir noch mal ins Bett.«
Sie fickt mit dämonischer Energie. Hält ihn gefangen in ihrem Schoß, umklammert ihn mit den Schenkeln, spürt seine Stöße tief im Bauch. Sie streicht ihm übers Haar, als er das Gesicht zwischen ihre Brüste schmiegt, und sagt: »Ich liebe dich. Tienes mi alma en tus manos.«
Du hältst meine Seele in den Händen.
Putumayo, Kolumbien
1997
Adán sitzt auf der Rückbank eines Jeeps, der sich auf einem schlammigen, zerwühlten Pfad durch den Amazonas-Dschungel von Südwestkolumbien arbeitet. Er versucht, die Moskitos und die kleinen schwarzen Fliegen aus seinem Gesicht zu verjagen, es ist unerträglich heiß und schwül.
Die ganze Reise ist eine einzige Strapaze.
Den Gedanken, mit einer seiner Boeings zu fliegen, hat er schnell verworfen. Keiner darf wissen, dass er sich mit Tirofio trifft, dem Kommandeur der FARC. Kriegt die CIA oder die DEA Wind von seiner Reise, hat das katastrophale Folgen. Außerdem möchte Tirofio, dass er sich unterwegs ein Bild von der Lage macht.
Also hat er den Seeweg gewählt, hat bei Cabo ein Sportfischerboot bestiegen, dann auf einem alten Fischkutter die lange Reise nach Süden angetreten - bis zur Mündung des Río Coqueta an der südkolumbianischen Küste. Das war der gefährlichste Teil, denn die ganze Küste wird von der Regierung und den Privatmilizen der Ölfirmen bewacht, die um ihre Förderanlagen fürchten.
Vom Fischkutter ist er auf ein kleines Motorboot umgestiegen, bei Nacht fahren sie in die Flussmündung ein, die Fackeln der Raffinerietürme lodern wie Höllenfeuer und weisen ihnen den Weg durch schlammige und verschmutzte Mündungsarme, die Luft ist stickig und verpestet. Vorsichtig bewegen sie sich flussaufwärts, vorbei an den Stacheldrahtzäunen und Wachtürmen der Raffinerien, immer auf der Hut vor den Patrouillen der Armee und der privaten Wachdienste. Als irgendwann der Regenwald beginnt, setzt er die Reise im Jeep fort, und zum ersten Mal sieht er die Felder mit den Pflanzen, die ihn reich gemacht haben.
Aber er sieht sie manchmal.
Meistens sieht er tote Flächen. Chemikalien sind nicht wählerisch, sie vergiften Coca-Pflanzen genauso wie Bohnen und Tomaten, wie Wasser und Luft. Adán läuft durch Geisterdörfer, die aussehen wie bewohnt, nur dass kein Mensch zu sehen ist. Die Bewohner sind vor den Entlaubungsmitteln geflohen, geflohen vor der Armee, vor der FARC, vor dem Krieg.
Andere Dörfer sind einfach abgebrannt. Verkohlte Flächen zeigen an, wo einmal Hütten standen. »Die Armee«, erklärt ihm sein Begleiter. »Sie brennen die Dörfer ab, die angeblich mit der FARC sympathisieren.«
Und die FARC brennt Dörfer ab, die angeblich mit der Armee sympathisieren, denkt Adán.
Irgendwann erreichen sie Tirofios Dschungelcamp.
Die Guerilleros tragen Tarnkleidung und Kalaschnikows, und es sind überraschend viele Frauen unter ihnen. Adán sieht eine besonders aufreizende Amazone mit langem schwarzem Haar, das unter ihrem Barett hervorweht. Seinem Staunen begegnet sie mit einem so abschätzigen Was-guckst-du-Blick, dass er wegschauen muss.
Überall herrscht Betriebsamkeit - ein Guerillatrupp trainiert, andere reinigen Waffen, waschen Wäsche, kochen Essen, sorgen für Ordnung - ein großes, übersichtlich angelegtes Camp, lange Reihen olivgrüner Zelte unter Tarnnetzen. Gekocht wird unter Palmdächern. Adán sieht ein Lazarettzelt und ein Sanitätszelt, ein anderes beherbergt eine ansehnliche Bibliothek. Das hier sind keine hergelaufenen Banditen, denkt er, das ist eine bestens organisierte Truppe, die ihr Territorium beherrscht. Die Tarnnetze sind das einzige Eingeständnis ihrer Angst vor Angriffen.
Adán folgt seinem Begleiter zum Hauptquartier - die Zelte sind größer, unter aufgespannten Vordächern stehen Waschtröge, Tische und Stühle aus roh behauenem Holz. Ein älterer Mann tritt aus dem Zelteingang, klein, stämmig, mit olivgrüner Tarnkleidung und schwarzem Barett - Tirofio.
Er sieht aus wie ein Frosch, denkt Adán. Dicker, als bei einem Dschungelkämpfer zu erwarten, mit schweren Tränensäcken, Hängebacken und einem breiten, mürrisch nach unten gezogenen Mund. Seine hohen Wangenknochen sind spitz, seine Augen unter den silbrigen Brauen schmale Schlitze. Trotzdem wirkt er jünger, als er ist. Er geht mit festen und kräftigen Schritten auf Adán zu, mustert ihn prüfend und zeigt auf ein Palmdach, unter dem Tisch und Stühle stehen. Mit einer Geste lädt er Adán zum Sitzen ein und kommt ohne Umschweife zur Sache: »Ich weiß, dass Sie Operation Red Cloud unterstützt haben.«
»Das war nicht politisch«, sagt Adán. »Nur geschäftlich.«
»Sie wissen, dass ich Sie als Geisel festhalten könnte«, sagt Tirofio. »Oder auf der Stelle erschießen lassen.«
»Und Sie wissen«, erwidert Adán, »dass Sie mich vielleicht eine Woche überleben würden.« Tirofio nickt.
»Also, was haben wir zu bereden?«, fragt Adán.
Tirofio zieht eine Zigarette aus der Hemdtasche, bietet sie Adán an, schüttelt den Kopf, als Adán ablehnt, und zündet sie an. Nachdem er einen tiefen Zug genommen hat, fragt er: »Wann sind Sie geboren?«
»1953.«
»1948 habe ich angefangen zu kämpfen«, sagt Tirofio. »In einer Zeit, die man heute >la Violenca< nennt. Haben Sie davon gehört?«
»Nein.«
Tirofio nickt. »Ich war Holzfäller und wohnte in einem kleinen Dorf. Damals war ich unpolitisch. Rechts oder links - den Bäumen, die ich fällen musste, war das egal. Eines Morgens, ich war in den Bergen bei der Arbeit, kamen die Soldaten ins Dorf, trieben alle Männer zusammen, fesselten ihnen die Hände auf den Rücken und schnitten ihnen die Kehle durch. Ließen sie wie Schweine auf dem Dorfplatz verbluten, während sie die Frauen und Töchter vergewaltigten. Wissen Sie, warum sie das gemacht haben?«
Adán schüttelt den Kopf.
»Weil die Bewohner einer linken Gruppe erlaubt hatten, einen Brunnen zu graben. Als ich zurückkam, fand ich die Leichen, die da im Dreck lagen. Meine Nachbarn, meine Freunde, meine Verwandten. Ich ging zurück in die Berge, diesmal, um mich den Guerillas anzuschließen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil Sie sagen können, Sie sind unpolitisch. Aber wenn Sie eines Tages Ihre Freunde und Verwandten im Dreck liegen sehen, werden Sie politisch.«
Adán erwidert: »Es gibt Arm und Reich, es gibt Macht und Ohnmacht. Das ist schon alles.«
»Sehen Sie?« Jetzt lächelt Tirofio. »Sie sind schon ein halber Marxist.«
»Was kann ich Ihnen bieten?«
Waffen.
Tirofio befehligt zwölftausend Kämpfer und möchte dreißigtausend mehr haben. Aber er hat nur achttausend Gewehre. Adán verfügt über Geld und Flugzeuge. Wenn seine Flugzeuge Kokain ausfliegen, können sie auch Waffen einfliegen.
Ich muss dem Mann geben, was er will, wenn ich meinen Nachschub sichern will, weiß Adán. Ich muss ihm Waffen liefern, damit er sein Territorium gegen die rechten Milizen, gegen die Armee und, ja, gegen die Amerikaner verteidigen kann. Das ist eine praktische Notwendigkeit, aber auch ein Stück Vergeltung. Also fragt er: »Hätten Sie einen Vorschlag?«
Tirofio hat einen.
»Ganz einfach«, sagt er.
Ein Kilo gegen ein Gewehr.
Für jedes Gewehr, das Adán einfliegt, gibt die FARC ein Kilo Kokain frei, zu einem Preis, der den Gegenwert der Waffen berücksichtigt. Das Maß bildet die Standardwaffe, die Kalaschnikow, aber auch amerikanische M16 und M2 sind willkommen, da die FARC die passende Munition bei ihren Gegnern erbeuten kann. Für andere Waffen - Tirofio benötigt dringend Bazookas - bietet er anderthalb oder gar zwei Kilo.
Adán akzeptiert, ohne zu feilschen.
Irgendwie käme ihm das jetzt schäbig vor, fast unpatriotisch. Außerdem, dieser Deal ist tragfähig. Falls - und da liegt das Problem -, falls er genügend Waffen auftreiben kann.
»Dann wären wir uns einig?«, fragt Adán.
Tirofio schüttelt ihm die Hand. »Eines Tages werden Sie begreifen, dass alles politisch ist, und Sie werden sich von Ihrem Herzen statt von Ihrer Brieftasche leiten lassen.«
»Und an diesem Tag«, verspricht ihm Tirofio, »entdecken Sie Ihre Seele.«
Nora breitet die Sachen auf dem Bett aus - Hemden und Anzüge für Adán, die sie in La Jolla gekauft hat. In dem kleinen Hotel in Puerto Vallaría hat sie auf seine Rückkehr gewartet »Gefallen sie dir?«
»Klar.«
»Du hast kaum einen Blick drauf geworfen«, beschwert sie sich.
»Tut mir leid.«
»Schon gut.« Sie umarmt ihn. »Sag mir einfach, was dich beschäftigt.«
Adán erklärt ihr, vor welchen logistischen Herausforderungen er steht, und sie hört ihm aufmerksam zu. Er weiß nicht, wo er die Menge an Waffen hernehmen soll, die er braucht, um mit Tirofio ins Geschäft zu kommen. Es ist kein Problem, hier und da Gewehre zu bekommen - die USA sind ein einziger Waffenmarkt, wenn man so will -, aber die Stückzahlen, die er im Lauf der nächsten Monate braucht, gibt selbst der amerikanische Schwarzmarkt nicht her.
Und sie müssen über die USA geschmuggelt werden. Die Yankees sind zwar wie wild hinter Drogen her, aber die Mexikaner sind noch wilder, wenn es um Waffen geht. Beklagt sich Washington über den Zustrom von Drogen aus Mexiko, reagiert Mexiko mit Beschwerden über die Waffen, die aus den USA ins Land geschmuggelt werden. Dass die Mexikaner Feuerwaffen gefährlicher zu finden scheinen als Drogen, sorgt immer wieder für Zündstoff in den Beziehungen beider Länder. Die Mexikaner verstehen einfach nicht, warum in den USA die Kleindealer längere Haftstrafen bekommen als die großen Waffenschieber.
Nein, wenn es um Waffen geht, sind die Mexikaner empfindlich - ganz normal für ein Land, dessen Geschichte von Revolutionen geprägt ist. Erst recht, seit in Chiapas Unruhen herrschen. Adán erklärt Nora, dass es unmöglich ist, diese Mengen von Waffen auf direktem Wege nach Mexiko zu bringen, selbst wenn es ihm gelingt, einen Lieferanten zu finden. Sie müssen in die USA gebracht, dann auf den bewährten Schmuggelpfaden, nur in umgekehrter Richtung, durch die Baja-Provinz geschmuggelt, in die Boeings verladen und nach Kolumbien'geflogen werden.
»Kannst du überhaupt so viele Gewehre auftreiben?«, fragt Nora.
»Ich muss«, sagt Adán. »Und wo?«
Hongkong
1997
Der Landeanflug auf Hongkong ist immer faszinierend.
Nach endlosen Stunden über der Wasserwüste des Pazifik taucht es plötzlich aus dem Nichts auf, ein smaragdgrünes Eiland mit Hochhäusern, die in der Sonne glitzern, vor einer dramatischen Bergkulisse.
Er ist nie dort gewesen, sie schon mehrere Male. Das dort unten ist Hongkong, erklärt sie ihm, mit dem Victoria Peak, da drüben liegt Kowloon und der Hafen.
Sie mieten sich im Peninsula Hotel ein.
Es war ihre Idee, auf dem Festland zu bleiben, statt eins der modernen Hotels auf der Insel zu buchen. Sie liebt den kolonialen Charme von Kowloon, auch ihm wird es hier gefallen, denkt sie, außerdem ist das Viertel lebendiger, besonders bei Nacht.
Sie hat richtig vermutet - die altmodische Eleganz des Hotels findet er sehr ansprechend. Sie sitzen auf der Veranda und schauen auf den Hafen, die Landungsbrücke der Fähre, lassen sich ein komplettes englisches Teegedeck bringen und warten, dass die Suite bezugsfertig wird.
»Hier haben sich früher die Opiumbarone amüsiert«, erzählt sie ihm.
»Ist das wahr?«, fragt er. Von Geschichte hat er wenig Ahnung, nicht mal die Geschichte des Drogenhandels kennt er.
»Aber ja. Wegen des Opiums haben sich die Engländer überhaupt nur in Hongkong festgesetzt. Und zwar im Opiumkrieg.«
»Opiumkrieg?«
»Der war 1840«, erklärt sie ihm. »Da haben die Engländer Krieg gegen China geführt, um den freien Handel mit Opium zu erzwingen.«
»Das ist nicht dein Ernst!«
»Doch«, sagt Nora. »Teil des Friedensvertrags war die Öffnung des chinesischen Marktes für die englischen Drogenhändler, und die britische Krone verleibte sich Hongkong als Kolonie ein. Um das Opium sicher zu lagern. Die britische Armee und Navy haben praktisch das Rauschgift bewacht.«
»Genau wie heute«, stellt Adán fest. »Und woher weißt du diese Sachen?«
»Ich lese eben«, sagt Nora. »Jedenfalls dachte ich mir, dass dich das hier interessiert.«
Da hat sie recht. Er schlürft Darjeeling, bestreicht sein Biskuit mit Schlagsahne und Konfitüre und fühlt sich als Wahrer einer großen Tradition.
Als sie ihre Suite betreten, sinkt er sofort aufs Bett.
»Du darfst jetzt nicht schlafen«, ermahnt sie ihn. »So kriegst du den Jetlag nie in den Griff.«
»Ich bin aber todmüde.«
»Ich könnte dich wach halten.«
»Oh, ja?«
Oh, ja!
Danach, beim Duschen, erzählt sie ihm, dass sie den restlichen Tag für ihn verplant hat, wenn er sich in ihre Hände begeben will.
»Hab ich das nicht eben schon getan?«, fragt er.
»Und hat es dir gefallen?«
»Das war ich, der da geschrien hat.«
»Jetzt kommt's aufs Timing an«, sagt sie, während er sich rasiert. »Also beeil dich.« Er beeilt sich.
»Das gehört für mich zum Schönsten, was es gibt«, verheißt sie geheimnisvoll. Sie besorgt Fährtickets, nach ein paar Minuten Wartzeit gehen sie an Bord und suchen sich Plätze an der Backbordseite des feuerwehrroten Schiffs, um während der Überfahrt den Blick auf Hongkong zu genießen. Rings um sie herum ein Gewimmel von Fischerbooten, Sportbooten, Dschunken und Hausbooten.
Bei der Landung schiebt sie ihn zum Ausgang.
»Warum die Eile?« fragt er.
»Du wirst schon sehen. Komm, schnell.«'Sie laufen los, die Garden Road entlang bis zum Fuß des Victoria Peak, wo sie in die Seilbahn einsteigen und den steilen Hang hinauffahren.
»Das ist ja wie im Vergnügungspark«, sagt Adán.
Kurz vor Sonnenuntergang erreichen sie die Aussichtsplattform. Genau das wollte sie ihm zeigen. Während sie auf der Terrasse stehen, wird die Sonne erst rosa, dann rot, dann versinkt sie im Dunkel. Und im selben Moment erstrahlen die Lichter der Stadt wie Diamanten auf einem schwarzen Seidenkissen.
»Das hab ich noch nie erlebt«, sagt Adán.
»Ich hab mir gedacht, dass es dir gefällt.«
Er dreht sich zu ihr um und gibt ihr einen Kuss.
»Ich liebe dich«, sagt er.
»Ich liebe dich auch.«
Am nächsten Nachmittag treffen sie die Chinesen.
Wie geplant, werden Nora und Adán von einem Patrouillenboot im Hafen abgeholt, das in die Bucht hinausfährt, wo sie in eine wartende Dschunke umsteigen und die lange Überfahrt nach Silver Mine Bay antreten, das auf der Ostseite von Lantau Island liegt. Hier taucht ihre Dschunke in das Gewirr aus Tausenden anderen Dschunken und Hausbooten ein, windet sich durch ein Labyrinth aus Stegen und Booten, bis sie endlich an einem großen Hausboot festmacht. Der Bootsführer legt die Planke aus, Adán und Nora balancieren hinüber.
Drei Männer sitzen an einem Tischchen unter dem gewölbten Sonnendach in der Bootsmitte. Zwei ältere, ein jüngerer. Sie stehen auf, um Adán und Nora zu begrüßen. Der eine hat die kantigen Schultern und starre Haltung eines Offiziers, der andere wirkt entspannter und ein wenig gebeugt - er ist der Geschäftsmann. Der dritte ist sichtlich nervös in der Gesellschaft so bedeutender Männer. Das, denkt Nora, muss der Dolmetscher sein.
Er stellt sich auf Englisch als Mr. Yu vor, und Nora übersetzt alles ins Spanische, obwohl Adán recht gut Englisch kann. Aber das liefert ihr den Vorwand für ihre Anwesenheit, und sie hat sich eigens für diesen Auftritt ein schlichtes graues Kostüm mit hochgeschlossener Bluse ausgesucht und sparsam Schmuck angelegt.
Die Männer sind nicht blind für ihre Schönheit. Mr. Li, der Offizier, verbeugt sich galant, als er ihr vorgestellt wird, und Mr.
Chen, der Geschäftsmann, küsst ihr lächelnd die Hand. Nachdem das Begrüßungszeremonial absolviert ist, nehmen alle am Teetisch Platz und kommen zum Geschäftlichen.
Der erste Teil des Geschäftlichen, der scheinbar endlose Austausch von Freundlichkeiten und Komplimenten, geht Adán gewaltig auf die Nerven, zumal alles aus dem Mandarin ins Englische und vom Englischen ins Spanische und dann wieder zurück übersetzt werden muss. Am liebsten würde er sofort zur Sache kommen, aber Nora hat ihm erklärt, dass Geschäfte in China nun einmal so ablaufen. Man würde ihn als unhöflichen und folglich unfähigen Geschäftsmann betrachten, wollte er diesen Prozess abkürzen. Also sitzt er da und lächelt freundlich, während darüber gesprochen wird, wie schön Hongkong ist. Dann wird die Schönheit Mexikos gewürdigt, die wunderbare mexikanische Küche, die Liebenswürdigkeit und Intelligenz der Mexikaner im Allgemeinen. Nora lobt die Qualität des Tees, worauf Mr. Li erwidert, dieser Tee sei wertloses Zeug, und Nora die Bemerkung anschließt, sie wünschte, sie bekäme solches »Zeug« in Tijuana zu kaufen, was Mr. Li mit dem Angebot pariert, ihr diesen Tee zu schicken, obwohl er viel zu schlecht für sie sei und so weiter und so fort, bis Mr. Li, ein hochrangiger General der Volksbefreiungsarmee, dem Dolmetscher mit einem kaum merklichen Nicken zu verstehen gibt, dass er nun zum Thema kommen will.
Ein Waffengeschäft.
Ausgehandelt in allen drei Sprachen, obwohl Li sehr gut Englisch kann. Aber der Übersetzungsprozess gibt ihm Zeit zum Nachdenken und zu Absprachen mit Chen, dem Vertreter von GOSCO - der Guangdong Overseas Shipping Company -, außerdem wird so der Anschein gewahrt, dass diese schöne Frau nur Barreras Dolmetscherin ist und nicht seine Mätresse, wie aus diplomatischen Kreisen Mexikos verlautet. Es hat Zeit gekostet, dieses Treffen anzubahnen, viel Zeit und behutsames Taktieren, doch die Chinesen haben ihre Hausaufgaben gemacht. Sie wissen längst, dass der Drogenbaron mit einem bekannten Callgirl zusammenlebt, das geschäftlich mindestens genauso beschlagen ist wie ihr Liebhaber. Also hört Li geduldig zu, während Yu mit der Frau spricht und die Frau mit Barrera, obwohl längst klar ist, worum es geht, sonst säßen sie hier nicht zusammen.
- Welche Art von Waffen?
- Maschinenpistolen. Kalaschnikow.
- Bei Ihnen in Mexiko nennt man sie »Bockshorn« - das ist sehr originell. An wie viele dachten Sie?
- Für den Anfang eine kleine Menge. Vielleicht ein paar tausend.
Li ist verblüfft. Und beeindruckt, weil Barrera - oder war es die Frau? - eine solche Bestellung als »klein« bezeichnet hat, was ihnen als Handelspartnern sehr viel mehr Gewicht verleiht. Während ich an Gewicht verliere, wenn mir diese »kleine« Bestellung zu groß erscheint. Und dann dieser geschickte Köder, die Bemerkung, dass es nur ein Anfang ist. Damit ich weiß, dass es Nachfolgeaufträge gibt, wenn ich diese gigantische Zahl an Waffen liefern kann.
Li hat die Antwort schon parat.
- Gewöhnlich liefern wir nicht in so kleinen Stückzahlen.
- Wir wissen Ihr Entgegenkommen zu schätzen. Vielleicht machen wir es Ihnen leichter, wenn wir auch ein paar schwerere Waffen bestellen? Sagen wir, ein paar Granatwerfer?
- Granatwerfer? Stehen Sie vor einem Krieg?
Nora antwortet. Das friedliebende chinesische Volk weiß genau, dass Waffen dazu da sind, Kriege zu vermeiden, statt sie zu führen. Wie der Philosoph Sun Tsu sagte: »Für meine Wehrhaftigkeit sorge ich, für seine Verletzlichkeit sorgt der Feind.«
Die langen Flugstunden hat sie gut genutzt, Li ist tief beeindruckt.
- Natürlich, sagt Li, können wir Ihnen bei dieser geringen Menge nicht den gleichen Preis bieten wie für größere Bestellungen.
- In Anbetracht dessen, antwortet Adán, dass diese Bestellung nur der Beginn einer hoffentlich langen Geschäftsbeziehung sein soll, gehen wir davon aus, dass Sie uns einen Preisnachlass gewähren, der uns erlaubt, auch in Zukunft bei Ihnen zu kaufen.
- Wollen Sie damit sagen, dass Sie nicht in der Lage sind, den vollen Preis zu zahlen?
- Keineswegs. Ich will damit sagen, dass ich nicht willens hin, den vollen Preis zu bezahlen.
Auch Adán hat seine Lektion gelernt. Er weiß, dass die chinesische Armee nicht nur Verteidigungsaufgaben erfüllen, sondern - auf Druck Pekings - auch Gewinne erwirtschaften soll. Sie sind auf den Deal genauso angewiesen wie ich, denkt er, vielleicht sogar noch stärker, und diese Bestellung ist kein Pappenstiel, ganz im Gegenteil. Sie werden mir also einen guten Preis nennen, Herr General, besonders wenn ich betone -
- Natürlich würden wir in amerikanischen Dollars zahlen. Cash.
Denn die Armee soll nicht einfach Gewinne erwirtschaften, sondern ausländische Devisen, und das schnell. Sie wollen keine weichen mexikanischen Pesos, sie wollen harte Yankee-Dollars. Adán gefällt dieses Ringgeschäft: Amerikanische Dollars für chinesische Waffen, um kolumbianisches Kokain in den USA zu amerikanischen Dollars zu machen ...
Ein gutes Geschäftsmodell.
Für die Chinesen auch. In den nachfolgenden drei Stunden handeln sie die Details aus - Preise, Liefertermine.
Der General will den Handel, der Geschäftsmann will ihn, Peking will ihn. Die GOSCO errichtet ihre Niederlassungen nicht nur in San Pedro und Long Beach, auch in Panama. Sie kauft riesige Gebiete entlang des Kanals auf, der nicht nur die amerikanische Seemacht halbiert, sondern auch zwischen zwei wachsenden Aufstandsbewegungen in Mittelamerika liegt - der FARC in Kolumbien und den Zapatistas in Südmexiko. Sollen doch die Amerikaner vor der eigenen Tür kehren. Sollen sie sich doch um den Panamakanal sorgen statt um das sogenannte Taiwan.
Nein, dieser Pakt mit dem Barrera-Kartell kommt wie gerufen, um den Einfluss Chinas im Hinterhof der Amerikaner zu stärken. Sollen die Amerikaner kommunistische Buschbrände löschen und ihre Ressourcen auf den Drogenkrieg verschwenden.
Eine Flasche Wein wird serviert und ein Toast ausgebracht - auf die Freundschaft.
»Wart swei«, sagt Nora. Zehntausend Jahre.
Und in sechs Wochen wird ein Frachter der GOSCO auslaufen, beladen mit zweitausend chinesischen Kalaschnikows, sechs Dutzend Granatwerfern und reichlich Munition.
San Diego
Eine Woche nach der Rückkehr aus Hongkong passiert Nora in Tecate die Grenze und fährt auf der einsamen Wüstenstrecke nach San Diego. Im Valencia Hotel nimmt sie eine Suite mit Blick auf La Jolla Cove und den Ozean. Haley holt sie ab zum Essen im Top of the Cove. Die Geschäfte laufen gut, versichert ihr Haley.
Nora geht früh ins Bett und steht früh auf. Sie zieht sich Trainingssachen an und macht einen langen Lauf auf dem Küstenpfad, der sich an den Felsen von La Jolla Cove entlangzieht. Schwitzend und erschöpft kommt sie zurück, bestellt beim Zimmerservice ihre Grapefruit und schwarzen Kaffee und geht unter die Dusche.
Nach dem Frühstück macht sie sich zurecht und geht in La Jolla shoppen. Alle trendigen Läden liegen in Laufnähe, und sie schleppt schon mehrere Tüten, als sie ihre Lieblingsboutique betritt, wo sie mit drei Kleidern in der Kabine verschwindet.
Ein paar Minuten später geht sie mit zwei Kleidern an die Kasse. »Die nehme ich. Das rote habe ich in der Kabine gelassen.«
»Ich hänge es weg«, sagt die Besitzerin.
Nora dankt ihr mit einem Lächeln und tritt hinaus in den sonnigen Nachmittag von La Jolla. Kurzerhand entscheidet sie sich für französische Küche und bekommt ohne weiteres einen Tisch in der Brasserie. Den restlichen Nachmittag verbringt sie im Kino und in ihrem Hotelzimmer, wo sie ein ausgedehntes Schläfchen macht. Zum Abendessen bestellt sie ein Consommé, dann zieht sie eins ihrer schwarzen Kleider an und macht sich für den Abend zurecht.
Keller parkt drei Straßen vom Weißen Haus entfernt und läuft den Rest zu Fuß.
Er ist einsam. Die Arbeit lässt ihm wenig freie Zeit.
Cassie ist jetzt achtzehn und macht bald ihren Abschluss an der Parkman School, Michael ist sechzehn und neu an der Bishop's School. Keller besucht Cassies Volleyball-Turniere und Michaels Schwimmwettkämpfe, danach geht er mit ihnen essen, wenn sie nicht schon etwas anderes vorhaben. Einmal monatlich kommen sie brav zu ihm in seine Stadtwohnung, er lässt sich alles mögliche einfallen, um sie zu beschäftigen, aber meistens hängen sie nur am Pool ab, zusammen mit den anderen »Wochenend-Daddys« und ihren Kindern. Und sie lassen ihn spüren, dass ihnen diese Pflichtbesuche, die ihre eigenen Pläne durchkreuzen, immer lästiger werden.
Keller kann daher verstehen, wenn sie ihm mit einem freundlich gemeinten »Nächstes Mal!« absagen.
Eine Freundin hat er nicht. Es gab da ein paar kurze Geschichten mit geschiedenen Frauen - wenn sich denn zwischen beruflichen Terminen und Erziehungspflichten auch einmal die Gelegenheit ergab, miteinander ins Bett zu gehen. Aber diese Art von Sex war eher traurig als befriedigend, und bald gab er es auf.
In den meisten Nächten also leisten ihm die Toten Gesellschaft.
Sie haben immer Zeit für ihn, und sie sind viele. Ernie Hidalgo, Pilar Talavera und ihre zwei Kinder. Juan Parada. Allesamt Opfer seines Privatkriegs gegen die Barreras. Sie besuchen ihn des Nachts, reden mit ihm, fragen ihn, ob es die Sache wert war.
Bis jetzt zumindest lautet seine Antwort nein.
Keller verliert seinen Krieg.
Das Barrera-Kartell macht mittlerweile einen Profit von acht Millionen Dollar pro Woche. Die Hälfte des Kokains und ein Drittel des Heroins, das in Amerika verkauft wird, wird von den Barreras geliefert. Praktisch auch das ganze Methamphetamin westlich des Mississippi.
In Mexiko ist Adáns Macht ungebrochen. Er hat die Federación seines Onkels wiederaufgebaut, er ist der allseits respektierte patrón. Kein anderes Kartell kann ihm das Wasser reichen. Zudem hat er seine eigene Logistik in Kolumbien errichtet, er ist unabhängig von Cali und Medellin. Das Drogenimperium der Barreras trägt sich selbst - von der Coca-Pflanze bis zum Kleindealer an der Straßenecke, von der Mohnblüte bis zum Spritzbesteck, vom Hanfsamen bis zum Haschisch-Ziegel, vom Norephedrin bis zum Crystal-Ecstasy.
Das Barrera-Kartell, resümiert Keller, ist ein vertikal integrierter, sehr vielseitiger Drogenkonzern, der zudem auch »legale« Geschäfte betreibt. Massiv investiert haben die Barreras in Niedriglohnfabriken entlang der Grenze, in Immobilien im Südwesten der USA, überall in Mexiko und besonders in den Badeorten Puerto Vallaría und Cabo San Lucas - auch in Banken und Sparkassen zu beiden Seilen der Grenze. Finanziell ist das Kartell aufs engste mit den reichsten und mächtigsten mexikanischen Konzernen verflochten.
Jetzt ist Keller am Weißen Haus angekommen.
Haley Saxon kommt ins Vestibül, um ihn zu begrüßen.
Lächel professionell und überreicht ihm den Zimmerschlüssel.
Nora sitzl auf dem Beíí.
Sie siehi umwerfend aus in ihrem schwarzen Kleid. »Wie gehr's dir?«, fragt er.
Das rote Kleid war das Signal, dass sie ihn treffen wollte. Seit mehr als zwei Jahren schon hinterlegt sie ihm Nachrichten in diversen toten Briefkästen.
Nora hat ihm vom Treffen der Orejuela-Brüder mit Adán berichtet, so dass die beiden vor dem Rückflug nach Kolumbien verhaftet werden konnten.
Nora hat ihm erklärt, wie die neue Federación aufgebaut ist. Und sie hat ihm hundert kleine Einblicke geliefert, aus denen er tausend neue Erkenntnisse gewinnen konnte. Vor allem ihr ist zu verdanken, dass er die Kommandostruktur des Kartells in der Baja-Provinz und in Kalifornien kennt, die Lieferwege, die Depots, die Kuriere. Wann die Ware kam, wann das Geld floss, wer wen warum ermordet hat.
Sie hat jedes Mal ihr Leben riskiert, wenn sie ihn bei ihren Shopping-Touren nach San Diego und Los Angeles traf, bei ihren Badeurlauben und anderen Reisen in die USA, die sie ohne Adán unternommen hat.
Die Tarnung, deren sie sich bedienen, ist verblüffend einfach. Da das Kartell sowieso über bessere Technik verfügt als Keller in seiner Behörde und außerdem keinerlei gesetzlichen Schranken unterworfen ist, können sie die Überwachungstechnik nur unterlaufen, indem sie ganz auf Technik verzichten: Nora setzt sich einfach in ihr Hotelzimmer, schreibt ihre Informationen auf, steckt sie in einen Umschlag und schickt sie an ein Postfach, das Keller eigens zu dem Zweck eingerichtet hat.
Kein Handy.
Kein Internet.
Die gute alte Schneckenpost.
Nur in Notfällen hinterlässt sie ein rotes Kleid in der Umkleidekabine ihrer Lieblingsboutique. Die Besitzerin hatte die Wahl, wegen Drogenbesitz fünf Jahre in den Bau zu gehen oder dem Herrn der Grenzen ab und zu einen Gefallen zu tun. Sie entschied sich für Letzteres.
»Mir geht's gut«, sagt sie.
Aber sie ist wütend.
Nein, wütend ist nicht das richtige Wort, denkt sie, während sie Art Keller ansieht. Du hast behauptet, mit meiner Hilfe könntest du Adán Barrera ganz schnell erledigen, aber das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Zweieinhalb Jahre schon muss ich Liebe heucheln, mit einem Mann schlafen, den ich verabscheue, ich spüre ihn in meinem Mund, in meinem Bauch, in meinem Arsch, und ich tue so, als würde ich ihn lieben - dieses Monster, das den einzigen Mann auf dem Gewissen hat, den ich wirklich geliebt habe -, um ihn zu manipulieren, ihm zu der Macht zu verhelfen, die ihm noch mehr Verbrechen ermöglicht. Du weißt nicht, wie das ist - woher auch? -, wenn ich morgens aufwache, und dieser Mensch liegt neben mir, ich krieche ihm zwischen die Beine, mache die Beine breit für ihn, schreie meinen geheuchelten Orgasmus heraus, dann lache ich und plaudere mit ihm, teile seine Mahlzeiten, lebe die ganze Zeit in einem Alptraum und warte darauf, dass du endlich etwas unternimmst.
Aber was hast du bis jetzt getan?
Die Orejuela-Brüder verhaftet, weiter nichts.
Seit zweieinhalb Jahren sitzt du auf deinen Informationen und wartest ab.
»Es ist zu riskant«, sagt Keller jetzt.
»Auf Haley kann ich mich verlassen«, erwidert sie. »Ich möchte, dass du handelst. Jetzt.«
»Adán sitzt zu fest im Sattel. Ich will -«
Als sie ihm vom Deal mit der FARC und den Chinesen erzählt, ist Keller fasziniert. Er weiß, dass sie clever ist - er hat sie beobachten lassen, als sie Adán aus der Klemme half -, aber dieser Durchblick! Sie weiß genau, worum es geht.
Klar weiß ich das, denkt Nora. Ihr Leben lang hat sie Männer studiert. Sie sieht, was sich auf Kellers Gesicht abspielt, wie seine Augen aufleuchten. Das klappt bei jedem Mann, wenn man die richtigen Dinge anspricht. Sie kennt sich aus, und jetzt sieht sie, wie Keller tickt.
Er will Vergeltung.
Genauso wie ich.
Denn Adán hat einen fatalen Fehler begangen, der ihm das Genick brechen kann. Und wir beide wissen es.
»Wer weiß von dem Waffengeschäft?«, fragt er.
»Adán, Raúl, Fabián Martinez«, sagt sie. »Und ich. Jetzt du.«
Keller schüttelt den Kopf. »Wenn ich jetzt handle, wissen sie, dass du's bist. Du darfst nicht zurück nach Mexiko.«
»Ich fahre aber zurück. Wir wissen, dass die Waffen nach San Pedro geliefert werden. Aber nicht, mit welchem Schiff, an welches Pier.«
Das wäre natürlich wichtig, denkt Keller. Aber wenn wir die Lieferung hochgehen lassen, bist du so gut wie tot.
Als er gehen will, fragt sie ihn: »Willst du mit mir schlafen, Keller? Im Dienst der Sache, natürlich.«
Seine Einsamkeit ist mit Händen zu greifen, denkt sie. Eine Geste genügt.
Sie öffnet ein klein wenig die Schenkel. In ihm arbeitet es.
Das ist ihre kleine Rache, weil er sie schon so lange als »Schläferin« einsetzt.
»War nur Spaß, Art«, sagt sie.
Er versteht.
Sie hat's ihm gezeigt.
Er weiß, dass es nicht zu vertreten ist, was er da macht. Sie so lange dieser Konspiration auszusetzen. Sechs Monate sind schon viel, ein Jahr das Maximum. Diese Belastung hält keiner lange aus. Die Agenten verlieren die Nerven, sie verraten sich, ihre Informationen führen auf ihre Spur, die Uhr läuft ab.
Und Nora Hayden ist kein Profi. Streng genommen ist sie nicht einmal eine Agentin, sondern nur eine Informantin. Aber egal. Sie steckt tief drin in der Konspiration, und das schon viel zu lange.
Aber ich kann ihre Informationen nicht nutzen, weil Barrera von Mexiko geschützt wird. Und hier in den USA darf ich ihre Informationen nicht nutzen, weil sie auffliegen kann, bevor wir Barrera ein für alle Mal das Handwerk gelegt haben.
Eine quälende Zwangslage. Noras Informationen würden ausreichen, das Barrera-Kartell mit einem einzigen Schlag zu vernichten, aber er kann diesen Schlag nicht führen. Er kann nur warten und hoffen, dass der Herr der Himmel der Sonne zu nahe kommt.
Und das hat er jetzt getan.
Es ist Zeit, zuzuschlagen. Und Zeit, Nora rauszuholen.
Ich könnte sie sofort verhaften, denkt er. Ein Vorwand findet sich immer. Festsetzen, kompromittieren, damit sie nicht zurückkann. Ihr eine neue Identität, eine neue Existenz verschaffen.
Aber er tut's nicht.
Weil er sie noch braucht. Sie muss noch ein Weilchen an Adán Barrera dranbleiben. Er weiß, dass er den Bogen überspannt. Aber er lässt sie gehen.
»Ich brauche Beweise«, sagt John Hobbs.
Harte, vernichtende Beweise, bevor ich auch nur daran denken kann, die mexikanische Regierung zu Taten zu drängen.
»Ich habe eine Quelle«, sagt Keller.
Hobbs nickt. »Ja, welche?«
»Die kann ich nicht preisgeben.«
Hobbs grinst. »Das hatten wir doch schon, dass Sie mit nichtexistenten Quellen arbeiten.«
Und jetzt kommt ihm Keller trotz seiner notorischen Barrera-Macke mit der Geschichte, dass Adán Barrera der FARC chinesische Waffen liefert, um Kokain dafür einzutauschen? Eine Geschichte, mit der er die CIA in seinen Krieg gegen die Barreras einspannen kann? Da macht er es sich ein bisschen zu einfach.
Keller spürt, was Hobbs denkt. Wer zu oft schreit, dem hilft, wenn es ernst wird, keiner.
»Welche Art von Beweis brauchen Sie?«, fragt er.
»Die Waffenlieferung wäre ganz brauchbar, zum Beispiel.«
Das ist ja mein Dilemma, denkt Keller. Wenn ich die Waffenlieferung auffliegen lasse, muss ich genau das preisgeben, was ich schützen will. Könnte ich Hobbs dazu bringen, die Mexikaner zu einem Präventivschlag gegen die Barreras zu veranlassen, müsste ich Nora nicht in Gefahr bringen. Aber um diesen Schlag auszulösen, muss ich die Waffenlieferung nachweisen, und die Einzige, die mir diesen Beweis liefern kann, ist Nora.
Und wenn sie das tut, ist sie so gut wie tot.
»Hören Sie«, sagt er. »Der Hinweis könnte doch von chinesischer Seite kommen. Abgefangene Funksprüche, Internetbotschaften, Satellitenaufklärung - sagen Sie doch einfach, Sie haben eine Quelle in Peking.«
»Sie wollen, dass ich wertvolle Quellen in Asien gefährde, um irgendeinen Drogendealer zu schützen, der für Sie arbeitet? Ich bitte Sie!«
Aber der Gedanke reizt ihn.
Die Zapatistas in Chiapas werden immer aktiver, ihre Reihen werden, wie es heißt, durch Flüchtlinge aus Guatemala verstärkt, daraus könnte ein kommunistischer Aufstand entstehen, der die ganze Region erfasst. Im Juni ist eine linke Gruppierung entstanden, die Revolutionäre Volksarmee - bei einer Trauerfeier in Guerrero, nachdem Bauern von rechten Milizen erschossen worden waren. Und vor zwei Wochen erst hat diese sogenannte Armee mehrere Polizeistationen gleichzeitig überfallen - in Guerrero, Tabasco, Puebla und sogar Mexico City, sechzehn Beamte getötet und dreiundzwanzig verletzt. Der Vietcong hat bescheidener angefangen, denkt er. Hobbs hat den mexikanischen Geheimdienstkollegen Unterstützung angeboten, aber die, voller Misstrauen gegen neoimperialistische Yankee-Einmischungsversuche, lehnten ab.
Was sehr dumm von ihnen ist, denkt Hobbs, denn schon ein flüchtiger Blick auf die Landkarte macht deutlich, dass die kommunistischen Unruhen von Chiapas, befeuert durch die NAFTA und die katastrophalen Folgen der Peso-Krise, nach Norden ausstrahlen.
Mexiko treibt gefährlich auf eine Revolution zu, und alle wissen es, nur das mexikanische Außenministerium stellt sich blind. Selbst das Pentagon rechnet mit einer solchen Möglichkeit - Hobbs hat gerade den streng geheimen Krisenplan gelesen, der eine US-Invasion vorsieht - für den Fall des totalen Zusammenbruchs in Mexiko. Ein Castro ist wahrlich genug. Und Comandante Zero als mexikanischer Präsident? Unvorstellbar! Eine marxistische Diktatur, die direkt an die USA angrenzt, auf zweitausend Meilen Länge? Und das bei einer zukünftigen hispanischen Mehrheit in den grenznahen US-Staaten? Aber die Mexikaner würden Pickel kriegen, wenn sie diesen Krisenplan zu sehen bekämen.
Nein, amerikanische Militärhilfe wird Mexiko nur dann zulassen, wenn sie sich als Krieg gegen die Drogen tarnt. So ähnlich wie der amerikanische Kongress, denkt Hobbs. Das Vietnam-Syndrom verhindert, dass auch nur ein Penny für verdeckte Kriege gegen die Kommunisten lockergemacht wird, aber wenn es sich um den Drogenhandel dreht, fließt das Geld in Strömen. Also geht man nicht zum Kongress und sagt, wir brauchen das Geld, um unsere Nachbarn und Verbündeten vor der marxistischen Bedrohung zu schützen. Nein, man schickt seine Gewährsleute zur DEA, mit der Begründung, dass sie das Geld brauchen, um die amerikanische Jugend von Drogen fernzuhalten.
Die fünfundsiebzig Huey-Hubschrauber und das Dutzend C26-Militärflugzeuge, die vonnöten wären, werden niemals vom Kongress bewilligt, geschweige denn von Mexiko geduldet, wenn es darum geht, die Zapatistas und die Revolutionsarmee zu besiegen, aber genau diese Ausrüstung hat der Kongress bewilligt, um den Mexikanern bei ihrem Kampf gegen den Drogenhandel zu helfen, und gegenwärtig wird sie diskret an die mexikanische Armee übergeben - zum Einsatz in Chiapas und Guerrero.
Und nun ertappen wir die mexikanischen Drogenbarone beim Waffenhandel mit den kommunistischen Guerillas in Kolumbien? Wenn das den Tatsachen entspricht, haben wir die Mexikaner fest auf unserer Seite.
Keller spielt seinen letzten Trumpf aus. »Sie wollen also tatenlos zusehen, wie sich die FARC mit Waffen eindeckt? Ganz zu schweigen vom wachsenden Einfluss der Chinesen in Panama?«
»Nein«, sagt Hobbs leise. »Sie tun das.«
»Verdammt noch mal, John«, sagt Keller. »Wenn das so läuft, wie Sie wollen, hat die CIA nichts davon. Dann gibt es keine Infos. Ohne Infos keine Zugriffe, ohne Zugriffe kein Erfolg.«
»Nennen Sie mir die Quelle, Arthur.«
Keller starrt ihn an und schweigt.
»Dann beschaffen Sie mir die Waffen«, sagt Hobbs.
Das kann ich nicht, denkt Keller. Erst muss mir Nora verraten, wo sie sind.
Mexiko
Auf Rancho las Bardas findet ebenfalls eine Besprechung statt. Zwischen Adán, Raúl, Fabián. Und Nora.
Adán hat auf ihrer Teilnahme bestanden. Denn ohne sie wäre dieser Deal nicht zustande gekommen. Raúl passt das gar nicht.
»Seit wann ziehen wir unsere Frauen ins Geschäft rein?«, fragt er Fabián. »Die sollen lieber im Schlafzimmer bleiben, wo sie hingehören. Die sollen die Beine breit machen und nicht das Maul aufreißen.«
Fabián lacht. Er würde la Güera nur zu gern vernaschen - die schärfste Blondine, die ihm je in die Quere kam. Was findest du an diesem Langweiler?, denkt er. Komm zu mir, ich mach dich platt, du geiles Teil.
Nora sieht ihm an, was er denkt. Versuch's nur, Arschloch. Adán grillt dich auf kleiner Flamme. Und ich bringe die Marshmallows.
Die Chinesen wollen Bargeld bei Lieferung und akzeptieren keine andere Zahlung, keine Überweisungen, keine Geldwäsche über Tarnfirmen. Der Transfer darf nicht die geringsten Spuren hinterlassen, und das geht nur bei persönlicher Übergabe.
Sie verlangen, dass Nora das Geld überbringt.
Wenn Adán Barrera seine hochgeschätzte Mätresse schickt, ist das eine gute Sicherheitsgarantie.
»Auf keinen Fall«, sagen Adán und Raúl einstimmig, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
»Sprich du zuerst«, sagt sie zu Raúl.
»Ihr habt euch nicht gerade versteckt«, sagt Raúl. »Die DEA hat mehr Fotos von dir als von mir. In deinem hübschen Köpfchen steckt zu viel Wissen - und ein Motiv, es rauszurücken, wenn sie dich verhaften.«
»Weshalb sollen sie mich verhaften?«, fragt Nora. »Weil ich mit deinem Bruder schlafe?« Sie wendet sich an Adán. »Jetzt deine Gründe.«
»Zu gefährlich«, sagt er. »Wenn es schiefgeht, landest du lebenslänglich hinter Gittern.«
»Dann sorgen wir dafür, dass nichts schiefgeht«, erwidert sie und stellt die Sache aus ihrer Sicht dar.
Ich fahre ständig über die Grenze, ich bin Amerikanerin, habe eine Adresse in San Diego. Ich bin blond und attraktiv, ich flirte mich durch jede Kontrolle. Und vor allem: Die Chinesen wollen mich.
»Warum?«, fragt Raúl plötzlich. »Warum willst du das Risiko eingehen?«
»Weil«, erwidert sie lächelnd, »ihr mich dafür reich machen werdet.«
Ihre Antwort bleibt unkommentiert im Raum stehen.
Bis Adán endlich sagt: »Ich brauche den besten Autozerleger. Ein Maximum an Sicherheit auf beiden Seiten der Grenze. Fabián, du suchst unsere besten Leute in Kalifornien für die Übergabe aus und wirst die Sache begleiten. Wenn ihr was passiert, mache ich euch beide verantwortlich.«
Er springt auf und geht hinaus.
Nora bleibt lächelnd sitzen.
Raúl folgt Adán hinaus in den Garten.
»Wie stellst du dir das vor?«, fragt er ihn. »Was hält sie davon ab, uns aufs Kreuz zu legen? Mit dem Geld zu verschwinden, und fertig? Sie ist eine Hure, verdammt noch mal!«
Adán dreht sich ruckartig um und packt ihn beim Hemd. »Du bist mein Bruder, und das bleibst du auch. Aber wenn du das noch einmal sagst, spalten wir das Geschäft auf und gehen getrennte Wege. Und jetzt mach deine Arbeit.«
Während Nora in der Warteschlange am Grenzübergang San Ysidro steht, sitzt der beste Autozerleger Mexikos im zehnten Stock eines Wohnhauses und schaut auf den Kontrollpunkt hinab. Er ist ein bisschen nervös, weil er für seine Arbeit garantieren muss - wenn der Transport beim Grenzübertritt hochgeht, schießt ihm Raúl Barrera eine Kugel in den Kopf.
»Nur damit du weißt, dass dein Leben dran hängt«, sagt Raúl.
Er weiß nicht, wohin das Auto fährt, er weiß nicht, wer drinsitzt, aber es ist schon sehr ungewöhnlich, dass Geld nach Norden statt nach Süden transportiert wird. Der unauffällige kleine Toyota Camry ist vollgestopft mit Millionen amerikanischen Dollars - gut versteckt in diversen Hohlräumen. Hoffentlich kommt keiner auf die Idee, das Ding auf die Waage zu stellen, denkt er.
Nora denkt dasselbe. Eine optische Überprüfung macht ihr keine Sorgen, auch nicht die Hunde, weil die auf das Aufspüren von Drogen abgerichtet sind, nicht auf das Aufspüren von Geld. Trotzdem wurden die Geldbündel in Zitronensaft getränkt, um den Geruch zu neutralisieren. Und das Auto selbst ist nie für Drogentransporte benutzt worden, es gibt also auch keine Restspuren.
Nur Reste von Sand, sorgsam verstreut auf Beifahrerseite und Rückbank, dazu nasse Handtücher, ein Kapuzenshirt und ein Paar alte Strandlatschen.
Das Warten an der Grenze dauert heute grausame anderthalb Stunden. Aber Adán hat auf dem späten Sonntagnachmittag bestanden, wenn der Übergang von Tausenden Amerikanern verstopft ist, die von einem billigen Wochenende in den mexikanischen Seebädern Ensenada und Rosarita zurückkommen. Sie hat also reichlich Zeit, auf die dritte Spur zu wechseln, wo gleich ein Kontrollposten seinen Dienst antritt, der auf der Gehaltsliste der Barreras steht.
Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Raúl steht am Fenster der Wohnung und beobachtet alles mit dem Feldstecher. Es gibt drei Wohntürme direkt hinter dem Grenzübergang, und alle drei gehören den Barreras. Jetzt verfolgt Raúl, wie der bestochene Grenzbeamte seinen Platz einnimmt und zum Wohnturm hinüberblickt.
Und tippt Zahlen in seinen Pager.
Schon piepst Noras Pager, sie blickt auf das Display und sieht die Zahl 666 - der Code für »alles in Ordnung«. Sie nickt dem Fahrer des Ford Explorer zu, der vor ihr steht und sie ihm Rückspiegel sieht. Der fährt darauf nach rechts hinüber, in die dritte Spur und blockiert sie, so dass Nora in den Zwischenraum hineinfahren kann. Der Jeep Cherokee hinter ihr macht dasselbe, ein Hupkonzert und gereckte Mittelfinger sind die Folge, aber Nora muss einfach auf die dritte Spur kommen.
Und jetzt muss sie einfach nur warten und Scharen von Straßenhändlern abwehren, die an den Autoschlangen auf und ab laufen und Strohhüte feilbieten, milagros, Plastik-Puzzles mit der Landkarte von Mexiko, Getränke, Tacos, Burritos, T-Shirts, Basecaps und allen erdenklichen Krempel. Der Platz vor dem Kontrollpunkt ist ein einziger Trödelmarkt, und Nora kauft einen billigen Sombrero, einen Poncho und ein bedrucktes T-Shirt - einerseits, um ihre Tarnung als Touristin zu vervollkommnen, andererseits, weil sie Mitleid mit den Händlern hat, unter denen viele Kinder sind.
Noch drei Autos sind vor ihr, als Raúl erneut durchs Fernglas sieht und »Scheiße!« schreit.
Der Autozerleger springt auf. »Was ist?«
»Die wechseln die Leute aus!«
Raúl verfolgt, was dort vor sich geht. Ein Grenzoffizier verteilt die Posten um. Das ist übliche Praxis, aber dass es gerade jetzt passiert, kann kaum Zufall sein.
»Haben sie Lunte gerochen?«, fragt der Autozerleger. »Wollen wir abbrechen?«
»Zu spät«, sagt Raúl. »Jetzt kommt sie nicht mehr raus.«
Der Autozerleger fängt an zu schwitzen.
Nora sieht ebenfalls, dass die Posten ausgewechselt werden. Bitte, lieber Gott, nicht ausgerechnet jetzt, fleht sie, ihr Herz rast, und sie atmet tief durch, um sich zu beruhigen. Die Posten sind darauf trainiert, Anzeichen von Angst zu erkennen, sagt sie sich und will nichts weiter sein als eine Blondine auf dem Heimweg von einem heißen Party-Wochenende in Mexiko.
Der Ford Explorer rückt jetzt vor zur Kontrolle, »rappelvoll mit Chicanos«, wie Fabián meinte, und ebenfalls Teil des Plans. Der Posten wird lange brauchen, um alle zu kontrollieren, und Nora vielleicht umso schneller durchwinken. Tatsächlich: Er stellt eine Unmenge Fragen, beäugt den Ford von allen Seiten, schaut in die Fenster, prüft die Papiere. Der Golden Retriever entwischt aus dem Auto, dreht ausgelassen eine Runde und wedelt mit dem Schwanz.
Gut, dass es so lange dauert, denkt Nora, das ist Teil des Plans. Aber auch nervenaufreibend.
Endlich darf der Ford weiterfahren, und Nora rückt auf. Sie schiebt die Sonnenbrille hoch, damit dem Posten die ganze Strahlkraft ihrer blauen Augen zuteil wird. Aber sie grüßt nicht und fängt kein Gespräch an - auch zu freundliche Leute erregen Verdacht.
»Ihre Papiere«, sagt der Posten.
Sie zeigt ihm den kalifornischen Führerschein, ihr Pass liegt gut sichtbar auf dem Beifahrersitz.
»Was war der Zweck Ihrer Reise, Ms. Hayden?«
»Ich bin übers Wochenende runtergefahren«, sagt sie. »Sie wissen schon. Sonne, Strand, ein paar Cocktails.«
»Wo haben Sie übernachtet?«
»Hotel Rosarita.« Die Quittung mit der Nummer ihrer Visa Card hat sie in der Handtasche.
Der Posten nickt. »Weiß das Hotel, dass Sie die Handtücher mitgenommen haben?«
»Oops!«
»Führen Sie irgendwelche Wertgegenstände ein?«
»Nur das Zeug hier«, sagt sie.
Der Posten mustert die Sachen, die sie eben gekauft hat.
Jetzt kommt der kritische Moment. Entweder, er winkt sie durch, oder er beäugt das Auto ein bisschen gründlicher, oder er winkt sie hinaus auf die Kontrollspur. Option eins und zwei sind annehmbar, Option drei könnte zur Katastrophe führen, und Raúl hält den Atem an, als sich der Posten durchs Fenster beugt und die Rückbank inspiziert.
Nora lächelt nur und wippt mit dem Fuß, im Takt mit dem Classic-Rock aus dem Autoradio.
Der Posten richtet sich wieder auf.
»Drogen?«
»Wie bitte?«
Der Posten lächelt. »Gute Fahrt, Ms. Hayden.«
»Sie ist durch«, atmet Raúl auf. Der Autozerleger muss dringend auf die Toilette. »Freu dich nicht zu früh«, brüllt ihm Raúl nach. »In San Onofre kommt die nächste Kontrolle.«
Das Telefon auf Kellers Schreibtisch klingelt. »Keller.«
»Sie ist durch.«
Keller lässt sich das Auto beschreiben, das Kennzeichen durchgeben. Dann ruft er den Kontrollpunkt San Onofre an.
Adán Barrera bekommt einen ähnlichen Anruf. »Sie ist durch«, verkündet ihm Raúl.
Er ist erleichtert, aber noch ist es nicht ausgestanden. Erst muss sie auch den amerikanischen Kontrollpunkt durchlaufen, der auf einem einsamen Streckenabschnitt des Freeway 5 liegt, ein wenig nördlich vom Marinestützpunkt Pendieton und voller Überwachungskameras und Abhörtechnik. Wenn die DEA zuschlägt, dann dort, weit weg von den Beobachtungsposten der Barreras. Es kann durchaus sein, dass Nora geradewegs in eine Falle fährt.
Nora fährt nordwärts auf der 5, der großen Nord-Süd-Achse, die ganz Kalifornien durchläuft. Vorbei an San Diego, dem Flughafen, dem Meeresmuseum, dem großen Mormonentempel im Zuckerbäckerstil, dann passiert sie die Abfahrt nach La Jolla, die Rennstrecke von Del Mar, das Zentrum von Oceanside und hält schließlich an einer Raststätte südlich des Marinestützpunkts Pendieton.
Sie steigt aus und schließt den Wagen ab. Die in der Nähe parkenden Sicarios der Barreras sieht sie nicht, aber sie weiß, sie sind da, sitzen irgendwo in einem oder in mehreren Autos, um den Geldtransport zu bewachen, während sie die Toilette benutzt, obwohl kaum jemand auf die Idee kommen wird, einen gebrauchten Toyota Camry zu stehlen.
Die Toilettenfrau wartet geduldig, während sie sich das Gesicht wäscht und ihr Make-up auffrischt. Nora bedankt sich mit einem Dollar Trinkgeld, geht hinaus zum Pepsi-Automaten, holt sich eine Diät-Pepsi, steigt wieder ins Auto und fährt los, weiter Richtung Norden. Sie liebt diesen Teil der Strecke, denn wenn die Kasernen vorüber sind, gibt es nichts mehr zu sehen außer den kahlen Hügeln rechts und links, den zwei Fahrbahnen und dem blauen Ozean.
Den Kontrollpunkt San Onofre hat sie schon Hunderte Male passiert, so wie die meisten Südkalifornier, wenn sie von San Diego nach Orange County fahren. Der war immer schon ein Witz, denkt sie, während der Verkehr vor ihr langsamer wird, ein Grenzkontrollpunkt, siebzig Meilen von der Grenze entfernt. Aber Tatsache ist, dass es die meisten Illegalen in den Großraum Los Angeles zieht und dass sie überwiegend den Freeway 5 benutzen - vielleicht ist das der Grund.
Normalerweise bremst man ab, wenn der Kontrollpunkt kommt, und wenn man hellhäutig genug ist, winkt einen der Posten mit einer gelangweilten Handbewegung durch. So wird es auch diesmal sein, denkt sie, als noch ein Dutzend Autos vor ihr sind.
Nur dass es diesmal anders kommt. Der Posten stoppt ihr Auto.
Keller schaut auf die Uhr - zum wiederholten Mal. Jetzt müsste es so weit sein. Er weiß, wann sie die Grenze überquert hat, wann sie an der Raststätte war. Wenn sie nicht irgendwo abgebogen ist, wenn ihr nicht die Nerven durchgegangen sind, wenn ... wenn ... wenn...
Adán Barrera läuft in seinem Büro auf und ab. Auch er hat den zeitlichen Ablauf im Kopf, Nora muss jeden Augenblick anrufen. In der Nähe von Pendieton darf sie das natürlich nicht riskieren, und bevor sie nach San Onofre kommt, gibt es auch nichts zu melden, aber mittlerweile müsste sie durch sein. Müsste allmählich in San Clemente ankommen ...
Der Posten fordert sie auf, die Scheibe herunterzulassen.
Ein zweiter Posten geht hinüber auf die Beifahrerseite. Sie senkt auch die andere Seitenscheibe, dann blickt sie zu dem Posten auf, der neben ihr steht, mit dem strahlendsten Lächeln, das sie zu bieten hat, und fragt: »Irgendwas nicht in Ordnung?«
»Haben Sie Ihre Papiere dabei?«
»Sicher.«
Sie kramt in der Handtasche nach dem Führerschein und hält ihn hoch, damit ihn der Posten prüfen kann. Währenddessen greift der andere Posten in den Wagen und schiebt den Positionsmelder unter die Kopfstütze des Beifahrersitzes.
Der Mann, der Noras Führerschein prüft, lässt sich reichlich Zeit. Schließlich sagt er: »Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, Ma'am«, und winkt sie durch.
Beim ersten Klingeln greift Keller zum Hörer. »Es hat geklappt.«
Er legt auf und atmet erleichtert durch. Die Technik ist installiert, mehrere Verkehrshubschrauber und Privatflugzeuge stehen bereit, um ihre Route zu verfolgen.
Und wenn sie die Chinesen trifft, sind wir mit von der Partie.
Erst in San Clemente greift Nora zum Handy und ruft in Tijuana an. Als sich Fabián meldet, sagt sie: »Ich bin durch« - weiter nichts.
Jetzt muss sie weiter nordwärts fahren, bis ihr die Chinesen Ort und Uhrzeit des Treffens durchgeben.
Also macht sie genau das - sie fährt weiter nordwärts.
Als Adán Barrera den Anruf von Raúl bekommt, dass Nora den Kontrollpunkt San Onofre passiert hat, ist er beruhigt. Er geht hinaus in den Garten und macht einen Spaziergang. Jetzt heißt es abwarten.
Fabián hat Lastwagen in Los Angeles bereitgestellt. Die sollen die Waffen zu einem einsamen Wüstenort bringen, wo sie auf andere Lastwagen umgeladen, zu verschiedenen Landepisten transportiert und dann nach Kolumbien geflogen werden sollen.
Es ist alles bereit, aber erst muss Nora die entscheidende Transaktion mit den Chinesen vornehmen. Und bevor sie das kann, müssen ihr die Chinesen mitteilen, wann und wo es geschehen soll.
Auch Keller hat seine Leute bereit - ganze Trupps schwerbewaffneter DEA-Agenten, Bundespolizei und FBI sind in San Pedro stationiert und warten auf den Einsatzbefehl. Der Hafen von San Pedro erstreckt sich über ein riesiges Gebiet, die GOSCO-Anlagen sind nicht zu überschauen - ein Lagerhaus neben dem anderen, und sie brauchen genaue Hinweise, wo der Zugriff stattfinden soll. Die Schwierigkeit ist nur, dass sie sich vom Hafen fernhalten müssen, bis die Übergabe beginnt, um dann blitzschnell vor Ort zu sein.
Keller sitzt jetzt im Hubschrauber und studiert das Display mit dem Straßennetz von Orange County. Das rot blinkende Pünktchen ist Nora. Er liegt mit sich im Widerstreit. Soll er eine Bodeneinheit auf sie ansetzen oder noch warten? Er entscheidet sich fürs Warten, als sie den Freeway an der Ausfahrt zum Highway 405 verlässt und Richtung San Pedro fährt.
Wie zu erwarten.
Nicht zu erwarten aber war, dass das rote Pünktchen auf dem McArthur Boulevard in Irvine plötzlich abbiegt und in westlicher Richtung fährt.
»Was zum Teufel soll das?«, ruft er und befiehlt dem Piloten, ihr nachzufliegen.
»Geht nicht, Einflugschneise«, antwortet der Pilot.
Dann begreift Keller, was sie vorhat.
»Gottverdammich!«
Er schickt Bodeneinheiten zum John Wayne Airport. Aber das Display klärt ihn darüber auf, dass der Flughafen fünf verschiedene Ausfahrten hat, und er kann von Glück reden, wenn es seine Leute wenigstens zu einer von diesen Ausfahrten schaffen.
Sie verlässt den McArthur Boulevard am Flughafen und fährt in die Parkzone ein.
Kellers Hubschrauber kreist über der 405, nördlich des Flughafens. Ich kann nur hoffen, denkt er, dass sie in die abhörsichere Zone eingebogen ist, um sich die Adresse in San Pedro durchgeben zu lassen, und gleich wieder auf die 405 zurückkehrt.
Oder sie besteigt mit ihren Millionen ein Flugzeug. Er starrt auf das Display, doch der rote Punkt bleibt verschwunden.
»Ich bin da«, spricht Nora in ihr Handy.
Raúl nennt ihr eine Adresse in Costa Mesa, nur zwei Meilen entfernt. Sie verlässt den Parkplatz, fährt aber nicht zurück auf die 405, sondern weiter westlich auf dem McArthur Boulevard, dann biegt sie in die Bear Street ab und taucht in das Straßennetz von Costa Mesa ein.
Sie findet die Adresse sofort, eine kleine Werkstatt in einer Straße voller Lagerhäuser. Ein Mann mit Mac-10-Maschinenpistole öffnet ihr das Tor, und sie fährt hinein. Kaum hat sich das Tor hinter ihr geschlossen, kommt sie sich vor wie beim Boxenstop eines Formel-1-Rennens - eine ganze Mannschaft macht sich mit Spezialwerkzeugen über das Auto her, zerlegt es in Minutenschnelle, packt die Geldbündel in Haliburton-Koffer und die Koffer in den Kofferraum eines schwarzen Lexus.
Jetzt könnte einer damit durchbrennen, denkt sie, aber keiner dieser Männer denkt auch nur im entferntesten daran. Das sind Illegale aus Mexiko, und Barreras Sicarios halten ihre Familien in Schach, mit dem Befehl, jeden zu erschießen, wenn der Kurier nicht pünktlich und unbehelligt die Werkstatt verlässt.
Der Mann mit der Maschinenpistole überreicht ihr ein neues Handy.
Sie ruft Raúl an. »Fertig.«
»Farbe?«
»Blau«, sagt sie. Jede andere Farbe würde bedeuten, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wird. »Fahr los.«
Sie steigt in den Lexus, verlässt die Werkstatt und fährt zurück zur 405, Richtung San Pedro. Direkt unter dem Hubschrauber der Verkehrswacht durch.
Keller starrt auf das leere Display.
Keine Frage, Nora Hayden ist ihm entwischt.
Sie weiß es, sie merkt es, sie fährt nordwestwärts, Gott weiß wohin, und sie ist ganz allein auf sich gestellt. Was keine neue Erfahrung für sie ist. Abgesehen von den paar Jahren mit Parada war sie immer allein, ihr ganzes Leben lang.
Aber sie weiß nicht, wie sie das jetzt hinkriegen soll. Oder was passieren wird. Am einfachsten wäre es, die Dinge laufen zu lassen, mit dem Geld immer weiterzufahren, aber so erreicht sie nicht, was sie will.
Es ist schon dunkel, als sie Carson passiert, die Erdgasfackeln des Bohrgeländes ragen in den Himmel wie die Schornsteine einer Höllenschmiede. Dem Plan zufolge soll sie an der Ausfahrt zum LAX abbiegen und anrufen.
Dort erfährt sie, wo das Treffen stattfindet.
An einer AARCO-Tankstelle auf dem Freeway 110, Richtung San Pedro.
»Farbe?«
»Blau.«
»Fahr weiter.«
Eine Sekunde überlegt sie, ob sie die Nummer eintippen soll, die Keller ihr gegeben hat, aber erstens wird die Nummer dann aufgezeichnet, und zweitens könnte das Auto verwanzt sein. Also fährt sie weiter zur Tankstelle und hält an einer Zapfsäule. Ein Scheinwerfer blinkt auf. Sie fährt zu einer Reihe Telefonzellen hinüber (Wer benutzt denn heutzutage noch die Telefonzelle?, fragt sie sich) und bleibt sitzen. Aus dem anderen Auto steigt ein Asiat, er trägt einen kleinen Aktenkoffer, kommt zu ihr herüber, sie entriegelt die Beifahrertür, er steigt ein.
Ein junger Mann, Mitte zwanzig, schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte, offenbar die Uniform der asiatischen Geschäftsleute.
»Ich heiße Lee«, sagt er. »Ich heiße Smith.«
»Tut mir leid«, sagt Lee, »aber drehen Sie sich bitte zur Seite, und legen Sie die Hände an die Scheibe.«
Er tastet sie nach Wanzen ab. Dann klappt er sein Köfferchen auf, holt einen kleinen elektronischen Sensor heraus und überprüft das Auto auf Wanzen. »Ich hoffe, Sie verzeihen mir«, sagt er.
»Kein Problem.«
»Fahren wir.«
»Wohin?«
»Das sage ich Ihnen gleich.«
Er gibt ihr die Anweisungen, und sie fahren Richtung Hafen.
Keller lässt die Hafenanlagen der GOSCO überwachen. Das ist sein letzter und bester Trumpf.
Ein DEA-Agent sitzt in der Kanzel eines großes Krans, sein Nachtsichtgerät auf die Zufahrt gerichtet.
Er meldet Keller die Ankunft eines schwarzen Lexus. »Können Sie den Fahrer identifizieren?«
»Negativ. Getönte Scheiben.«
Könnte jeder sein, denkt Keller. Nora, ein GOSCO-Manager, ein Freier auf der Suche nach einer dunklen Ecke für den Blowjob.
»Bleiben Sie dran.«
Allzu viel will er nicht telefonieren. Wenn der Deal tatsächlich läuft, überwachen die Narcos den Telefonverkehr. Zwar ist die Leitung verschlüsselt, aber er muss mit der traurigen Tatsache leben, dass die Narcos ein größeres Budget haben und besser ausgestattet sind.
Jetzt hockt er in einem Hippie-Van drei Meilen vom Hafen entfernt und wartet. Mehr ist nicht drin.
Nora fährt zwischen Lagerhäusern durch, die quer zu den Kaianlagen verlaufen. Zwei riesige GOSCO-Frachter liegen dort auf Dock, Schweißer, die irgendwelche Reparaturen ausführen, erzeugen Funkenregen, Gabelstapler pendeln zwischen den Lagerhäusern und dem Kai. Sie fährt weiter, bis sie in eine ruhigere Gegend kommen.
Das Tor eines Lagerhauses öffnet sich, und Lee weist sie hinein.
»Ich hab das Objekt verloren«, sagt der DEA-Mann. »Es ist in ein Lagerhaus eingefahren.«
»Welches verdammte Lagerhaus?!«
»Eins von dreien«, sagt der Agent. »D-1803,1805 oder 1807.«
Keller sucht auf dem GOSCO-Lageplan. Binnen zehn Minuten können seine Mannschaften die Lagerhäuser von zwei Seiten einkreisen. Er schaltet den Kanal frei und gibt durch: »Alle Mannschaften bereitmachen zum Einsatz. Start in fünf Minuten.«
Mr. Lee ist sehr höflich.
Er steigt aus, geht ums Auto herum und hält Nora die Tür auf. Sie steigt aus, blickt sich um.
Wenn hier eine große Waffenlieferung gelagert sein soll, muss sie gut getarnt sein. Was sie sieht, sind nichts als leere Regale und ein schwarzer Lexus, der genauso aussieht wie der, mit dem sie gekommen ist.
Sie blickt Lee fragend an.
»Haben Sie das Geld?«, fragt er.
Sie öffnet den Kofferraum, dann die Koffer. Lee kramt ein wenig in den Bündeln aus gebrauchten Scheinen, dann klappt er die Koffer wieder zu.
»Jetzt Sie«, sagt Nora.
»Wir warten.«
»Worauf?«
»Ob die Polizei kommt.«
»Das stand nicht auf der Agenda.«
»Vielleicht nicht auf Ihrer«, sagt Lee. Sie starren sich wortlos an.
»Das«, sagt sie schließlich, »ist mir zu langweilig.« Sie steigt zurück ins Auto und denkt: Bitte, lieber Gott, mach, dass Keller nicht durch dieses Tor kommt.
Shag Wallace meldet sich über Funk. »Auf dein Signal, Boss.«
Keller macht die schusssichere Weste zu, entsichert die M16, atmet tief durch und sagt: »Start!«
»Bitte bestätigen.«
»Stopp!«, brüllt er ins Mikro. Es kommt aus dem Bauch - irgendwas stimmt hier nicht, die sind einfach zu vorsichtig, gehen zu sehr auf Nummer sicher. Oder meine Nerven machen nicht mehr mit. Aber er sagt: »Abwarten.«
Fünfzehn Minuten. Zwanzig Minuten. Dreißig Minuten. Nora greift zu ihrem Handy. »Was haben Sie vor?«, fragt Lee.
»Meine Leute anrufen«, sagt Nora. »Die fragen sich langsam, was mit mir passiert ist.«
Er reicht ihr ein anderes Handy. »Nehmen Sie das.«
»Warum?«
»Sicherheit.«
Sie zuckt die Schultern und nimmt das Handy. »Wo sind wir hier?«
»Holen Sie Ihre Leute nicht her.«
»Warum nicht?«
Er hat dieses selbstgefällige Lächeln im Gesicht, das sie so gut kennt - meist bei Männern, die in den Genuss ihrer vorgetäuschten Orgasmen kommen. »Die Ware ist nicht hier.«
»Wo dann?«
Da bis jetzt keine Polizei gekommen ist, kann er sicher sein und den richtigen Ort nennen. Außerdem hat er die Geliebte von Adán Barrera als Geisel.
»Long Beach.«
Dort befindet sich die neue Anlage der GOSCO, erklärt er ihr.
Kai 4, Reihe D, Lagerhaus 3323.
Sie ruft Raúl an und nennt ihm die Angaben. Dann sagt sie zu Lee: »Wir müssen unseren Boss anrufen und das Okay für die geänderte Abholadresse einholen.«
Art Keller schwitzt Blut und Wasser.
Wenn das Nora war, die in dem Lagerhaus verschwunden ist, dann ist sie jetzt schon eine halbe Stunde dort drinnen, und nichts hat sich getan. Irgendwas läuft hier falsch.
»Alles in Bereitschaft halten«, gibt er durch. »Auf mein Signal geht's los.«
Dann klingelt sein Handy.
Lee hört misstrauisch zu, wie Nora mit Adán Barrera spricht und ihm erzählt, sie sei in ein leeres Gebäude gebracht und durchsucht worden, und die Waffenlieferung befinde sich in Long Beach, Kai 4, Reihe D, Lagerhaus 3323.
»Kai 4, Reihe D, Lagerhaus 3323«, wiederholt Art Keller.
»Exakt«, sagt Nora, klickt das Gespräch weg und gibt das Handy zurück.
»Fahren wir«, sagt sie.
Er schüttelt den Kopf. »Wir bleiben hier.«
»Ich verstehe nicht.«
Sie versteht sofort, als er eine 45er aus dem schwarzen Jackett zieht und auf seinen Schoß legt. »Wenn die Transaktion ohne Komplikationen erfolgt ist«, sagt er, »nehme ich den Wagen mit dem Geld, und Sie nehmen den anderen und können fahren. Sollte aber irgendetwas Unerwünschtes passieren, dann ...«
Long Beach, denkt Keller.
Verdammte Scheiße. Wir müssen dort sein, bevor die Barreras mit ihren Lastwagen kommen. Er funkt seinen Leuten durch, dass sie sofort aufbrechen müssen. Wir müssen mit dieser ganzen verfluchten Armee runter nach Long Beach, und das sofort.
Fabián Martínez denkt etwa dasselbe. Er hat den ganzen Konvoi auf der Straße, drei Sattelschlepper mit der Aufschrift CALEXICO PRODUCE COMPANY, die schon auf dem Weg nach San Pedro sind, nun müssen sie umgeleitet werden auf die 405, runter nach Long Beach. Er ist stocksauer.
Sitzt vorn mit drin im ersten Truck, die Mac-10 unterm Mantel, für alle Fälle.
Zwei seiner besten Männer fahren eine Meile voraus. Sie peilen die Lage, und wenn irgendwas nicht stimmt, piepsen sie ihn an, dann heißt es nichts wie weg.
Für eine südkalifornische Nacht ist es sehr kalt, selbst für den Monat März. Er klappt den Mantelkragen hoch und befiehlt dem Fahrer, die Heizung einzuschalten.
Nora sitzt im Lexus und wartet.
»Was dagegen, wenn ich Radio höre?«, fragt sie Lee. Lee hat nichts dagegen.
Wir müssen das in unseren Plan einbauen, überlegt Keller auf der Fahrt nach Long Beach. Dann fragt er sich: Welchen Plan? Und da liegt das Problem. Den Zugriff in San Pedro hatte er taktisch vorbereitet, doch jetzt wird es eine Holterdipolter-Aktion mit ungewissem Ausgang, und das macht ihn verdammt nervös.
Am besten wäre es, abzuwarten, bis die Barreras ihre Tracks beladen haben, und sie dann auf der Straße hochzunehmen. Aber er muss sichergehen, dass Nora nichts passiert. Daher muss der Zugriff im Lagerhaus stattfinden, und jetzt muss es zudem noch plötzlich geschehen. Zuschlagen und zugreifen.
Alle seine Leute sind informiert - sie wissen, dass der Herr der Grenzen ungeheuer scharf auf la Güera ist, und er will sie lebend, damit er sie unter Druck setzen kann, damit sie gegen ihren Geliebten aussagt. Das hat er ihnen eingeschärft, aber werden sie in der Hitze des Gefechts daran denken, wenn die Barrera-Leute zum Beispiel zu den Waffen greifen?
Das Ganze hat das Potential einer mittleren Feldschlacht, und Nora könnte dabei draufgehen.
Über Funk spricht er noch einmal mit Shag, um sicherzugehen, dass er das verstanden hat.
Fabians Vorauskommando bemerkt nichts Verdächtiges und piepst ihm das 666-Signal durch.
Ein Uhr nachts, und an den Laderampen von Long Beach herrscht Hochbetrieb. Sehr gut, denkt Fabián. Drei Tracks mehr fallen da nicht auf.
Er findet Kai 4, dann Reihe D, dann Lagerhaus 3323, eine große Leichtbauhalle wie all die anderen. Er springt aus dem Track, klopft ans Bürofenster und wartet, stampft mit den Füßen, damit ihm warm wird, während zwei Chinesen die Tracks inspizieren - die Kabinen und die Laderäume. Das große Stahltor der Halle gleitet zur Seite.
Fabián klettert zurück in die Fahrerkabine, und der Konvoi fährt ein.
Nora zuckt hoch, als Lees Handy klingelt.
Sie sieht, wie sich seine Finger um den Pistolengriff spannen, während er zuhört. Holt tief Luft und will sein Handgelenk packen, als er das Gespräch beendet, sich zu ihr umdreht und sagt: »Ihre Leute sind dort. Alles in Ordnung.«
»Gut«, sagt sie. »Fahren wir.«
Er schüttelt den Kopf.
»Noch nicht.«
Fabián steht in der Halle und redet mit dem zuständigen Chinesen.
»Haben Sie Ihr Geld?«, fragt er. »Ja.«
»Wo ist sie?«
»An einem anderen Ort«, sagt der Mann. »Sobald die Transaktion ohne Komplikationen erfolgt ist, geben wir sie frei.«
Fabián gefällt das nicht. Nicht dass er sich ihretwegen Sorgen macht, er würde sie zwar gerne mal kräftig durchficken, aber ansonsten ist sie ihm egal - nur Adán ist sie nicht egal, und Adán macht ihn für ihre Sicherheit verantwortlich. Und diese Schlitzaugen halten sie als Geisel fest? So haben wir nicht gewettet. Also sagt er: »Ich will sie sprechen.«
Lee reicht Nora das Handy. »Sie möchten mit Ihnen sprechen.«
Nora nimmt das Handy.
»Welche Farbe?«, fragt Fabián.
»Rot.«
Fabián gibt dem Chinesen das Handy zurück, holt die Macio unterm Mantel vor und schiebt sie ihm ins Gesicht.
»Pfeifen Sie Ihren Mann zurück«, sagt der Chinese. »Er soll sich beruhigen.«
Fabians Leute haben augenblicklich die Waffen gezogen. Die Chinesen auch. Nur dass die meisten von ihnen auf den Galerien postiert sind und nach unten zielen, also einen taktischen Vorteil haben.
Das klassische Patt.
Bis die Verbindungstür zum Büro aufkracht.
Und das Chaos losbricht.
Keller ist als Erster drin, hinter ihm die Sturmspitze seiner Agenten. Er legt den Schalter um, das Schiebetor geht auf und macht den Weg frei für Kellers Eingreiftruppe. DEA, FBI, ATF, die ganze tödliche Buchstabensuppe, mit Schnellfeuergewehren, Schusswesten, Visieren und Kopflampen auf den Helmen.
Und alle brüllen sie aus Leibeskräften.
»KEINE BEWEGUNG!«
»DEA!«
»HINLEGEN! HINLEGEN!«
»FBI!«
»WAFFEN FALLEN LASSEN!«
Gewehre scheppern auf Gitterroste und Betonfußböden. Fabián überlegt einen Moment, ob es Sinn hat, zu schießen, sieht aber sofort ein, dass es zwecklos ist, lässt die Macio fallen und hebt die Hände.
Keller hält Ausschau nach Nora. In dem Durcheinander ist kaum etwas zu sehen. Männer versuchen zu fliehen, werden von Agenten zu Boden geworfen, er sucht nach ihren blonden Haaren, sieht sie nicht und brüllt »Los!« in sein Mikro, in der Hoffnung, dass Shag ihn hört, in der Hoffnung, dass es nicht zu spät ist.
Ein Chinese neben ihm brüllt auch - in sein Handy. Keller packt ihn beim Kragen, wirft ihn zu Boden und kickt das Handy weg.
Lee hört seinen Boss brüllen.
Nora sieht, wie sich seine Augen vor Entsetzen weiten, dann hebt er die Pistole, richtet sie auf ihre Stirn.
Sie schreit.
Ihr Schrei wird von einem dumpfen Knall übertönt.
Blut und Gewebereste spritzen an die Beifahrerscheibe.
Lee sackt zusammen, Nora dreht sich um und sieht den Scharfschützen im Eingang stehen, neben dem Tor, das aus den Angeln geflogen ist.
Sie schreit immer noch, als Shag Wallace langsam auf das Auto zugeht, die Tür öffnet und sie sanft am Ellbogen berührt.
»Alles in Ordnung«, sagt er. »Ihnen ist nichts passiert. Kommen Sie, wir müssen hier weg.«
Er führt sie nach draußen, setzt sie in seinen Wagen. »Warten Sie hier einen Moment.«
Shag geht zurück und nimmt dem toten Lee die 45er aus der Hand. Dann richtet er sie aus zehn Zentimetern Abstand auf seine Stirn, zielt auf das Einschussloch und drückt ab.
Er wischt die Pistole ab und geht wieder hinaus.
Setzt sich neben Nora und sagt ihr, sie soll die Pistole einen Moment halten, und nimmt sie ihr wieder ab. »Das ist Ihre Story: Die Sache lief völlig schief, er wollte Sie erschießen. Sie haben sich gewehrt, ihm die Pistole weggenommen und abgedrückt. Verstanden?«
Sie nickt.
Und glaubt, dass sie verstanden hat. Aber sie ist nicht sicher. Ihre Hände hören nicht auf zu zittern.
»Kommen Sie zurecht?«, fragt Shag. »Hören Sie, wenn es nicht geht, ist es nicht schlimm. Wir brechen sofort ab, wenn Sie wollen. Sie müssen nur Bescheid sagen.«
»Haben sie Adán verhaftet?«, fragt sie.
»Noch nicht«, erwidert Shag.
Sie schüttelt den Kopf.
Keller hat das Knie in Fabians Nacken gestemmt und fesselt ihm die Hände auf den Rücken.
»Die Schlampe hat's verraten, stimmt's?« fragt Fabián.
Keller drückt ein bisschen fester zu, während er Fabián über seine Rechte aufklärt.
»Können Sie drauf wetten, dass ich einen Anwalt nehme«, sagt Fabián.
Keller stellt ihn auf die Füße, verfrachtet ihn in einen Mannschaftswagen der DEA und geht zurück, um die zwei Frachtcontainer zu besichtigen. Zwanzig mal acht mal acht Fuß, vollbeladen mit Kisten.
Seine Männer holen sie heraus und hebeln sie auf.
Chinesische Kalaschnikows - zweitausend Stück - kommen ihnen in ihren Einzelteilen entgegen: Läufe, Magazine, Kolben. Andere Teile gehören zu den zwei Dutzend chinesischen Granatwerfern, die bei Guerillas sehr begehrt sind, weil sie von Hand abgeschossen werden können.
Zweitausend Gewehre, das sind zweitausend Kilo Kokain, kalkuliert Keller, wer weiß, wie viel Kilo die Granatwerfer wert sind, mit denen man Hubschrauber abschießen kann.
Als Nächstes finden sie sechs Lkw-Ladungen M2-Gewehre, das sind umgebaute Mi-Armeekarabiner, die den Vorteil haben, dass man sie mit einer einzigen Handbewegung auf Automatik umschalten kann. Dann noch ein paar LAWs, die amerikanische Version des Granatwerfers, für den Abschuss von Hubschraubern nicht geeignet, aber umso besser zum Knacken gepanzerter Fahrzeuge. Und alles perfekt geeignet für den Guerillakrieg.
Tausende Kilo Kokain wert.
Der größte aufgeflogene Waffenschmuggel überhaupt. Aber Keller ist noch nicht zufrieden.
All das ist wertlos, wenn ihm Adán Barrera durch die Lappen geht.
Er muss ihn kriegen, koste es, was es wolle.
Wenn ihm Barrera entschlüpft, kann nur noch eine helfen - Nora. Er hat schon einen Plan, aber Pläne können schiefgehen.
Sie wollte zu ihm zurück, sagt er sich. Du hast ihr den Ausstieg angeboten, aber sie hat sich so entschieden. Sie ist erwachsen, sie weiß, was sie will.
Klar, red dir das nur ein.
Nora fährt mit dem neuen Lexus bis zur ersten Ausfahrt, hält an einer Tankstelle, geht auf die Damentoilette und erbricht sich. Als ihr Magen leer ist, fährt sie weiter, zum Bahnhof von Santa Ana, stellt das Auto auf dem Parkplatz ab, geht in eine Telefonzelle und ruft Adán an.
Das Weinen macht ihr keine Schwierigkeiten, die Tränen fließen wie von selbst, während sie ihre Schluchzer unterdrückt. »Irgendwas ist schiefgegangen .. ich weiß nicht... er wollte mich erschießen... ich...«
»Komm zurück.«
»Die Polizei sucht wahrscheinlich schon nach mir.«
»Jetzt noch nicht«, beruhigt er sie. »Lass das Auto stehen, steig in den Zug, fahr nach San Ysidro und benutze die Fußgängerbrücke.«
»Adán, ich habe Angst.«
»Schon gut«, sagt er. »Geh zum Treffpunkt in der Stadt und warte dort. Ich melde mich.«
Sie weiß, was er meint. Das haben sie vor langer Zeit abgesprochen, für Notfälle wie diesen. Der Treffpunkt ist eine Wohnung in Tijuana.
»Ich liebe dich«, sagt sie.
»Ich liebe dich auch.«
Sie steigt in den nächsten Zug nach Süden, Richtung San Diego.
Pläne können auch schiefgehen.
In diesem Fall ist es so, dass die Mechaniker, die den Toyota Camry für den nächsten Einsatz fitmachen, etwas Interessantes finden, unter der Kopfstütze des Beifahrersitzes.
Eine Art Wanze.
Der Chef geht los, telefonieren.
Nora steigt in San Diego aus dem Zug, erwischt die Bahn nach San Ysidro, läuft hinüber zur Fußgängerbrücke und passiert die Grenze.
12 Flucht ins Dunkel
Slippin' into darkness,
when I heard my mother say ...
»You been slippin' into darkness, oh, oh, oh,
Pretty soon you're gonna pay.«
War, Slippin' into Darkness
Tijuana
1997
Nora Hayden ist verschwunden.
Das ist die einfache, brutale Wahrheit, mit der sich Keller herumschlagen muss.
Ernie Hidalgo, zweite Auflage.
Quelle Chupar, das gleiche Spiel?
Das sind die quälendsten Momente für einen Ermittler. Wenn der Kontakt abreißt, die Signale ausbleiben, Funkstille eintritt.
Es ist diese Stille, die ihm auf den Magen schlägt, die das Flämmchen der falschen Hoffnung allmählich erstickt.
Sie war nach Tijuana gefahren, um in einer Wohnung auf Adán zu warten. Aber sie hat sich dort nicht blicken lassen, auch der Herr der Himmel nicht. Antonio Ramos dagegen hat gewaltig Präsenz gezeigt - mit zwei Trupps seiner Spezialeinheiten in gepanzerten Fahrzeugen hat er die ganze Straße abgeriegelt und die Wohnung gestürmt wie eine Festung.
Nur dass sie leer war.
Kein Barrera, keine Nora.
Jetzt krempelt Ramos auf der Suche nach den Barrera-Brüdern die gesamte Baja-Provinz um.
Jahrelang hat er auf diese Gelegenheit gewartet. Die Regierung in Mexico City hat ihn von der Leine gelassen, als sich herausstellte, dass Adán Barrera Waffen für die Aufständischen in Chiapas und anderswo schmuggelt, und er wütet wie ein Pitbull im Blutrausch. Binnen einer Woche hat er sieben Drogendepots hochgehen lassen, alle in den Reichenvierteln von Tijuana gelegen.
Eine ganze Woche lang sind seine Sturmtruppen mit Panzerwagen und Humvees ohne das geringste Zartgefühl durch die gepflegten Straßen gerattert, haben teure schmiedeeiserne Tore gesprengt, Wohnungen auf den Kopf gestellt, den Verkehr lahmgelegt und das Geschäftsleben für Stunden zum Stillstand gebracht. Fast so, als hätte er es darauf angelegt, die Eliten der Stadt zu verärgern, die tatsächlich überlegen, wem sie die Schuld an diesem Terror zuschieben sollen - den Barreras oder dem wildgewordenen Ramos.
Schließlich hat sich Adán Barrera in langen Jahren vor allem darum bemüht, sich so fest in die bessere Gesellschaft zu integrieren, dass ein Angriff auf ihn zwangsläufig zu einem Angriff auf die Oberschicht werden musste. Und die erhebt jetzt ein wütendes Geschrei, beschwert sich in Mexico City, Ramos sei außer Rand und Band und trample auf ihren Bürgerrechten herum.
Ramos ist es egal, ob ihn die Reichen hassen. Er hasst sie mindestens genauso und ist überzeugt, dass sie ihre Seelen, sofern vorhanden, längst an die Barrera-Brüder verkauft haben, dass die Drogenbosse bei ihnen ein und aus gehen, dass sie ihren Söhnen und Neffen erlauben, ins Schmuggelgeschäft einzusteigen, die sich damit den billigen Kitzel des Abenteuers und zugleich das schnelle Geld verschaffen. Und die Herrschaften, sagt sich Ramos, feiern die Barreras, als wären sie Rockmusiker, Filmstars.
Das sagt er ihnen auch ins Gesicht, wenn sie kommen, um sich zu beschweren.
Jetzt hört mal zu, erklärt Ramos den Honoratioren von Tijuana. Diese Verbrecher haben einen katholischen Kardinal ermordet, und ihr ladet sie in eure Häuser ein. Sie haben reihenweise Bundespolizisten niedergemäht, auf offener Straße, und ihr habt sie gedeckt. Sie haben euren Polizeichef ermordet, und ihr habt keinen Finger gerührt. Also kommt mir jetzt nicht mit Klagen - das habt ihr euch alles selbst eingebrockt.
Ramos spricht sogar im Fernsehen und stellt die Stadt an den Pranger.
Er schaut direkt in die Kamera und verkündet, dass er Adán und Raúl Barrera binnen vierzehn Tagen hinter Schloss und Riegel bringen, dass ihr Kartell auf dem Müllhaufen der Geschichte landen wird. Er stellt sich neben Berge beschlagnahmter Waffen und Drogen und nennt Namen - Adán und Raúl Barrera, Fabián Martínez - in einem Atemzug mit denen etlicher reicher Sprösslinge aus Tijuana, die er ebenfalls hinter Gitter zu bringen verspricht.
Dann teilt er mit, dass er sechzig Federales gefeuert hat, weil ihnen die »moralische Befähigung« für den Polizistenberuf abgehe, und erklärt es zu einer nationalen Schande, dass es in der Baja-Provinz viele Polizisten gibt, die dem Barrera-Kartell dienen, statt es zu bekämpfen.
Ich werde nicht kapitulieren, verkündet er. Ich setze den Kampf gegen die Barreras fort. Wer stellt sich auf meine Seite?
Nun, nicht allzu viele.
Ein junger Staatsanwalt, ein Ermittler der Provinzpolizei, seine eigenen Leute - und das war's auch schon.
Keller kann verstehen, warum sich die Bewohner von Tijuana nicht hinter ihn stellen.
Sie haben Angst.
Aus gutem Grund.
Vor zwei Monaten wurde ein Polizist, der die Namen bestochener Kollegen preisgegeben hatte, in einem Seesack am Straßenrand gefunden. Jeder Knochen in seinem Körper war zerschlagen - eine Hinrichtung im Stil von Raúl Barrera. Drei Wochen ist es her, dass ein anderer Staatsanwalt, der gegen die Barreras ermittelte, beim morgendlichen Joggen in den Sportanlagen der Universität erschossen wurde. Die Täter sind noch nicht gefasst. Und der Direktor des Gefängnisses von Tijuana wurde aus einem fahrenden Auto heraus erschossen, als er auf seiner Veranda die Morgenzeitung las. Man sagt, er soll einen verhafteten Barrera-Mann beleidigt haben.
Die Barreras sind zwar auf der Flucht, aber das heißt keineswegs, dass ihre Schreckensherrschaft vorüber ist. Die Leute werden erst dann aus ihren Löchern kommen, wenn sie die beiden Brüder tot auf der Bahre liegen sehen.
Doch die Wahrheit ist, denkt Keller nach einer Woche Suchaktion, dass wir gescheitert sind, und die Leute wissen es.
Raúl und Adán Barrera sind noch nicht gefasst.
Und Nora?
Dass ihnen Adán Barrera nicht in die Falle ging, gar nicht in der Stadtwohnung auftauchte, bedeutet wahrscheinlich, dass Noras Tarnung aufgeflogen ist. Keller hofft zwar noch auf ein Lebenszeichen von ihr, aber die Tage vergehen, und er muss sich darauf einstellen, dass man nur noch ihre Leiche findet.
Keller ist also nicht in bester Stimmung, als er das Bundesgefängnis von San Diego betritt, um mit Fabián Martínez zu plaudern, auch bekannt als el Tiburón.
Im orangefarbenen Overall, mit Handschellen und Fußfesseln wirkt der kleine Dreckskerl nicht mehr ganz so überlegen, aber er hat immer noch das arrogante Grinsen im Gesicht, als er ins Verhörzimmer geführt wird und sich in den Klappstuhl plumpsen lässt.
»Sie haben eine katholische Schule besucht, oder?«, fragt Keller.
»Augustine«, sagt er, »hier in San Diego.«
»Dann kennen Sie also den Unterschied zwischen Hölle und Fegefeuer.«
»Helfen Sie meinem Gedächtnis auf.«
»Gern«, sagt Keller. »Erst mal: beides bringt Qualen. Aber das Fegefeuer ist zeitlich begrenzt, während die Hölle für die Ewigkeit ist...«
»Ich höre.«
Keller wird deutlicher. Allein der illegale Waffenhandel bringt ihm dreißig Jahre bis lebenslang, nicht zu reden von den verschiedenen Drogendelikten, die alle von fünfzehn Jahren bis lebenslang bedeuten. Das wäre also die Hölle. Doch wenn er als Kronzeuge auftritt, bedeutet das ein paar Jahre mit allerlei peinlichen Aussagen gegen seine alten Freunde, gefolgt von einer überschaubaren Gefängnishaft, danach einer neuen Existenz unter anderem Namen. Das wäre das Fegefeuer.
»Erstens mal«, antwortet Fabián, »hab ich von den Waffen nichts gewusst. Ich sollte nur Ware abholen. Zweitens, wieso Drogendelikte? Was haben Drogen damit zu tun?«
»Ich habe einen Zeugen«, sagt Keller, »der bestätigen kann, dass Sie im Zentrum eines großen Drogennetzwerks stehen. Sie sind ein ganz dicker Fisch, und so fällt auch die Strafe aus - außer, Sie entscheiden sich fürs Fegefeuer.«
»Sie bluffen.«
»Hey, ich kann Ihnen die Karten auf den Tisch legen, wenn Sie wollen. Dreißig Jahre bis lebenslang. Aber noch stehen Sie im Bieterwettbewerb mit den anderen Kronzeugen, und wer das meiste zu erzählen hat, gewinnt.«
»Ich will einen Anwalt.«
»Also kein Deal?«
»Kein Deal.«
»Dann muss ich Sie über Ihre Rechte aufklären.«
»Haben Sie schon.« Fabián lümmelt sich auf seinem Stuhl. Er langweilt sich, will zurück in die Zelle, in seinen Magazinen blättern.
»Das war wegen Waffenschmuggel«, sagt Keller. »Ich muss es noch mal machen. Wegen der Mordanklage.«
Jetzt fährt er hoch. »Welche Mordanklage?«
»Ich verhafte Sie wegen Mordes an Juan Parada«, sagt Keller. »Laut Haftbefehl von 1994. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen -«
»Sie haben nicht das Recht, mich wegen einer Sache in Mexiko zu belangen.«
Keller beugt sich über den Tisch. »Paradas Eltern waren Einwanderer. Er wurde in Laredo, Texas, geboren, also war er amerikanischer Staatsbürger, genauso wie Sie. Das heißt, Sie fallen unter unsere Gerichtsbarkeit. Hey, vielleicht kriegen Sie Ihren Prozess in Texas - der Gouverneur ist ein wahrer Fan der Todesspritze. Wir sehen uns vor Gericht, du Arschloch.«
Jetzt kannst du mit deinem Anwalt reden. Und voll in die Scheiße treten.
Wäre Adán Barrera mit dem Auto zu Nora in die Stadtwohnung gefahren, hätte ihn die Polizei wahrscheinlich erwischt. Aber er ging zu Fuß.
Damit hatte niemand gerechnet. Deshalb drehte er schnell um, machte sich aus dem Staub, als er die Polizeiautos sah, lief direkt an den Straßenblockaden vorbei, die in den umliegenden Straßen errichtet waren.
Doch ganz so gut läuft es seitdem nicht mehr.
Aus zwei Verstecken ist er schon verjagt worden, gerade noch rechtzeitig von Raúl gewarnt, jetzt sitzt er wieder in einem geheimen Schlupfwinkel im Rio-Viertel und wartet, dass die Sturmtrupps die Tür eintreten. Am schlimmsten hat es das Kommunikationsnetz getroffen. Nichts geht mehr. Seine unverschlüsselten Handys will er lieber nicht benutzen, und auch die verschlüsselten sind gefährlich - die Polizei kann sie nicht abhören, aber möglicherweise orten. Er weiß nicht, wer verhaftet ist, welche Häuser gestürmt sind, was in ihnen gefunden wurde. Er weiß nicht, wer die Razzien durchführt, wen es als nächsten trifft, ob sie wissen, wo er sich versteckt.
Wirklich Sorgen bereitet ihm aber die Tatsache, dass es keine Vorwarnung gab.
Mit keinem Wort, mit keiner Silbe haben ihn die gut bezahlten Freunde in Mexico City gewarnt.
Das macht ihm Angst, denn wenn sich die PRI-Politiker gegen ihn stellen, müssen sie wirklich die Hosen voll haben. Und sie müssen unbedingt den Kopf des Barrera-Kartells treffen, sie können sich nicht leisten, danebenzuschlagen, sonst geht es ihnen an den Kragen.
Sie müssen mich einfach erwischen, begreift er.
Sie müssen mich töten.
Also trifft er seine Vorkehrungen. Als Erstes verteilt er die meisten seiner Handys an seine Leute, die sich in der Stadt und in der Provinz verteilen, mit der Anweisung, sie zu benutzen und dann zu entsorgen. (Und natürlich laufen bei Ramos Meldungen ein, Adán Barrera halte sich in Hipódromo auf, in Chapultepec, Rosarito, Ensenada, Tecate, sogar jenseits der Grenze in San Diego, Chula Vista, Otay Mesa.)
Raúl geht los, kauft neue Handys und ruft Polizisten an, die auf der Gehaltsliste stehen - Bundespolizei, Provinzpolizei, städtische Polizei.
Das Ergebnis ist niederschmetternd. Die Provinz- und Lokalpolizisten wissen von nichts, niemand hat sie informiert, sie können nur bestätigen, dass die Sache von der Bundespolizei ausgeht, dass sie nichts damit zu tun haben. Und die lokale Bundespolizei?
»Die machen sich rar«, sagt Raúl.
Sie sind schon wieder umgezogen, haben den Schlupfwinkel im Rio-Viertel verlassen - zehn Minuten bevor er gestürmt wurde. Jetzt hocken sie in einer Wohnung in Colonia Cacho und hoffen, wenigstens ein paar Stunden Ruhe zu haben, um rauszukriegen, was da läuft. Aber die lokale Bundespolizei ist ihnen keine Hilfe.
»Die nehmen einfach nicht ab«, sagt Raúl. »Ruf sie zu Hause an«, schlägt Adán vor. »Da gehen sie auch nicht ran.«
Adán greift sich ein neues Handy und wählt eine Nummer in Mexico City.
Niemand zu erreichen. Ihre Kontakte bei der Regierungspartei sind leider nicht zu sprechen - aber wenn Sie ihre Telefonnummer hinterlassen, rufen wir gern zurück...
Das Waffengeschäft, denkt Adán. Dieser verfluchte Keller hat den Waffendeal mit der FARC benutzt, um die mexikanische Regierung zum Handeln zu zwingen. Jetzt würde er am liebsten kotzen. Nur vier Leute haben von dem Deal mit Tirofio gewusst - ich, Raúl, Fabián und ...
Und Nora.
Nora ist verschwunden.
Sie hat die Stadtwohnung nicht betreten.
Aber die Polizei.
Vielleicht war sie vor mir da, denkt er, wurde bei der Razzia festgenommen und aus dem Verkehr gezogen.
Raúl besorgt sich ein Laptop und zwingt seinen bediensteten Computerfreak, ins Versteck zu kommen und verschlüsselte E-Mails an das Computernetzwerk des Kartells zu verschicken. Die Verschlüsselung hat der Freak selbst zurechtgebastelt - für eine sechsstellige Summe, und sie ist so komplex, dass selbst die DEA nicht geschafft hat, sie zu knacken. So weit sind wir nun gekommen, denkt Adán, dass wir elektronische Botschaften ins Nichts schicken. Sie sitzen im Versteck und halten Ausschau nach den Panzerwagen, während sie auf Antworten warten. Nach einer Stunde hat Raúl mehrere Sicarios zusammengetrommelt und ein paar neutrale Autos beschafft. Auch ein paar Beobachter hat er postiert, die ihn über die Polizeiaktionen auf dem Laufenden halten sollen.
Bei Sonnenuntergang steigen Adán und Raúl, verkleidet als Monteure, in einen 83er Dodge Dart, vorn sitzen zwei schwerbewaffnete Sicarios. Sie schlängeln sich im Auto durch das gefährlich gewordene Straßenlabyrinth von Tijuana und lassen sich von den Beobachtungsposten per Handy aus der Stadt lotsen.
Als sie es bis Rancho las Bardas geschafft haben, verschnaufen sie erst einmal und versuchen, die Lage zu peilen.
Ramos hilft ihnen dabei.
Als die Barreras die Abendnachrichten einschalten, sehen sie ihn auf einer Pressekonferenz. Er verspricht, das Baja-Kartell binnen zwei Wochen zu zerschlagen.
»Das erklärt, warum uns keiner gewarnt hat«, sagt Adán.
»Das erklärt es zum Teil«, erwidert Raúl. Ramos kennt praktisch schon das Netzwerk des Kartells, die Lage von Depots und Schlupfwinkeln, die Namen von Mitgliedern. Woher nimmt er sein Wissen?
»Das hat er von Fabian«, sagt Adán. »Er plaudert alles aus.« Raúl schüttelt den Kopf. »Nein, nicht von Fabián. Von deiner geliebten Nora.«
»Das glaube ich nicht«, sagt Adán.
»Du willst es nicht glauben«, sagt Raúl und erzählt ihm vom Positionsmelder im Toyota Camry.
»Der könnte auch von Fabián sein«, sagt Adán.
»Die Polizei hatte euer Liebesnest schon umstellt«, brüllt Raúl. »Hat Fabián das auch gekannt? Wer wusste von dem Waffendeal? Du, ich, Fabián, Nora. Ich war's nicht, du auch nicht, Fabián haben die Yankees geschnappt - also?«
»Wir wissen nicht mal, wo sie steckt«, sagt Adán, doch jetzt kommt ihm ein schrecklicher Verdacht. Er blickt zu Raúl auf, der am Fenster steht und durch das Rollo lugt. »Raul, hast du ihr was angetan?«
Raúl antwortet nicht.
Adán springt auf. »Raul, hast du ihr was angetan?« Er packt Raúl am Hemd. Raúl befreit sich mühelos und stößt ihn aufs Bett. »Und was wäre, wenn?«
»Ich will sie sehen.«
»Ich glaube, das ist keine gute Idee.«
»Spielst du jetzt den Boss?«
»Wegen dieser Schlampe hast du uns alles vermasselt.« Mit anderen Worten: Ja, Bruder, ich bin der Boss - bis du zur Vernunft kommst.
»Ich will sie sehen!«
»Ich lasse nicht zu, dass du so wirst wie Tio.«
Die Weiber, denkt Raúl, die große Schwäche der Barreras.
Dass es so weit gekommen ist, liegt nur daran, dass Tío so verrückt auf diese jungen Schlampen war, erst Pilar, dann die andere, deren Namen ich schon vergessen habe. Miguel Ángel Barrera - Mi, der Mann, der die Federación aufgebaut hat, der härteste, kaltblütigste, raffinierteste Taktiker, den ich kenne, doch leider schaltet sich sein Gehirn ab, wenn ihm ein knackiger Arsch vor die Flinte kommt.
Und Adán hat diese Krankheit geerbt. Verdammt, er konnte jede beliebige Fotze kriegen, aber er musste unbedingt diese eine haben! Er hätte sie reihenweise vögeln können, solange er es heimlich machte und nicht seine Frau brüskierte. Aber nein, Adán versteift sich ausgerechnet auf diese Nutte und lässt sich überall mit ihr sehen.
Bietet Keller ein perfektes Ziel.
Nun haben wir den Salat.
Adán starrt zu Boden. »Lebt sie noch?«
Raúl antwortet nicht.
»Raul, sag mir, ob sie noch lebt.«
Ein Wachmann kommt hereingeplatzt.
»Weg!«, brüllt er, »Schnell weg!«
In der Menagerie herrscht Aufruhr, als Ramos und seine Leute über die Mauer kommen.
Ramos schultert den Granatwerfer, zielt und drückt ab. Ein greller Blitzstrahl, und der nächststehende Wachturm explodiert. Er setzt ein neues Geschoss ein, wieder ein Blitz. Dann sieht er die zwei Hirsche, die in Panik gegen den Zaun ihres Geheges anrennen. Er öffnet das Gatter, und die beiden Tiere fliehen hinaus in die Nacht.
Vögel kreischen, aus den Affenkäfigen dringt irres Schnattern, auch Löwen soll es hier geben, denkt Ramos, da hört er schon ihr bedrohliches Knurren, das er nur aus Filmen kennt, und vergisst es gleich wieder, weil jetzt das Abwehrfeuer einsetzt.
Sie sind bei Dunkelheit mit dem Flugzeug gekommen, es war eine riskante Landung ohne Licht, auf einer alten Schmugglerpiste, dann folgte ein Marsch durch die Wüste und ein behutsames Heranpirschen auf den letzten tausend Metern, wo die Jeeps der Wachmänner ihre Runden drehten.
Aber wir sind drin, denkt Ramos, presst den vertrauten Kolben seiner Uzi an die Wange, feuert ein paar Schüsse ab, springt auf und bewegt sich nach vorn, im Vertrauen darauf, dass ihm seine Männer Feuerschutz geben. Er wirft sich flach zu Boden und gibt den anderen Deckung, während sie mit der gleichen Sprungtechnik an ihm vorbeistürmen und sich auf das Haus der Barreras zubewegen.
Einer wird getroffen, er macht einen Satz wie eine Antilope und bricht zusammen. Ramos kriecht zu ihm hinüber, um ihm zu helfen, aber eine Gesichtshälfte des Mannes ist weggeschossen, da ist nichts mehr zu machen. Ramos nimmt ihm die Munition ab und rollt sich zur Seite, während Schüsse hinter ihm in den Boden einschlagen.
Das Feuer kommt vom Dach eines Flachbaus, Ramos rollt sich weiter, schaltet dabei auf Dauerfeuer um, richtet sich kurz auf und schickt eine Salve quer über das Dach, bekommt im selben Moment zwei harte Schläge gegen die Brust - seine Schussweste hat ihn mal wieder gerettet -, er zieht eine Handgranate vom Gürtel ab und wirft sie aufs Dach.
Ein dumpfer Knall, ein Blitz und zwei Gestalten, die hochgeschleudert werden, dann hört das Feuer dort auf.
Aber nicht die Schüsse aus dem Haus.
Verräterische rote Mündungsblitze aus Fenstern, Türöffnungen, Dachluken. Ramos behält die Türen im Auge, offensichtlich haben sich mehrere Wachmänner im Haus verschanzt, die hinauswollen, um von der Flanke anzugreifen. Einer feuert aus der Tür und läuft los, doch zwei Schüsse von Ramos treffen ihn in den Bauch, er taumelt, stürzt und fängt an zu brüllen. Ein weiterer kommt nach und will ihn ins Haus zurückziehen, wird aber ebenfalls mehrfach getroffen und bleibt zusammengekrümmt zu Füßen seines Kumpanen liegen.
»Zerschießt die Autos!«, brüllt Ramos.
Die stehen überall - Landrover, die bei den Narcos so beliebten Suburbans, auch ein paar Mercedes-Limousinen. Ramos will verhindern, dass die Barreras flüchten, und nach einem kurzen, aber dichten Kugelhagel sind die Autos lahmgelegt. Platte Reifen, zersplittertes Glas, ein explodierter Benzintank, mehrere Autos gehen in Flammen auf.
Dann bricht die Hölle los.
Jemand hat sich eine besonders raffinierte Ablenkungstaktik einfallen lassen und sämtliche Käfige geöffnet - nun wimmelt es von Tieren, die wild durcheinanderrennen, in Panik versetzt durch den Lärm, das Feuer und die Schießerei. Ramos blinzelt ungläubig, als ihm eine Giraffe in die Schusslinie läuft, dann zwei Zebras, während Antilopen hakenschlagend mit hohen Sprüngen quer über den Hof jagen. Ramos muss an die Löwen denken - eine äußerst dumme Art zu sterben, sagt er sich und will zum Haus, muss aber sofort den Kopf einziehen, weil ein großer Raubvogel über ihn hinwegstreicht. Just in dem Moment gehen die Narcos zum Angriff über, kommen aus dem Haus und schießen wild um sich.
Huschende Gestalten im silbrigen Mondlicht, Mensch und Tier kaum zu unterscheiden, Männer, die rennen, schießen, stürzen, Deckung suchen. Alles ein wüster Traum, könnte man denken, aber die Kugeln sind echt und auch das Sterben, Ramos schießt um sich, muss sich an einem Wildesel vorbeidrücken, der ihm im Weg steht und schreit. Ein Narco kommt von rechts, ein anderer von links, nein, das ist einer von seinen Leuten. Kugeln schwirren, Mündungsfeuer blitzen, Menschen und Tiere brüllen durcheinander. Zwei Schüsse, und er hat den Narco außer Gefecht gesetzt, dann erkennt er - oder glaubt zu erkennen - die lange Gestalt von Raúl, der aus der Hüfte schießend vorüberrennt und schon verschwunden ist, bevor Ramos ihn erwischen kann. Er rennt ihm nach und taucht sofort ab, als ihn ein Narco ins Visier nimmt, und erwischt ihn mit einem Schuss über die Schulter, der Mann taumelt zurück, schlägt lang hin, eine Staubwolke steigt auf, im Mondlicht gut zu sehen.
Die Barreras aber sind weg.
Als die Schießerei verebbt ist, schaut sich Ramos die Toten, Verwundeten, die Festgenommenen an - Fehlanzeige.
Rancho las Bardas ist ein Trümmerhaufen. Das Hauptgebäude zerschossen wie ein Sieb. Brennende Autos, auf den Ästen hocken seltene Vögel, manche Tiere sind tatsächlich zurück in ihre Käfige geflohen und drücken sich winselnd in die Ecken.
In der Nähe des Zauns, inmitten weißer, blutbespritzter Mohnblüten, sieht Ramos eine lange Gestalt liegen. Seine Uzi im Anschlag, dreht er den Mann mit dem Fuß auf den Rücken. Es ist nicht Raúl, und Ramos ist wütend. Wir wissen, dass er hier war, wir haben ihn gehört, sagt er sich. Ich hab ihn gesehen. Oder nicht? Vielleicht sollten uns die abgehörten Handys in die Irre führen, und sie sitzen in Costa Rica oder Honduras in der Strandbar, trinken ein gut gekühltes Bier und lachen uns aus.
Dann entdeckt er etwas.
Eine Falltür, bedeckt mit Erde und ein bisschen Gestrüpp, aber er erkennt den quadratischen Umriss, bei näherem Hinsehen auch Fußabdrücke.
Ihr könnt fliehen, sagt er sich, aber ihr könnt euch nicht in Luft auflösen.
Ein Tunnel. Sehr gut.
Er besieht die Falltür aus der Nähe, sie muss gerade benutzt worden sein, ein wenig Erde rieselt noch durch eine Ritze. Er schiebt das Gestrüpp beiseite und tastet nach einem Handgriff, hebt die Klappe an.
Er hört ein winziges Klicken, dann sieht er die Sprengladung.
Aber es ist zu spät.
Die Explosion reißt ihn in Stücke.
Die lastende Stille ist zur Totenstille geworden.
Keller hat alles Erdenkliche versucht, Nora zu finden. Und obwohl er sich hartnäckig weigert, seine Quelle zu nennen, hat ihm Hobbs moderne Fahndungsmittel zur Verfügung gestellt. Er nutzt Satellitenbilder, Abhörtechnik, Internetüberwachung. Doch es hilft alles nichts.
Seine Möglichkeiten sind begrenzt. Er kann nicht offen nach ihr fahnden, das würde ihre Tarnung auffliegen lassen und sie töten - wenn sie nicht schon tot ist. Und jetzt fehlt ihm auch Ramos mit seinen brachialen Kampfeinsätzen.
»Es sieht nicht gut aus, Boss«, sagt Shag.
»Wann kommen die neuen Satellitenbilder?«
»In fünfundvierzig Minuten.«
Wenn es das Wetter erlaubt, bekommen sie Bilder von Rancho las Bardas, dem Schlupfwinkel der Barreras in der Wüste. Die letzten fünf Lieferungen haben nichts erbracht. Ein paar Bedienstete, aber niemand, der aussieht wie die Barreras oder Nora.
Und auch keine Zeichen von Betriebsamkeit. Weder neue Autos noch frische Reifenspuren, kein Kommen und Gehen. Das gleiche Bild bei den anderen Stützpunkten und Verstecken der Barreras, die Ramos noch nicht ausgeräuchert hatte. Keine Bewohner, kein Handyverkehr.
Mein Gott, denkt Keller, irgendwann muss denen doch die Puste ausgehen. So wie uns.
»Gib mir Bescheid«, sagt er zu Shag. Er muss zu einem Treffen mit Mexikos neuem Drogenbeauftragten, General Augusto Rebollo.
Angeblich will ihn Rebollo im Rahmen der neubelebten bilateralen Zusammenarbeit über die Maßnahmen zur Ergreifung der Barreras informieren. Das Problem ist nur, dass er nicht viel mitzuteilen hat. Ramos hat weitgehend auf eigene Faust gehandelt, und eigentlich kann Rebollo nur im Fernsehen agieren, mit finster-entschlossenem Blick, und sich voll und ganz hinter das Vorgehen des tödlich verunglückten Ramos stellen, ohne überhaupt zu wissen, worin es bestand.
Aber auch diese Entschlossenheit wankt.
Mexiko City wird von Tag zu Tag nervöser, weil die Barreras noch immer auf freiem Fuß sind. Je länger dieser Krieg dauert, umso nervöser werden sie, und John Hobbs versucht Keller schonend beizubringen, dass die Mexikaner jetzt vor allem »Gründe zum Optimismus« brauchen.
Rebollo, der in seiner gebügelten grünen Armeeuniform aussieht wie aus dem Ei gepellt, beschwört Keller mit zuckersüßer Stimme, er solle sein offenkundiges Insiderwissen über das Barrera-Kartell preisgeben und seine Quelle nennen, denn dann könne auch die mexikanische Seite ihren Krieg gegen die Drogen sehr viel effizienter gestalten.
Er lächelt Keller an.
Auch Hobbs lächelt Keller an.
Alle im Raum versammelten Bürokraten lächeln ihn an. »Nein«, sagt Keller.
Durch das Panoramafenster hat er einen guten Ausblick auf Tijuana. Irgendwo da drüben muss sie sein. Rebollo hört auf zu lächeln und ist beleidigt. »Arthur -«, mahnt Hobbs. »Nein.«
Sollen sie sich ein bisschen mehr anstrengen.
Die Sitzung endet in Missstimmung, und Keller kehrt zurück in seine Einsatzzentrale. Die neuen Satellitenbilder von Rancho las Bardas müssten gekommen sein.
»Und?«, fragt er Shag.
Shag schüttelt den Kopf.
»Mist!«
»Die haben sich in Luft aufgelöst«, sagt Shag. »Kein Telefonverkehr, keine E-Mails, nichts.«
Shags Cowboygesicht ist verwittert und faltig, er trägt jetzt eine Gleitsichtbrille. Gott, bin ich auch so alt geworden?, fragt sich Keller. Zwei alte Kämpfer im Drogenkrieg. Wie nennen uns wohl die Jungen? Narco-Fossile? Und Shag ist älter als ich, geht stramm auf die Rente zu.
»Er wird seine Tochter anrufen«, sagt Keller plötzlich.
»Was?«
»Gloria, seine Tochter. Seine Frau wohnt mit ihr in San Diego.«
Shag windet sich. Sie wissen beide, dass es gegen das ungeschriebene Gesetz des Drogenkriegs verstößt, unbeteiligte Familienangehörige hineinzuziehen.
Keller kennt Shags Bedenken.
»Scheiß drauf«, sagt er. »Lucia Barrera weiß, was ihr Mann treibt. Sie ist kein Unschuldslamm.«
»Aber das Mädchen.«
»Ernie Hidalgos Kinder wohnen auch in San Diego«, erwidert Keller. »Sie kriegen ihren Daddy nie zu sehen. Also, lass sie abhören.«
»Boss, kein Richter wird das -«
Kellers Blick bringt ihn zum Schweigen.
Auch Raúl Barrera ist unzufrieden.
Sie zahlen Rebollo jeden Monat dreihunderttausend Dollar, und für dieses Geld sollte man mehr von ihm erwarten dürfen.
Aber er hat nicht verhindert, dass Rancho las Bardas von Ramos und seinen Leuten überfallen wurde, und kann nicht bestätigen, dass Nora Hayden die Verräterin ist, und Raúl will es endlich wissen. Er hält seinen eigenen Bruder wie einen Gefangenen, und wenn sich seine Geliebte als unschuldig erweist, ist die Hölle los.
Als Raúl Nachricht von Rebollo bekommt - leider keine neuen Erkenntnisse -, antwortet er knapp, aber entschieden, Rebollo möge sich mehr anstrengen. Denn wenn du nicht spurst, können wir auch durchblicken lassen, dass du auf unserer Gehaltsliste stehst. Und du gehst in den Knast.
Rebollo versteht die Botschaft.
Fabián Martínez tuschelt mit seinem Anwalt und kommt direkt zur Sache.
Er kennt die Gepflogenheiten in Drogenverfahren. Das Kartell schickt einen Anwalt, und man erzählt ihm, welches Wissen man im Verhör preisgegeben hat. Auf diese Weise kann meist Schlimmeres verhütet werden. »Ich hab nicht gesungen«, sagt Martínez.
Der Anwalt nickt.
»Aber die haben einen Informanten«, sagt Fabián und senkt die Stimme zu einem Flüstern. »Und zwar Nora, Adáns Schlampe.«
»Heiliger! Sind Sie sicher?«
»Es kann nur sie gewesen sein«, sagt er. »Bieten Sie eine Kaution, aber schnellstens. Sonst werde ich hier noch verrückt.«
»Bei illegalem Waffenhandel wird das schwierig, fürchte ich.«
»Vergessen Sie den Waffenhandel.« Er steht unter Mordanklage, gesteht er dem Anwalt.
Verfahrene Kiste, denkt der. Wenn Martínez keinen richtig guten Deal hinkriegt, kann er sich auf eine lange Haftstrafe gefasst machen.
Sie ist keine Gefangene, und sie ist nicht frei.
Nora weiß nicht genau, wo sie sich befindet, nur dass es irgendwo an der Ostküste der Baja-Halbinsel sein muss.
Ihre Hütte besteht aus denselben roten Felssteinen wie die Umgebung, hat ein Dach aus Palmzweigen und massive Holztüren. Keine Klimaanlage, doch die dicken Mauern sorgen für Kühle. Neben dem großen Zimmer mit Kochecke, das aufs Meer blickt, gibt es noch ein kleines Schlafzimmer und ein Bad.
Für Strom sorgt der ratternde Dieselgenerator hinterm Haus. Sie hat also Licht, fließend warmes Wasser und ein Spülklosett. Sie kann heiß duschen, auch baden. Sogar eine Satellitenschüssel ist vorhanden, aber der Fernseher fehlt ebenso wie ein Radio. Alle Uhren wurden entfernt, sogar die Armbanduhr hat man ihr weggenommen.
Einen kleinen CD-Player gibt es, aber keine CDs.
Sie wollen, dass ich mit mir allein bin, denkt sie.
In einer Welt ohne Zeit.
Und sie weiß wirklich nicht, wie viele Tage es her ist, seit Raúl sie aus der Stadtwohnung geholt und ins Auto verfrachtet hat, wo er ihr erzählte, dass die Hölle losgebrochen sei und er sie zu Adán bringen werde. Sie traute ihm nicht, aber hatte keine Wahl, und er entschuldigte sich gar, als er ihr erklärte, er müsse ihr zu ihrer eigenen Sicherheit die Augen verbinden.
Sie weiß nur, dass sie Tijuana in südlicher Richtung verließen, ziemlich lange auf der glatten Straße nach Ensenada blieben. Danach wurden die Straßen holpriger, sie spürte, dass es bergauf ging, mit VierrAdántrieb über felsigen Grund, und schließlich roch sie den Ozean. Als ihr die Augenbinde abgenommen wurde, war es schon dunkel.
»Wo ist Adán?«, fragte sie Raúl.
»Er kommt.«
»Wann?«
»Bald. Ruh dich aus. Schlaf ein bisschen. Du hast eine Menge durchgemacht.« Er gab ihr eine Schlaftablette. Eine Tuinol.
»Die brauche ich nicht.«
»Doch. Nimm sie. Du brauchst Schlaf.«
Er blieb neben ihr stehen, bis sie die Tablette geschluckt hatte. Sie schlief wie ein Stein und wachte erst am Morgen auf, mit dumpfem Kopf und pelziger Zunge. Sie vermutete sich an der Küste irgendwo südlich von Ensenada, doch dann ging die Sonne auf der falschen Seite auf, und sie begriff, dass sie sich an der Ostküste der Halbinsel befand. Und bei Tageslicht erkannte sie das hellgrüne Wasser des Golfs von Kalifornien.
Aus dem Schlafzimmerfenster sah sie größere Häuser weiter oben am Hang, die ganze Küste sah aus wie eine rote Mondlandschaft. Wenig später kam eine junge Frau von einem der Häuser herunter und brachte ihr Frühstück - Kaffee, Grapefruit und ein paar warme Tortillas.
Und einen Löffel.
Kein Messer, keine Gabel.
Ein Glas Wasser mit einer weiteren Tuinol.
Sie sträubte sich, bis ihre Nerven nicht mehr mitspielten, dann schluckte sie die Tablette und fühlte sich umgehend besser. Den Vormittag verschlief sie und wachte erst auf, als die Frau das Mittagessen brachte - frisch gegrillter Thunfisch, gedünstetes Gemüse, Tortillas.
Und Tuinol.
Mitten in der Nacht wurde sie geweckt und einem Verhör unterzogen.
Der Mann, der sie befragte, höflich und beharrlich, war klein und hatte einen Akzent, der nicht mexikanisch klang.
Was geschah in der Nacht, als Sie das Geld überbrachten?
Wohin sind Sie gefahren? Wen haben Sie gesehen? Mit wem haben Sie gesprochen?
Ihre Fahrten nach San Diego: Was haben Sie dort gemacht? Was haben Sie gekauft? Wen haben Sie getroffen?
Kennen Sie einen Arthur Keller? Sagt Ihnen der Name etwas?
Waren Sie jemals wegen Prostitution in Haft? Wegen Drogendelikten? Steuerhinterziehung? Doch auch sie hatte Fragen. Wovon reden Sie? Warum fragen Sie mich das alles? Wer sind Sie überhaupt? Wo ist Adán?
Weiß er, dass Sie mich belästigen? Kann ich jetzt weiterschlafen?
Sie ließen sie weiterschlafen, weckten sie fünfzehn Minuten später und redeten ihr ein, es sei die nächste Nacht. Sie tat, als würde sie ihnen glauben, und sie musste sich dieselben Fragen anhören, wieder und wieder, bis sie es satt hatte.
Ich will weiterschlafen.
Wo ist Adán? Ich will ihn sehen.
Ich will eine Tuinol.
Bald, versprach der Mann und wechselte die Taktik. Erzählen Sie mir, was an dem Tag der Geldübergabe passiert ist. Jede Minute. Sie sind ins Auto gestiegen und... Und, und, und...
Sie kroch zurück ins Bett, presste das Kissen auf die Ohren und sagte, er solle weggehen, sie sei müde. Er bot ihr eine Tablette an, und sie nahm sie.
Sie schlief vierundzwanzig Stunden, dann fingen sie von vorn an.
Fragen, Fragen, Fragen.
Erzählen Sie mir hiervon, erzählen Sie mir davon. Art Keller, Shag Wallace, Art Keller.
Erzählen Sie mir, wie Sie den Chinesen erschossen haben. Was war vorgefallen? Wie haben Sie sich gefühlt? Wo haben Sie die Pistole angefasst? Am Lauf oder am Griff?
Erzählen Sie mir von Keller. Wie lange kennen Sie ihn? Hat er sich an Sie gewandt oder Sie sich an ihn?
Ihre Antwort: Wovon reden Sie überhaupt?
Denn sie wusste: Eine einzige Antwort, und sie verirrt sich im Nebel aus Barbituraten, Müdigkeit, Angst, Verwirrung, Desorientierung. Sie begriff, was sie mit ihr vorhatten, aber sie konnte sich nicht wehren.
Der Mann berührte sie kein einziges Mal, und er drohte ihr nicht.
Darauf beruhte ihre Hoffnung, denn das bedeutete, dass sie nichts Genaues wussten. Wären sie sich sicher gewesen, hätten sie zur Folter gegriffen, um ihr Informationen abzupressen, oder sie einfach getötet. Das »weiche« Verhör bedeutete, dass sie ihre Zweifel hatten, und es bedeutete noch etwas anderes - dass Adán zu ihr hielt. Sie tun mir nichts, kalkulierte sie, weil sie immer noch Adán zu fürchten haben. Also blieb sie fest. Gab ausweichende, konfuse Antworten, leugnete schlicht oder reagierte mit gereizten Gegenfragen.
Aber die Sache zerrte an ihren Nerven, brachte sie an den Rand des Irrsinns. .
Eines Morgens blieb das Frühstück aus - sie fragte danach, und die Frau behauptete verdutzt, sie hätte es gebracht. Aber das stimmt nicht, ich weiß es - oder doch? Dann gab es zweimal Mittagessen, direkt hintereinander, dann wieder Schlaf und wieder Tuinol.
Jetzt läuft sie draußen herum. Die Türen sind nicht verschlossen, niemand hält sie auf. Vor ihr liegt das Meer, hinter ihr die Wüste. Wenn sie zu Fuß flieht, verdurstet oder erfriert sie.
Sie geht hinunter ans Meer und planscht mit den Füßen im Wasser.
Das Wasser ist warm und fühlt sich gut an. Die Sonne geht hinter ihr unter.
Adán steht am Fenster seines Zimmers in dem großen Haus weiter oben und beobachtet sie.
Er ist in seinem Zimmer gefangen, rund um die Uhr bewacht von Sicarios, die Raúl unterstellt sind. Sie stehen vor seiner Tür, bis die Ablösung kommt, und Adán schätzt, dass es mindestens zwanzig Leute sind, die ihn bewachen.
Er steht am Fenster und sieht sie im Wasser waten. Sie trägt ein helles Leinenkleid und einen breitkrempigen Hut, um sich vor der Sonne zu schützen. Ihr loses Haar bedeckt die bloßen Schultern.
Warst du's?
Hast du mich verraten?
Nein, sagt er sich. Diesen Gedanken könnte ich nicht ertragen.
Raúl ist von ihrem Verrat überzeugt, obwohl die Verhöre nichts bringen. Es sind sanfte Verhöre, hat Raúl ihm versichert, ihr wird kein Haar gekrümmt, geschweige denn weh getan.
Darauf hat Adán bestanden. Eine Schramme, ein Schmerzensschrei, und ich bringe dich um, auf die eine oder andere Art, ob du nun mein Bruder bist oder nicht.
Und wenn sie es war?, hat Raúl gefragt.
Dann, denkt Adán, während sie sich am Ufer auf einen Stein setzt, dann ist es etwas anderes.
Etwas ganz anderes.
Er hat sich mit Raúl geeinigt. Wenn sie keine Verräterin ist, setzt Raul ihn wieder in seine Rolle als patrón ein. So ist es verabredet. Aber die Erfahrung sagt ihm, dass keiner, der die Macht hat, sie zurückgibt.
Nicht freiwillig jedenfalls.
Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, denkt er. Soll sich Raúl ums Geschäft kümmern, er lässt sich auszahlen und setzt sich mit Nora zur Ruhe. Sie wollte doch immer nach Paris. Warum nicht?
Und die andere Seite der Abmachung? Stellt sich heraus, dass Nora eine Verräterin ist, aus welchen Gründen auch immer, dann bleibt Raúl der Boss, und Nora ...
Daran will er nicht mal denken.
Das Beispiel Pilar Talavera steht ihm lebhaft vor Augen.
Wenn es so weit kommt, erledige ich das selbst, sagt er sich. Komisch, dass man eine Frau auch dann noch liebt, wenn sie einen verrät. Ich gehe mit ihr hinunter ans Ufer, warte mit ihr, bis die letzten Sonnenstrahlen verblassen.
Und dann: kurz und schmerzlos.
Wenn Gloria nicht wäre, würde ich ihr in den Tod folgen.
Kinder fesseln uns ans Leben, nicht wahr?
Besonders dieses Kind, so zerbrechlich und hilfsbedürftig.
Und sie muss sich fürchterliche Sorgen machen, denkt er. Die Zeitungen von San Diego sind sicher voll von den Vorgängen in Tijuana, und selbst wenn Lucia diese Nachrichten von ihr fernhält, wird sich Gloria ängstigen, bis sie von mir hört.
Er schaut noch eine Weile zu Nora hinunter, dann löst er sich vom Fenster und klopft an die Tür.
Der Wachmann öffnet ihm.
»Bring mir ein Handy«, sagt Adán. »Raul hat gesagt -«
»Mich interessiert nicht, was Raúl gesagt hat«, fährt er ihn an. »Ich bin immer noch el patrón, und wenn ich dir sage, du sollst mir ein Handy bringen, dann bringst du mir ein Handy.«
Der Wachmann gehorcht.
»Boss?«
»Ja?«
»Es tut sich was.«
Shag reicht ihm den Kopfhörer, und er hört die Stimme von Lucía Barrera. Adán?
Wie geht's Gloria? Sie macht sich Sorgen. Ich will mit ihr reden. Wo bist du?
Kann ich mit ihr reden?
Eine lange Pause, dann Glorias Stimme.
Papa?
Wir geht's dir, meine Kleine?
Ich hab Angst um dich.
Mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen.
Keller hört das Mädchen weinen.
Wo bist du? In der Zeitung stand -
Die Zeitungen lügen. Mir geht's gut.
Kann ich dich besuchen?
Jetzt noch nicht, aber bald. Hör zu, mein Kleines, sag Mama, sie soll dir einen dicken Kuss von mir geben. Okay? Okay.
Mach's gut, Kleines. Ich hab dich lieb.
Ich hab dich lieb, Papa.
Keller sieht Shag an.
»Es wird ein Weilchen dauern, Boss.«
Es dauert sechzig Minuten, bis die Daten von der NSA analysiert sind, aber es sind gefühlte fünf Stunden. Dann kommt der Bericht. Der Anruf stammt von einem Handy (das wussten wir schon, denkt Keller), daher konnten sie keine Adresse ermitteln, nur die nächstgelegene Basisstation. San Felipe.
An der Ostküste der Baja-Halbinsel, ein wenig südlich von Mexicali.
Ein Radius von sechzig Meilen.
Keller hat die Karte schon ausgebreitet. San Felipe ist eine Kleinstadt mit vielleicht zwanzigtausend Einwohnern, dazu kommen viele amerikanische Winterflüchtlinge. Außer der Stadt gibt es dort nicht viel, nur Wüste und ein paar Fischercamps nach Norden und nach Süden. Auch bei einem begrenzten Radius ist das die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen, und Adán kann ein Stück gefahren sein, um in den Bereich des Funknetzes zu gelangen, und ist gerade dabei, sich wieder zu entfernen.
Aber immerhin können wir die Suche eingrenzen, denkt Keller.
Wenigstens eine Hoffnung.
»Der Anruf kam nicht aus der Stadt«, sagt Wallace.
»Woher weißt du das?«
»Hör dir das Band noch mal an.«
Sie lassen es zurücklaufen, und jetzt hört Keller ein rhythmisches Brummen im Hintergrund. Fragend schaut er Wallace an.
»Du bist eine Stadtratte, nicht wahr?«, sagt Wallace. »Ich bin auf der Farm groß geworden. Was du da hörst, ist ein Dieselgenerator. Es gibt dort kein Stromnetz.«
Keller bestellt Satellitenfotos. Aber es ist Nacht, und bis die Bilder kommen, wird es Stunden dauern.
Der Verhörspezialist drückt aufs Tempo.
Er reißt Nora aus dem tiefen Tuinol-Schlummer, setzt sie auf einen Stuhl und hält ihr den Positionsmelder unter die Nase.
»Was ist das?«
»Keine Ahnung.«
»Doch«, beharrt er. »Sie haben das eigenhändig an der Kopfstütze befestigt.«
»Was hab ich wo? Wie spät? Ich will schlafen ...«
Er schüttelt sie. Es ist das erste Mal, dass er sie berührt. Und das erste Mal, dass er brüllt. »Hören Sie, bis jetzt war ich sehr nett zu Ihnen, aber, langsam reißt mir der Geduldsfaden. Wenn Sie nicht kooperieren, muss ich Gewalt anwenden! Und zwar massive. Und jetzt sagen Sie mir, wer Ihnen befohlen hat, den Positionsmelder zu installieren.«
Sie starrt das Ding an, lange, als käme es aus einer anderen Welt. Nimmt es zwischen Daumen und Zeigefinger, dreht es hin und her, hält es ins Licht und beäugt es von allen Seiten. Dann gibt sie es zurück. »Das hab ich noch nie gesehen.«
Jetzt brüllt er ihr ins Gesicht, aus nächster Nähe. Sie versteht nicht mal, was er sagt, so laut brüllt er, sie kriegt seine Spucke ab, er packt sie bei den Schultern und schüttelt sie, und als er endlich loslässt, sackt sie erschöpft zusammen.
»Ich bin so müde«, sagt sie.
»Ich weiß«, erwidert er, nun wieder ganz Mitgefühl. »Wir können es ganz schnell hinter uns bringen.«
»Dann darf ich schlafen?«
»Aber ja.«
Keller sitzt übernächtigt, mit brennenden Augen da, als die Fotos auf dem Bildschirm erscheinen. Er weckt Wallace, der in seinem zurückgeklappten Bürostuhl schläft, die Stiefel auf dem Schreibtisch.
Gemeinsam brüten sie über den Satellitenbildern. Beginnen mit dem Großraum San Felipe, zoomen sich näher heran an den Küstenstreifen nördlich und südlich der Stadt. Die Wüstengebiete landeinwärts können sie vernachlässigen. Keine Wasserversorgung, kaum passierbare Straßen, und die wenigen Pisten, die sich durch die felsige Landschaft schlängeln, bieten keine Ausweichmöglichkeiten - die Barreras würden sich bestimmt nicht freiwillig in eine solche Falle begeben.
Also bleibt die östliche Küstenlinie am Fuß der flachen Bergkette und längs der Landstraße, von der aus Stichstraßen zu kleinen Fischercamps und Strandsiedlungen führen.
Die Küste nördlich von San Felipe ist beliebt bei Geländefahrern, Campern, Anglern und Touristen, kommt also kaum als Versteck in Frage. Ein ähnliches Bild südlich der Stadt, doch dann wird die Landstraße deutlich schlechter, und die Besiedlung dünnt sich aus - bis zum Fischerdörfchen Puertocitos. Dazwischen liegt ein etwa zehn Kilometer langer Streifen ohne Campingplätze, nur hier und da ein einsames Haus. Barreras Handysignal hatte die Stärke von 4800 bps, passend zur Netzstärke in diesem Bereich, also nehmen sie sich diesen Küstenstrich vor.
Ein perfektes Versteck, denkt Keller. Nur wenige Zufahrtsstraßen - eher für Geländewagen geeignet -, und die Barreras haben mit Sicherheit Aufpasser an diesen Straßen postiert, auch in San Felipe und Puertocitos, die jedes Fahrzeug registrieren, ganz zu schweigen von dem gepanzerten Konvoi, der für einen Zugriff nötig wäre.
Aber das ist jetzt nicht das Thema. Bevor sie überlegen, wie sie die Barreras überwältigen, müssen sie ihr Versteck finden.
Ein Dutzend Häuser etwa gibt es an diesem einsamen Küstenabschnitt. Ein paar direkt am Strand, die Mehrzahl auf der flachen Anhöhe dahinter. Drei sind offenbar unbewohnt - weder Autos noch frische Fahrspuren. Es bleiben neun Häuser, die völlig normal aussehen, zumindest vom Satelliten aus, obwohl Keller schwer am Überlegen ist, auf welche Auffälligkeiten in diesem Fall zu achten ist. Fast alle stehen auf Grundstücken, die von Geröll und Agavendickicht befreit sind, haben Ziegel- oder Schilfdächer - fast alle.
Dann entdeckt er etwas Auffälliges.
Es ist beinahe nicht zu sehen, aber irgendetwas macht ihn stutzig.
»Zoom das mal näher heran«, sagt er zu Wallace.
»Was denn?«, fragt der, weil er nichts sieht'außer Gestein und Gestrüpp. Es gibt Schatten, die von Steinen und Pflanzen geworfen werden, aber dort ist ein Schatten, der eine gerade Linie bildet.
»Das ist ein Bauwerk«, sagt Keller.
Sie laden das Bild herunter und vergrößern es. Weitere Details sind schwer zu erkennen, doch es wird deutlich, dass es dort einen Höhenunterschied gibt.
»Ist das ein quadratischer Felsen?«, fragt Keller, »oder ein quadratisches Haus,mit Steindach?«
»Wer deckt denn ein Dach mit Steinen?«, fragt Wallace.
»Jemand, der es tarnen will«, sagt Keller.
Sie zoomen zurück zu einem größeren Ausschnitt und finden noch mehr schnurgerade verlaufende Schattenlinien. Nach einer Weile machen sie ein größeres und ein kleineres Gebäude aus, daneben noch einige kleine, unter denen sich Autos verbergen könnten.
Sie übertragen die Koordinaten auf die große Karte. Das Anwesen liegt abseits des Fahrwegs zur Küstenstraße, vierzig Kilometer südlich von San Felipe.
Fünf Stunden später kämpft sich ein Fischerboot aus Puertocitos bei starkem Gegenwind in Richtung Norden. Es ankert zweihundert Meter vor der Küste, wirft die Angeln aus und wartet auf die Dunkelheit. Dann legt sich einer der Fischer aufs Deck und richtet sein Infrarot-Teleskop auf den Strand im Bereich der zwei Steinhäuser.
Er sieht eine Frau mit weißem Kleid, die mit unsicheren Schritten zum Strand hinuntergeht.
Sie hat langes, blondes Haar.
Keller legt auf, lässt den Kopf in die Hände sinken und stößt einen tiefen Seufzer aus. Als er wieder aufblickt, strahlt er. »Wir haben sie.«
»Du meinst, wir haben ihn?«, fragt Wallace. »Bringen wir hier nichts durcheinander? Es geht doch um Barrera, oder?«
Fabián Martínez sitzt noch immer in der Zelle, aber seine Stimmung ist bedeutend besser.
Er hatte eine Unterredung mit seinem Anwalt, der ihn in allen Punkten beruhigen konnte. Wegen der Drogenvorwürfe habe er nichts zu befürchten - der als Zeuge benannte Regierungsvertreter werde nicht erscheinen und gewisse Leute seien über die Verräterin informiert worden.
Nur der Waffenschmuggel bleibt ein Problem, aber keins, das sich nicht lösen ließe.
»Wir versuchen, Sie nach Mexiko ausliefern zu lassen. Wegen der Mordsache Parada.«
»Wollen Sie mich verarschen?«
»Erstens«, sagte der Anwalt, »gibt es in Mexiko keine Todesstrafe. Zweitens dauert es Jahre, bis es zum Prozess kommt, und bis dahin...«
Er musste nicht weiterreden. Martínez verstand, was er meinte. Bis dahin kann man die Dinge regeln. Es ergeben sich strittige Punkte, Ankläger erlahmen in ihrem Eifer, Richter werden mit Ferienhäusern beglückt.
Martínez räkelt sich wohlig auf der Matratze und macht sich warme Gedanken. Fick dich, Keller! Ohne Nora hast du nichts in der Hand. Und fick dich, Nora! Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
Sie gönnen ihr keinen Schlaf.
Am Anfang sollte sie immer nur schlafen, und jetzt darf sie die Augen nicht mehr zumachen. Sie darf sich hinsetzen, aber wenn sie einschläft, wird sie bei den Armen gepackt und muss wieder aufstehen.
Alles tut ihr weh.
Füße, Beine, Rücken, Kopf.
Und die Augen, am schlimmsten die Augen.
Sie brennen wie Feuer, fühlen sich entzündet an. Nora würde alles drum geben, wenn sie sich hinlegen und die Augen schließen könnte. Oder sitzen oder stehen - aber die Augen schließen.
Sie lassen sie nicht.
Und sie geben ihr kein Tuinol mehr.
Sie will das Zeug nicht, sie braucht es.
Sonst wird sie das schreckliche Prickeln unter der Haut nicht mehr los, und ihre Hände hören nicht auf zu zittern. Dazu noch die hämmernden Kopfschmerzen und die Übelkeit und ...
»Nur eine«, jammert sie.
»Sie wollen was von uns, aber Sie wollen nichts geben«, sagt der Mann, der sie verhört. »Ich habe nichts zu geben.« Ihre Beine fühlen sich an wie Holz.
»Das werden wir sehen«, sagt der Mann und fängt von vorne an. Mit Arthur Keller, der DEA, dem Positionsmelder, ihren Fahrten nach San Diego ...
Sie wissen es doch, denkt Nora. Warum nicht sagen, was sie sowieso schon wissen? Sollen sie mit mir machen, was sie wollen, Hauptsache, ich darf schlafen. Adán kommt nicht, Keller kommt nicht, irgendwas muss ich ihnen sagen.
»Lassen Sie mich schlafen, wenn ich über San Diego spreche?«, fragt sie.
Der Mann nickt.
Er geht es mit ihr durch, Schritt für Schritt.
Endlich verlässt Shag Wallace das Büro.
Steigt in seinen fünf Jahre alten Buick und fährt zu einem Supermarkt-Parkplatz in National City. Dort bleibt er sitzen und wartet. Nach zwanzig Minuten biegt ein Lincoln Navigator auf den Parkplatz ein, dreht langsam ein paar Runden und parkt neben ihm ein.
Ein Mann steigt aus und setzt sich zu Wallace in den Buick.
Er legt den Aktenkoffer auf die Knie, klappt die Schlösser auf und dreht ihn so, dass Wallace die Geldbündel sieht.
»Sind die Polizeipensionen in Amerika besser als in Mexiko?«, fragt der Mann.
»Nicht sehr«, sagt Wallace.
»Dreihunderttausend Dollar«, sagt der Mann.
Wallace zögert.
»Nehmen Sie's«, sagt der Mann. »Damit helfen Sie nicht den Narcos, nur uns. Das ist eine Sache unter Polizisten. General Rebollo braucht die Informationen.«
Shag stößt einen langen Seufzer aus.
Dann erzählt er dem Mann, was er hören will.
»Wir brauchen einen Beweis«, sagt der Mann. Wallace zieht den Beweis aus der Tasche, übergibt ihn. Und nimmt die dreihunderttausend Dollar.
Der Wind über der Baja-Halbinsel hat sich gedreht, er kommt jetzt aus Süden und bläst warme Luft und dicke Wolken über die Cortes-See.
Keine Satellitenfotos. Die letzten, die Keller erhalten hat, sind achtzehn Stunden alt, und es kann viel passiert sein in diesen Stunden - die Barreras können geflohen sein, Nora kann tot sein. Die Wolken denken nicht daran, sich zu verziehen, und die Fotos werden immer älter.
Frischeres Material ist vorerst nicht zu erwarten, er muss daher schnell handeln - oder gar nicht.
Aber was tun?
Ramos, der einzige mexikanische Polizist, dem er trauen konnte, ist tot. General Rebollo steht auf der Gehaltsliste der Barreras, und die mexikanische Regierung rudert heftig zurück.
Keller hat nur eine Wahl, und die geht ihm gegen den Strich.
Er trifft sich mit John Hobbs auf Shelter Island, dem Jachthafen von San Diego. Es ist Nacht, sie laufen am Wasser entlang, durch die schmale Parkanlage, die zur Landspitze führt.
»Sie wissen, was Sie da von mir erwarten?«, fragt Hobbs.
Allerdings, denkt Keller.
Hobbs sagt es ihm trotzdem. »Ein illegaler Militärschlag auf dem Hoheitsgebiet eines befreundeten Staates. Das ist ein Verstoß gegen sämtliche internationale Abmachungen und gegen ein paar hundert Gesetze, und er könnte - Sie verzeihen die unglückliche Formulierung - eine schwere diplomatische Krise auslösen.«
»Es wäre unsere letzte Chance, die Barreras zu erwischen.«
»Den Waffendeal mit den Chinesen haben wir doch gestoppt.«
»Diesen einen«, wendet Keller ein. »Glauben Sie, die Barreras hören damit auf? Wenn wir sie jetzt nicht stoppen, bauen sie ihr Drogen- und Waffengeschäft aus, und binnen sechs Monaten ist die FARC komplett ausgerüstet.«
Jetzt sagt Hobbs nichts mehr. Keller läuft neben ihm her, versucht, seine Gedanken zu erraten. Er hört die Wellen gegen die Felsen klatschen, in der Ferne glitzern die Lichter von Tijuana.
Keller ist der Verzweiflung nahe. Wenn Hobbs jetzt nicht mitzieht, ist Nora tot, und die Barreras haben gewonnen.
Endlich räuspert.sich Hobbs. »Unsere normalen Ressourcen können wir dafür nicht einsetzen. Das müssen Externe machen. Wir haben nichts damit zu tun.«
Danke, lieber Gott. Keller beginnt wieder zu hoffen.
»Außerdem, Arthur«, Hobbs bleibt stehen und dreht sich zu ihm um. »Festnahmen kommen nicht in Frage. Wir können den Mexikanern nicht erklären, wieso die Barreras bei uns einsitzen. Das wird ein verdeckter Zugriff - keine Gefangenen, nur Totalsanktion. Sind Sie damit einverstanden?«
Keller nickt.
»Ich muss es von Ihnen hören«, sagt Hobbs.
»Ja, ich bin mit der Totalsanktion einverstanden«, sagt Keller.
So weit, so gut, denkt er. Aber Hobbs wird ihn nicht gehen lassen, ohne seinen Preis zu verlangen. Er lässt nicht lange auf sich warten.
»Und ich muss Ihre Quelle kennen«, sagt Hobbs. »Natürlich.«
Keller nennt ihm die Quelle.
Callan läuft vom Strand zurück zu seiner Hütte. Es ist ein kalter, nebliger Tag an der nordkalifornischen Küste, ein Wetter, das er mag.
Es fühlt sich gut an.
Er öffnet die Tür - und zieht seine 22er. »Immer sachte!« Scachi versucht ihn zu beruhigen. »Wir haben kein Problem.«
»Wirklich nicht?«
»Du bist abgetaucht, Sean«, sagt Scachi. »Hättest vorher mit mir reden sollen.«
»Und das Ding, das wir gedreht haben? Der Geldtransport für die Barreras?«
»Kalter Kaffee.«
»Wir haben also kein Problem«, sagt Callan, ohne die Pistole zu senken. »Danke für die Auskunft. Und nun verschwinde.«
»Ich habe einen Job für dich.«
»Sorry«, sagt Callan. »Solche Jobs mache ich nicht mehr.« Das trifft sich gut, sagt Scachi. Diesmal geht es nicht um einen Killerjob. Diesmal wird es ein Rettungseinsatz.
Keller und Scachi beschließen, vom Wasser her anzugreifen.
Sie studieren das Kartenmaterial und stellen fest, dass sie nur auf diesem Wege schnell genug sein können. Ein Fischkutter bei Nacht, der nordwärts vorüberfährt. Sie wollen mit Schlauchbooten an Land gehen.
Doch es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an. Die Cortes-See ist starken Gezeiten unterworfen. Bei Ebbe weicht das Wasser Hunderte Meter zurück, und solche Entfernungen machen einen schnellen Zugriff unmöglich. Auch bei Dunkelheit werden sie entdeckt und niedergemäht, ehe sie den Häusern auch nur nahe kommen.
Ihnen bleibt nur ein schmales Zeitfenster. Es muss Nacht sein, und es muss Flut herrschen.
»Zwischen einundzwanzig Uhr und einundzwanzig Uhr zwanzig«, sagt Scachi. »Heute abend.«
Das ist zu früh, denkt Keller.
Und vielleicht schon zu spät.
Nora erzählt alles über ihren letzten Aufenthalt in San Diego.
Wo sie shoppen ging, was sie gekauft hat, wo sie übernachtet hat, dass sie mit Haley essen war, ein Schläfchen gemacht hat, einen kurzen Lauf, dann Abendessen.
»Was haben Sie an dem Abend noch gemacht?«
»Im Zimmer geblieben, Essen bestellt, ferngesehen.«
»Sie sind nach La Jolla gefahren, um fernzusehen? Warum?«
»Mir war eben danach. Ich wollte mal ausspannen, ein bisschen fernsehen.«
»Was haben Sie gesehen?«
Sie weiß, dass sie sich aufs Glatteis begibt. Sie weiß es und kann nichts dagegen tun. So ist das eben mit dem Glatteis - es ist höllisch glatt. Ich war im Weißen Haus und habe mich mit Keller getroffen, aber das kann ich nicht sagen, oder ...? Also:
»Ich weiß nicht. Kann mich nicht erinnern.«
»So lange ist es nicht her.«
»Das übliche Zeug, irgendeinen Film. Wahrscheinlich bin ich eingeschlafen.«
»Pay-TV oder ein öffentlicher Sender?«
Sie kann sich nicht erinnern, wie das im Valencia war, ob sie den Fernseher dort überhaupt eingeschaltet hat. Aber wenn ich sage, es war Pay-TV, dann muss das auf meiner Rechnung stehen, oder? Also sagt sie, es war ein öffentlicher Sender. »HBO oder Showtime, eins von beidem.«
Der Mann spürt, dass er sie in der Schlinge hat. Sie ist kein Profi, sonst würde sie niemals genaue Angaben machen (»Ich kann mich nicht erinnern - es könnte so gewesen sein oder auch so«). Aber die Frau hat präzise Angaben gemacht - bis es um den Abend geht, da weicht sie plötzlich aus.
Ein professioneller Lügner weiß, dass die Lügen nicht wie Wahrheiten aussehen dürfen, sondern die Wahrheiten wie Lügen klingen müssen.
Also, ihre Wahrheiten klingen wahr, und ihre Lügen?
»Aber Sie wissen nicht, wie der Film hieß.«
»Ich habe - wie sagt man dazu - ich habe gezappt.«
»Gezappt.«
»Ja.«
»Was haben Sie an dem Abend gegessen?«
»Fisch. Meistens esse ich Fisch.«
»Wegen Ihrer Linie.«
»Klar.«
»Ich komme gleich wieder. In der Zwischenzeit überlegen Sie, welchen Film Sie gesehen haben.«
»Darf ich schlafen?«
»Im Schlaf können Sie nicht überlegen.«
Aber wenn ich nicht schlafen kann, kann ich auch nicht überlegen, sagt sie sich. Das ist das Problem. Ich kann mir keine Lügen mehr ausdenken, ich bin viel zu müde. Ich weiß selbst nicht mehr genau, was passiert ist und was nicht. Welchen Film hab ich gesehen? In welchem Film bin ich hier? Wie wird der Film enden?
»Wenn Sie sich erinnern, was Sie in der Nacht gesehen haben, lasse ich Sie schlafen.«
Er weiß, wie das läuft. Um den ersehnten Schlaf zu bekommen, wird sie eine »Erinnerung« produzieren. Sie kann sie sogar für echt halten. Wenn sie sich als echt erweist, gut. Wenn nicht, hat er einen Keil in ihre Abwehr getrieben, die Abwehr bricht zusammen.
Und die Wahrheit kommt an den Tag.
»Sie lügt«, sagt der Verhörspezialist zu Raúl Barrera. »Sie denkt sich was aus.«
»Woran merkst du das?«
»Körpersprache«, sagt der Mann. »Unscharfe Antworten. Wenn ich sie an den Lügendetektor hänge und sie nach dem einen Abend frage, fällt sie durch.«
Kann ich Adán damit überzeugen?, fragt sich Raúl. Kann ich diese verlogene Schlampe entsorgen, ohne dass es Krieg mit Adán gibt? Fabián hat mir über seinen Anwalt gemeldet, dass sie die Verräterin ist. Und jetzt ist der Vernehmer nahe dran, sie festzunageln.
Oder soll ich warten, bis uns Rebollo die definitive Bestätigung gibt? - Wenn er sie denn gibt?
»Wie lange brauchst du noch, bis du sie so weit hast?«, fragt er den Vernehmer.
Der sieht auf die Uhr. »Jetzt ist es siebzehn Uhr? Sagen wir zwanzig Uhr dreißig, maximal einundzwanzig Uhr.«
Jetzt sind die Wolken auf unserer Seite, denkt Keller. Der Fischkutter durchpflügt die ruppige See. Er hört das rhythmische Klatschen der Wellen am Bug. Das schlechte Wetter, das den Nachschub an Satellitenfotos gestoppt hat, schützt sie nun vor den Blicken der Beobachtungsposten an der Küste und auf anderen Schiffen, von denen sicher einige mit Barreras Leuten besetzt sind.
Er schaut sich die Männer an, die schweigend auf Deck sitzen. Ihre Augen leuchten hell aus den geschwärzten Gesichtern hervor. Rauchen ist verboten, aber die meisten haben sich unangezündete Zigaretten zwischen die Lippen geschoben, andere kauen Kaugummi. Ab und zu werden ein paar Worte gewechselt, aber fast alle starren hinaus in den grauen, vom Mondlicht erhellten Nebel.
Die Männer tragen Schusswesten über ihren schwarzen Jumpsuits, und jeder führt sein eigenes Waffenarsenal mit sich - Macio, M16, 45er Pistolen und gefährlich flache Nahkampf-Macheten. Die Schusswesten sind behängt mit Handgranaten.
Das sind also die »externen Ressourcen«, denkt Keller.
Wo zum Teufel hat Scachi die aufgetrieben?
Callan weiß es.
Das ist wie ein beschissenes Klassentreffen, hier mit den Jungs von Red Cloud zu sitzen und auf den Einsatz zu warten, mit manchen von denen hat er in Las Tangas die Koje geteilt.
»Den Waffennachschub der Terroristen an der Quelle blockieren«, hat Scachi den Einsatz definiert.
Drei mit Planen zugedeckte Zodiac-Schlauchboote sind an Bord festgezurrt. Mit je acht Mann Besatzung sollen sie in fünfzig Metern Abstand landen. Zwei Trupps, um das große Haus zu stürmen, der dritte, um sich das untere Strandhaus vorzunehmen.
Wenn wir überhaupt so weit kommen, denkt Callan.
Wenn die Barreras gewarnt sind, laufen wir ins Sperrfeuer, wir werden am nackten Strand festgenagelt, als Deckung bleibt uns nur der Nebel. Der Strand wird von Leichen übersät sein.
Aber sie bleiben nicht liegen.
Das hat ihnen Scachi extra eingeschärft: Keiner wird zurückgelassen. Ob tot oder lebendig oder irgendwas dazwischen - alle kommen zurück an Bord. Callan wirft einen Blick auf die Hohlziegel, die auf dem Achterdeck aufgestapelt sind. »Grabsteine«, hat Scachi sie genannt. Für die Seebestattung.
Wir lassen keine Leichen in Mexiko zurück. Für die Öffentlichkeit ist das der Überfall eines rivalisierenden Drogenkartells, das von den gegenwärtigen Problemen der Barreras profitieren will. Wenn sie euch lebend kriegen - aber das darf nicht passieren -, werdet ihr das erzählen. Egal, was sie mit euch machen. Die bessere Lösung: gleich am Lauf lutschen. Wir sind nicht die Marines, wir boxen euch nicht raus.
Keller geht unter Deck. Der Dieselgestank dreht ihm den Magen um. Oder es sind die Nerven, denkt er.
Scachi trinkt Kaffee.
»Wie in den alten Zeiten, was, Arthur?«
»Fast.«
»Hey, Arthur, wenn du das hier nicht willst, dann sag Bescheid.«
»Doch, ich will es.«
»Ihr habt dreißig Minuten Zeit«, sagt Scachi. »Nach dreißig Minuten sind alle wieder an Bord, und wir ziehen ab. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein mexikanisches Patrouillenboot.«
»Verstanden«, sagt Keller. »Wann sind wir dort?«
Scachi gibt die Frage an den Kapitän weiter.
Noch zwei Stunden.
Keller schaut auf die Uhr.
Gegen neun werden sie an Land gehen.
Ihren entscheidenden Fehler macht Nora um zwanzig Uhr fünfzehn.
Sie schläft im Stehen ein, aber sie schütteln sie wach und führen sie im Zimmer herum. Dann wird sie wieder auf den Stuhl gesetzt, und der Vernehmer kommt und fragt: »Wissen Sie jetzt, was Sie an dem Abend gesehen haben?«
»Ja.«
Weil ich Schlaf brauche. Ich muss schlafen. Wenn ich schlafen kann, kann ich denken, und wenn ich denken kann, fällt mir ein Ausweg ein. Also gebe ich ihnen was, nur ein bisschen. Ich kaufe mir meinen Schlaf. Ich kaufe mir Zeit.
»Sehr gut. Und was?«
»Amistad.«
»Der Film, der von Sklaven handelt?«
»Ja, der.«
Fragt mich nur aus, denkt sie. Ich hab ihn gesehen. Ich kann alle eure Fragen beantworten. Ihr Dreckskerle.
»Im öffentlichen Fernsehen laufen an den Wochentagen keine Filme, also muss es Pay-TV gewesen sein oder HBO.«
»Oder irgendein anderer -«
»Nein. Ich hab das recherchiert. Das Hotel hat nur HBO und Pay-TV.«
»Oh.«
»Also was davon?«
Wie soll ich das wissen, denkt Nora.
»HBO.«
Der Mann schüttelt traurig den Kopf. Wie ein Lehrer, den sein Musterschüler enttäuscht hat. »Nora, das Hotel hat kein HBO.«
»Aber Sie haben doch gesagt -«
»Das war eine kleine Falle.«
»Dann eben Pay-TV.«
»Wirklich?«
»Ja, jetzt fällt's mir ein. Es war Pay-TV. Ich erinnere mich, weil ich die kleine Karte auf dem Fernseher gesehen habe und mich gefragt habe, ob die denken, dass ich Pornos gucke. Ja, stimmt. Und ich ... was?«
»Nora, ich habe eine Kopie von Ihrer Hotelrechnung. Sie haben keinen Film bezahlt.«
»Nein?«
»Nein. Aber jetzt erzählen Sie mir, was Sie an dem Abend wirklich gemacht haben.«
»Das hab ich doch.«
»Sie haben gelogen, Nora. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen.«
»Ich bin nur durcheinander. Ich bin so müde. Wenn Sie mich ein bisschen schlafen lassen ...«
»Sie lügen, weil Sie etwas zu verbergen haben. Einen anderen Grund gibt es nicht. Was haben Sie zu verbergen, Nora? Was haben Sie an dem Abend gemacht?«
Sie schlägt schluchzend die Hände vors Gesicht. Seit Juans Tod hat sie nicht geweint. Es tut ihr gut. Es ist so befreiend.
»Sie waren an dem Abend woanders, oder?«
Sie nickt.
»Sie haben uns die ganze Zeit belogen, oder?«
Sie nickt wieder.
»Darf ich jetzt schlafen, bitte?«
»Gebt ihr Tuinol«, sagt der Vernehmer. »Und holt Raul.«
Adáns Tür geht auf.
Raúl kommt herein und reicht ihm eine Pistole. »Bist du bereit, Bruder?«
Sie spürt eine Hand auf der Schulter.
Glaubt erst, es ist ein Traum, dann macht sie die Augen auf und sieht Adán.
»Meine Liebste«, sagt er. »Gehen wir spazieren.«
»Jetzt?«
Er nickt.
Er sieht so ernst aus, denkt sie. So ernst.
Er hilft ihr beim Aufstehen.
»Ich sehe schrecklich aus«, sagt sie.
Und es stimmt. Ihr Haar ist zerwühlt, ihr Gesicht ist aufgedunsen von Medikamenten. Jetzt fällt ihm auf, dass er sie nie ohne Make-up gesehen hat.
»Du siehst immer gut aus«, sagt er. »Hier, zieh den Pullover über. Es ist kalt. Ich will nicht, dass du krank wirst.«
Sie geht mit ihm hinaus in den silbrigen Dunst. Ihre Füße finden kaum Halt auf den großen Kieseln, so erschöpft ist sie. Er hält sie am Ellbogen fest und führt sie behutsam von der Hütte weg, zum Wasser.
Raúl schaut ihnen vom Fenster aus nach.
Er sieht Adán und seine Geliebte aus der Strandhütte kommen und im Nebel verschwinden.
Hat er die Kraft?, fragt er sich.
Die Kraft, der hübschen Blondine die Pistole an den Kopf zu setzen und abzudrücken? Aber was macht's? Wenn er's nicht kann, tue ich es. So oder so bin ich der neue patrón, und unter dem neuen patrón werden die Dinge anders laufen. Adán ist weich geworden. Ist eben doch nur ein Buchhalter - mit Zahlen kann er umgehen, aber wenn es hart auf hart kommt...
Ein Klopfen an der Tür reißt ihn aus seinen Gedanken.
»Was ist denn?«, fragt er unwillig.
Einer seiner Männer. Er ist außer Atem, als wäre er die Treppen hochgerannt.
»Die undichte Stelle«, sagt er. »Wir haben Nachricht von Rebollo. Er hat es direkt von dem DEA-Mann, von Wallace -«
»Es ist Nora.«
Der Mann schüttelt den Kopf. »Nein, patron. Es ist Fabian.«
Der Mann nennt ihm die Beweise - die Mordanklage, die Androhung der Todesstrafe, dann das Eigentliche - Kontoauszüge von Überweisungen, die Keller in Fabians Auftrag vorgenommen hat - Banken in Costa Rica, auf den Caymans, sogar in der Schweiz.
Hunderttausende von Dollars - Profite aus den Geschäften der Piccone-Brüder.
»Sie haben ihm ein Angebot gemacht«, sagt der Mann. »Silber oder Blei.«
Er hat das Silber genommen.
Setzen wir uns, sagt Adán.
Er hilft Nora und setzt sich neben sie. »Mir ist kalt«, sagt sie. Er legt den Arm um sie.
»Weißt du noch, der Abend in Hongkong? Als du mit mir auf den Victoria Peak gefahren bist? Stellen wir uns vor, wir wären dort.«
»Da war ich jetzt gern.«
»Die vielen Lichter, weißt du noch?«
»Adán, weinst du?«
Langsam zieht er die Pistole aus dem Gürtel. »Küss mich«, sagt Adán.
Er zieht ihren Kopf heran und küsst sie sanft auf die Lippen, während er den Pistolenlauf auf ihren Hinterkopf richtet und entsichert.
»Du warst das Lächeln meiner Seele«, flüstert er.
Adán, es tut mir leid. Als wir die Nachricht bekamen, war es zu spät. Eine Tragödie! Aber Fabián wird dafür büßen, da kannst du sicher sein.
Raúl Barrera übt seinen Auftritt.
Jetzt muss das mit der Blonden geregelt werden, denkt er. Fabián kommt später. Diese Frau umzubringen, daran wird Adán kaputtgehen. Er wird nicht mehr fähig sein, die Geschäfte zu führen.
Er ist mein Bruder!
Verdammt noch mal. Eine verfahrene Kiste. Er schiebt den Mann beiseite, rennt die Treppe hinunter, hinaus in die Nacht.
Und schreit »Adán! Adán!«
Adán hört die halb vom Nebel verschluckten Schreie.
Hört Raúl näher kommen, hört seine Schritte auf den Kieseln. Er spannt den Finger um den Abzug und denkt, nein, nicht er, das lasse ich nicht zu, dass er es macht.
Hinter ihnen naht die dunkle Gestalt von Raúl wie ein Gespenst.
Ich muss es selbst tun.
Jetzt.
Keller springt aus dem Boot, stapft durch knöchelhohes Wasser, stolpert und fällt. Richtet sich auf, kriecht geduckt den Strand hinauf, da sieht er - Raúl Barrera.
Auf Adán zurennend. Und auf Nora.
Es wird ein weiter Schuss, mindestens hundert Meter, seit Vietnam hat er keine M16 mehr mit einer solchen Erregung abgefeuert. Er hebt das Gewehr, drückt das Auge ans Nachtsichtgerät, folgt Raúl ein paar Schritte mit dem Fadenkreuz und drückt ab.
Die Kugel erwischt ihn mitten in der Bewegung. Direkt in den Bauch.
Keller sieht ihn straucheln, abrollen und weiterkriechen. Dann wird die Nacht taghell.
Raúl krümmt sich auf dem Boden.
Wälzt sich in Todesqualen, brüllend vor Schmerz.
Adán rennt zu ihm, will ihn halten, aber Raúl ist stärker, seine Schmerzen sind stärker, er reißt sich los.
»Dios mio!«, schreit Adán.
Seine Hände sind voll Blut.
Das Blut fühlt sich heiß an.
»Adán«, stöhnt Raúl, »sie war's nicht. Fabián war's.« Dann heult er vor Schmerzen. »Dios mío! Dios mío! Madre de Dios!«
Adán muss jetzt klaren Kopf bewahren. Alles ringsum explodiert, Gewehrfeuer überall, hastende Männer, Rauls Bodyguards kommen gerannt, schießen wild um sich, versuchen, Raúl in Sicherheit zu bringen.
»Holt einen Wagen!«, brüllt Adán. »Bringt ihn her. Raúl, wir fahren dich ins Krankenhaus!«
»Lasst mich.«
»Wir müssen.«
Sie schleppen ihn den Strand hoch, weg vom Gewehrfeuer. Adán packt Nora bei den Armen und will sie hochziehen. »Komm, schnell!«
Eine Granate schlägt in ein paar Metern Entfernung ein und wirft sie um.
Nora liegt auf den Steinen, ihr Kopf dröhnt, ihre Nase blutet, Adán schreit etwas, doch sie kann nichts hören. Manuel zieht ihn fort, er schreit weiter, will zurück zu ihr, aber der Campesino ist stärker als er.
Zwei Sicarios wollen Nora wegtragen, zwei kurze Gewehrsalven mähen sie nieder.
Ein weiterer Lichtblitz, dann ist es dunkel.
Keller sieht, wie die beiden Barreras den Hang hinaufgeschleppt werden, zu ein paar Landrovern in der Nähe des großen Hauses.
Er rennt ihnen nach, Schüsse schlagen hinter ihm ein.
Ein schmächtiger Mann mit randloser Brille kommt aus der Strandhütte und rennt den Hang hinauf, eine kurze Salve trifft ihn im Laufen, und er fliegt auf den Rücken wie ein Stummfilmkomiker, der auf einer Bananenschale ausrutscht.
Die Hüttentür knallt zu, aus den Fenstern kommt jetzt heftiges Gewehrfeuer. Keller wirft sich zu Boden und kriecht auf Nora zu. Callan hält sich neben ihm, rollt sich weg, gibt seine Doppelschüsse ab und rollt sich weiter.
Dann ruft er: »Deckung!«
Eine Sekunde später fliegt eine Granate durch ein Hüttenfenster und explodiert.
Die Schüsse verstummen.
Raúl quiekt vor Schmerz, als ihn seine Männer auf den Rücksitz hieven. Adán steigt auf der anderen Seite ein und hält den Kopf seines Bruders im Schoß. Raúl packt seine Hand.
Manuel setzt sich ans Steuer, Rauls Leute wollen ihn davon abhalten, aber Adán brüllt: »Manuel soll fahren!«, und sie lassen ihn. Das Auto fährt den Berg hoch, jedes Holpern ein Todesstoß für Raúl.
Raúl presst Adáns Hand, als wollte er ihm die Knochen zerquetschen, doch Adán merkt es kaum. Er streicht ihm über den Kopf, macht ihm Hoffnung. Alles wird gut.
»Wasser!«, stöhnt Raúl.
Adán findet eine Trinkflasche im Rücksitzfach, schraubt den Deckel ab und lässt Raúl trinken. Raúl schluckt das Wasser, und Adán merkt, wie es auf seine Schuhe plätschert.
Adán dreht sich um und schaut zurück.
»Nora!« brüllt er und befiehlt Manuel, umzukehren.
Manuel reagiert nicht. Er fährt langsam den Hang hinauf, im ersten Gang, mit Vierradantrieb, ein weiterer Landrover folgt ihm, mit Sicarios, die ihnen Feuerschutz geben.
Leuchtpatronen erhellen die Nacht wie ein tödliches Feuerwerk.
Eine Panzergranate trifft den zweiten Landrover, er explodiert, glühend heiße Metallsplitter schwirren umher. Der Fahrer kommt herausgetaumelt, brennend wie eine Fackel, ein anderer fällt seitlich aus dem aufgerissenen Fahrzeug und bleibt auf den Felsen liegen.
Manuel tritt aufs Gas, und Raúl schreit auf.
Keller sieht, dass der Landrover davonfährt.
»Verdammt!«, brüllt er, dreht sich zu Callan um und befiehlt: »Pass auf sie auf!«, legt ihm Noras leblosen Körper in die Arme und rennt los, hinter dem davonfahrenden Landrover her. Schüsse aus dem großen Haus umschwirren ihn wie Moskitos. Er zieht den Kopf ein und rennt weiter, vorbei an dem brennenden Geländewagen und an brennenden Leichen, um den anderen Wagen einzuholen, der sich über ihm den Hang hochquält.
Adán entdeckt Keller und bringt seine Pistole in Anschlag, aber jede Bewegung, die er macht, steigert Rauls Qualen. Er sieht Keller, der ihn ins Visier nimmt.
Adán und Keller schießen aufeinander, beide verfehlen den anderen.
Jetzt hat der Landrover die Hügelkuppe erreicht. Er kippt in die Horizontale und dreht auf. Raúl brüllt wie ein Stier, Adán muss ihn mit allen Kräften festhalten.
Keller steht auf der Hügelkuppe, vornüber gebeugt, keuchend, und schaut dem Landrover nach.
Er atmet dreimal tief durch, reißt das Gewehr hoch und zielt auf das linke Rückfenster, wo er Adán zuletzt gesehen hat. Beim Ausatmen drückt er ab.
Das Auto fährt weiter.
Keller läuft zurück zum Haupthaus.
Scachis Leute gehen routiniert und ohne Eile zur Sache. Der eine Trupp gibt Feuerschutz mit kurzen, disziplinierten Salven, während sich der andere vorwärts bewegt, dann tauschen sie die Rollen. Nach dreimaligem Wechsel haben sie einen ihrer Leute bis zur Hauswand gebracht. Er presst sich an die Steinmauer, während die anderen das Feuer auf die Fenster eröffnen. Auf ein Signal stellen sie das Feuer ein, der Mann befestigt eine Haftladung an der Tür und wirft sich zu Boden, als die Tür zerbirst.
Die anderen drängen hinein, drei schnelle Salven, dann ist Stille.
Keller folgt ihnen ins Haus.
Es ist ein Schlachthaus, ein Tollhaus.
Überall Blut, Tote und Verwundete, Scachis Leute sind dabei, die Sicarios, die zwischen den Welten schweben, fachmännisch zu erledigen.
Drei Tote liegen auf dem Fußboden des großen Zimmers. Einer von ihnen auf dem Bauch, mit zwei Einschusslöchern im Hinterkopf. Keller steigt über ihn hinweg, um ins Schlafzimmer zu gelangen.
Dort liegen noch elf andere.
Ein Verwundeter, seine Schulter ein roter Klumpen, lehnt an der Wand, mit ausgebreiteten Beinen. Scachi stellt sich vor ihn, holt mit dem Stiefel aus, als wollte er einen Elfmeter schießen, und tritt ihn in die Eier.
»Spuck's aus!«, sagt Keller.
Der Sicario zögert nicht. Die Barreras haben hier gewohnt, mit la Güera, und Raúl ist schwer verletzt, Bauchschuss.
»Schon mal gute Nachrichten«, sagt Scachi. Er weiß genauso gut wie Keller, dass Raúl Barrera einen Bauchschuss nicht überlebt. Er ist so gut wie tot - toter als tot.
»Wir kriegen sie«, sagt Keller zu Scachi. »Sie sind nicht weit.«
»Womit denn?«, fragt Scachi. »Hast du einen Jeep mitgebracht?« Er schaut auf die Uhr und brüllt: »zehn Minuten noch!«
»Wir müssen ihnen nach!«, brüllt Keller. »Keine Zeit.«
Der Verwundete spuckt weiter Informationen aus - die Barreras wollen mit dem Landrover nach San Felipe, um Raúl zu retten.
Scachi glaubt ihm.
»Raus mit ihm und erschießen«, befiehlt er. Keller zuckt nicht mit der Wimper.
Alle kannten die Spielregeln, bevor sie in die Schlacht gingen.
Der Landrover holpert über die löchrige Straße. Raúl brüllt.
Adán weiß nicht, was er machen soll. Wenn er Manuel befiehlt, langsamer zu fahren, wird Raúl verbluten. Wenn er ihm befiehlt, schneller zu fahren, muss Raúl noch mehr leiden.
Ein tiefes Schlagloch, und Raúl kreischt auf vor Schmerz.
»Por favor, hermano«, murmelt er, als er wieder zu Atem kommt.
»Was ist, Bruder?«, fragt Adán.
Raúl blickt zu ihm auf, dann zu seiner Pistole hinüber. »Du weißt es.«
»Nein, Raúl, du wirst es schaffen.«
»Ich ... halte es nicht mehr ... aus«, röchelt Raúl. »Bitte Adán.«
»Ich kann es nicht.«
»Ich flehe dich an.«
Adán blickt Manuel fragend an.
Der Alte schüttelt den Kopf. Raúl wird es nicht schaffen. »Anhalten«, sagt Adán.
Er nimmt die Pistole aus Rauls Gürtel, legt Rauls Kopf behutsam aufs Sitzpolster und steigt aus dem Wagen. Die Wüstenluft duftet streng nach Salbei.
Adán hebt die Pistole und richtet sie auf Rauls Kopf.
»Danke, Bruder«, flüstert Raúl. Adán drückt zweimal ab.
Keller folgt Scachi zum Strand, zu den zwei toten Söldnern, die dort liegen. Scachi bekreuzt sie. »Gute Leute«, sagt er zu Keller. Zwei andere Söldner schleppen die Toten zum Schlauchboot.
Keller läuft weiter zu der Stelle, wo er Nora zurückgelassen hat.
Callan kommt auf ihn zu, er trägt Nora über der Schulter, ihr langes blondes Haar und ihre Arme hängen schlaff nach unten. Keller hilft ihm, die leblose Nora ins Boot zu hieven.
Adán Barrera fährt nicht nach San Felipe, sondern in ein kleines Fischercamp.
Der Manager kennt ihn und lässt sich nichts anmerken, klug, wie er ist. Er vermietet ihnen zwei Hütten am äußersten Rand des Camps.
Manuel weiß, was zu tun ist, das muss ihm keiner sagen.
Er parkt den Landrover dicht neben seiner Hütte, schleppt Rauls Leiche ins Bad, legt ihn in die Wanne, dann holt er ein Messer, wie es die Fischer benutzen. Er zerlegt Rauls Körper, trennt ihm Hände, Arme, Füße, Beine und schließlich den Kopf ab.
Es ist eine Schande, dass Raúl kein würdiges Begräbnis bekommt, aber keiner darf erfahren, dass Raúl Barrera tot ist.
Natürlich wird es Gerüchte geben, doch solange es keine Gewissheit gibt, wird niemand wagen, sich gegen den starken Mann des Barrera-Kartells zu stellen. Erst wenn sein Tod bestätigt ist, werden alle kommen, um sich an Adán zu rächen.
Mit einem Schuppenmesser löst Manuel vorsichtig die Haut von Rauls abgetrennten Fingerkuppen, und spült sie durch den Wannenabfluss. Dann verstaut er die Körperteile in Plastiktüten und spült die Wanne aus. Er trägt die Tüten'zu einem Motorboot, füllt sie mit Bleischrot, mit dem die Fischer ihre Netze beschweren, und fährt weit hinaus. Alle paar hundert Meter wirft er eine der Plastiktüten über Bord.
Und bei jedem Wurf spricht er ein schnelles Gebet für die Jungfrau Maria und für Santo Jesús Malverde.
Adán steht unter der Dusche und heult.
Seine Tränen vermischen sich mit dem Schmutzwasser, das gurgelnd im Abfluss verschwindet.
Keller und Shag Wallace gehen zum Friedhof und legen Blumen auf Ernies Grab.
»Einer ist noch übrig«, sagt Keller zum Grabstein. »Nur noch einer.«
Dann fahren sie zum Strand von La Jolla und verfolgen den Sonnenuntergang an der Bar des Sea Lodge.
»Auf Nora Hayden«, sagt Keller und hebt das Bierglas. »Auf Nora Hayden.«
Sie stoßen an und verfolgen schweigend, wie der Feuerball sinkt und den Ozean in flüssiges Gold verwandelt.
Fabián Martínez kommt aus dem Gebäude des Bundesgerichts in San Diego geschlendert. Der Bundesrichter hat seiner Auslieferung nach Mexiko zugestimmt.
Er ist noch im orangefarbenen Häftlingsoverall, seine Hände sind an die Hüften gekettet, er trägt Fußfesseln, trotzdem gelingt es ihm, locker zu schlendern wie ein Filmstar und Art Keller mit einem fiesen Blick zu streifen.
»In einem Monat bin ich draußen, du Pfuscher«, ruft er ihm zu, bevor er in den wartenden Van steigt.
Darauf kannst du wetten, denkt Keller. Er überlegt kurz, ob er ihn stoppen soll, dann sagt er sich: Scheiß drauf.
General Rebollo persönlich übernimmt die Gewähr für Fabián. Im Auto, auf der Fahrt zum Gericht von Tijuana, schärft er Martínez ein: »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, aber seien Sie nicht zu arrogant. Plädieren Sie auf nicht schuldig, und halten Sie den Mund.«
»Was ist mit la Güera?«
»Sie ist tot.«
Im Gericht erwarten ihn seine Eltern. Seine Mutter umarmt ihn schluchzend, sein Vater schüttelt ihm die Hand. Eine Stunde später, gegen eine Kaution von einer halben Million Dollar und eine diskrete Summe in gleicher Höhe, wird Martínez der Aufsicht seiner Eltern unterstellt.
Sie wollen ihn erst einmal aus dem Verkehr ziehen, deshalb bringen sie ihn zum ländlichen Anwesen seines Onkels bei Ensenada, in der Nähe des Städtchens El Sauzal.
Früh am Morgen steht er auf, um auf die Toilette zu gehen.
Er verlässt das Bett, eigentlich eine Matratze auf der Terrasse, und geht nach unten ins Bad. Er hat draußen geschlafen, weil die Verwandten des Onkels in allen Zimmern hausen und weil die kühle Brise vom Pazifik nachts sehr angenehm ist. Und es ist viel ruhiger draußen - kein Kindergeschrei, kein Streit, kein Liebeslärm, kein Schnarchen und all der andere Krach, der bei einem solchen Familientreffen zu erwarten ist.
Die Sonne ist gerade erst aufgegangen, schon wird es heiß. Wieder ein langer, heißer Tag in diesem öden Haus voller neugieriger Brüder, herrschsüchtiger Ehefrauen, verzogener Gören und einem Onkel, der sich einbildet, ihn belehren zu können.
Auf der Treppe merkt er, dass irgendwas nicht stimmt.
Nicht dass da etwas ist, sondern dass da etwas fehlt.
Der Rauch.
Da müsste Rauch aufsteigen vom Dienstbotentrakt vorm Tor des Haupthauses. Um die Zeit müssten die Frauen schon Tortillas backen, und der Rauch müsste über die Grundstücksmauer steigen.
Aber er tut es nicht.
Seltsam.
Ist heute irgendein Feiertag? Das kann nicht sein. Dann hätte sein Onkel Pläne gemacht, seine Schwägerinnen hätten sich um die Tischordnung gestritten, und er hätte schon seine Aufgabe bei den langweiligen Vorbereitungen zugewiesen bekommen.
Was ist mit dem Personal los?
Dann sieht er es.
Federales kommen durchs Tor.
Ein Dutzend etwa, in ihren auffälligen schwarzen Uniformen und Schirmmützen. Verdammter Mist, denkt Fabián. Er tut, was Adán ihm für solche Fälle geraten hat, und nimmt die Hände hoch. Das gibt Ärger, so viel ist klar. Aber alles lässt sich irgendwie einrenken. Dann sieht er, dass der Anführer der Federales hinkt.
Er zieht das Bein nach wie Manuel Sánchez. »Nein«, haucht Fabián. »Nein, nein, nein, nein ...«
Er hätte sich lieber erschießen sollen.
Aber sie schnappen ihn, bevor er eine Pistole findet, und zwingen ihn, mit anzusehen, was sie mit seiner Familie machen.
Danach fesseln sie ihn an einen Stuhl, ein großer Kerl stellt sich hinter ihn, packt ihn bei den Haaren, so dass er sich nicht rühren kann, auch nicht, als Manuel ihm das Messer zeigt.
»Das ist für Raul«, sagt Manuel.
Er macht kurze kräftige Schnitte quer über Fabians Stirn, am Haaransatz entlang, dann zieht er ihm die Gesichtshaut in Streifen ab. Fabián strampelt mit den Beinen, während ihm Manuel die Haut abzieht und ihm die Streifen über die Brust hängen lässt wie Bananenschalen.
Manuel wartet, bis er aufhört zu zucken, dann schießt er ihm in den Mund.
Sie hält ihr totes Baby in den Armen.
Aus der Position der Leichen schließt Art Keller, dass die Mutter ihr Kind schützen wollte.
Ich bin schuld, denkt Keller.
Das haben diese Leute mir zu verdanken.
Es tut mir leid, denkt er, es tut mir irrsinnig leid. Er beugt sich über die tote Mutter mit dem Kind und macht das Zeichen des Kreuzes. »In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.«
»El poder del perro«, hört er einen mexikanischen Polizisten flüstern.
Das Werk des Bluthunds.
FÜNFTER TEIL
Kreuzwege
13 Lebende Tote
When you're heading for the border lord, you're bound to cross the line.
Kris Kristofferson, Border Lord
Putumay O-Distrikt, Kolumbien
1998
Keller läuft in das zerstörte Coca-Feld und pflückt ein verwelktes Blatt.
Tote Pflanzen oder tote Menschen, denkt er. Ich bestelle mein Feld, doch mein einziges Werkzeug ist die Sense.
Er ist zu Ermittlungen nach Kolumbien gekommen - und um sicherzustellen, dass DEA und CIA bei der Kongress-Anhörung aus demselben Gesangbuch singen. Die zwei Dienste und das Weiße Hause bemühen sich beim Kongress um Rückhalt für »Plan Colombia«, ein Hilfsprogramm in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar, das der kolumbianischen Regierung ermöglichen soll, das Kokainproblem bei der Wurzel zu packen. Mit anderen Worten: mehr Entlaubungsmittel, mehr Flugzeuge, mehr Hubschrauber.
Von Cartagena sind sie mit dem Hubschrauber südwärts geflogen, nach Puerto Asís am Rio Putumayo, nahe der ekuadorianischen Grenze. Keller ist zu Fuß zum Fluss hinuntergelaufen, der sich als schlammiges braunes Band durch das üppige, fast erstickende Grün des Dschungels windet. Jetzt steht er am wackligen Brettergerüst der Anlegestelle, wo lange, schmale Kanus, das Haupttransportmittel in dieser Gegend, mit Kochbananen und gebündeltem Brennholz beladen werden. Javier, sein Begleiter, Soldat der 24. Brigade, kommt angerannt, um ihn zurückzuholen. Mein Gott, der ist doch kaum älter als sechzehn, denkt Keller.
»Sie können nicht über den Fluss«, erklärt ihm Javier.
Keller hatte das nicht vor, aber er fragt: »Warum nicht?«
»Das da drüben« - Javier zeigt aufs Südufer -, »ist Puerto Vega. Das wird von der FARC kontrolliert.«
Offenbar will Javier so schnell wie möglich vom Flussufer wegkommen, also kehrt Keller mit ihm auf »sicheres« Gelände zurück. Die Regierung kontrolliert Puerto Asís und das Nordufer des Flusses im Bereich der Stadt, aber schon die westliche Nachbarstadt Puerto Caicedo wird ebenfalls von der FARC beherrscht.
Puerto Asís ist AUC-Land.
Keller weiß Bescheid über die Autodefensas Unidas de Columbia, die Vereinigten Bürgerwehren Kolumbiens. Ins Leben gerufen wurden sie von dem alten Drogenbaron Fidel Cardona, auch Rambo genannt. Von seinem Rancho im Norden Kolumbiens befehligte er rechtsradikale Todessschwadrone - in den goldenen Zeiten des Medellin-Kartells. Dann wechselte er die Fronten und half der CIA bei der Verhaftung von Pablo Escobar - wofür ihm im Gegenzug alle Verbrechen verziehen wurden. Cardona zog eine neue weiße Weste an und wurde »Vollzeitpolitiker«.
Vorher hatte die AUC nur im Norden des Landes operiert - dass sie sich auch hier im Putumayo-Distrikt etabliert hat, ist eine relativ neue Entwicklung. Doch seit sie hier sind, zeigen sie auch Flagge.
Überall in Puerto Asís sieht Keller die Paramilitärs, zu erkennen an ihren Tarnanzügen und den roten Berets. Sie fahren mit ihren Pickups umher, durchsuchen Passanten oder tragen ihre Gewehre und Macheten zur Schau.
Geben den Campesinos zu verstehen: Die AUC hat hier die Macht, wir machen mit euch, was wir wollen.
Javier zieht ihn weiter - zu einem Konvoi aus Militärfahrzeugen in der Hauptstraße. Neben einem der Jeeps entdeckt er John Hobbs, der ungeduldig mit den Füßen scharrt. Wir brauchen also eine Militäreskorte, wenn wir aufs Land fahren, denkt Keller.
»Wir müssen uns beeilen, Seftor«, drängt Javier.
»Klar«, sagt Keller. »Aber erst muss ich mal was trinken.«
Eine entsetzliche Hitze. Sein Hemd ist schon durchnässt. Der Soldat führt ihn zu einem kleinen Getränkestand, wo Keller zwei Büchsen warmes Coke ersteht, eine für sich, eine für Javier. Die Verkäuferin, eine alte Frau, fragt ihn etwas, in dem hastigen Lokaldialekt, den Keller nicht versteht.
»Sie will wissen, ob Sie bar oder mit Kokain bezahlen«, dolmetscht Javier.
»Wie bitte?«
Kokain ist hier gängiges Zahlungsmittel, erklärt ihm Javier. Die Leute tragen die kleinen Beutelchen mit sich herum wie andere ihr Kleingeld. Die meisten zahlen mit Kokain. Eine Cola mit Kokain bezahlen, denkt Keller, während er ein paar zerknüllte, feuchte Scheine aus der Tasche zieht. Coke gegen Coke - so gewinnen wir den Drogenkrieg.
Jetzt steht er also auf dem zerstörten Feld und zerreibt ein verdorrtes Coca-Blatt zwischen den Fingern. Es fühlt sich klebrig an, daher wendet er sich an den Monsanto-Vertreter, der ihn umschwirrt wie ein Moskito, und fragt ihn: »Mischen Sie etwa Cosmo-Flux in das Roundup?«
Roundup Ultra ist der Handelsname für das Entlaubungsgift Glyphosat, das die kolumbianische Armee und ihre amerikanischen Berater versprühen - aus tieffliegenden Flugzeugen, die von Hubschraubern Feuerschutz erhalten.
Wie sich die Bilder gleichen, denkt Keller. Erst Vietnam, dann Sinaloa, jetzt Putumayo.
»Ja«, sagt der Monsanto-Mann. »Dann haftet es besser an den Pflanzen.«
»Klar. Aber damit erhöht sich auch das Vergiftungsrisiko für Menschen, oder?«
»Nun ja, in großen Mengen vielleicht«, erwidert der Mann. »Aber wir setzen hier niedrige Dosen ein, und das Cosmo-Flux macht die niedrigen Dosen sehr viel wirksamer. Viel mehr Wums fürs Geld.«
»Welche Dosierungen werden hier verwendet?«
Das weiß der Monsanto-Mann nicht, aber Keller lässt nicht locker. Er hält den ganzen Konvoi auf, weil er einen Piloten anspricht und sich einen Gifttank öffnen lässt. Nach zähem Hin und Her und allerlei Ausflüchten stellt sich heraus, dass sie etwa zehn Liter pro Hektar einsetzen. Die erlaubte Maximaldosis liegt nach Angaben von Monsanto bei zwei Litern pro Hektar.
»Das Fünffache der Maximaldosis?«, fragt Keller bei Hobbs nach.
»Wir gehen der Sache nach«, sagt Hobbs.
Der Mann ist alt geworden, denkt Keller. Klar, ich auch, aber Hobbs sieht uralt aus. Sein weißes Haar wirkt dünner, seine Haut fast durchsichtig, seine blauen Augen haben noch Schärfe, weilen aber schon irgendwie im Jenseits. Und er trägt ein Jackett, obwohl sie hier im Dschungel sind, bei drückender Hitze. Er scheint ständig zu frieren, denkt Keller. Wie das eben bei alten Leuten und bei Sterbenden so ist.
»Nein«, sagt Keller. »Ich gehe der Sache nach. Das Fünffache der Maximaldosis an Glyphosat, und dann wird noch Cosmo-Flux beigemischt? Was wollen Sie hier vergiften? Eine Kokain-Ernte oder die ganze Gegend?«
Dies hier ist kein Krieg gegen die Drogen, vermutet er, sondern ein Krieg gegen die linke Guerilla - die im Dschungel lebt und kämpft.
Wenn man also den Dschungel entlaubt...
Während die Militärs ihre »Erfolge« demonstrieren - Tausende Hektar verdorrter Coca-Pflanzen, nervt Keller sie mit seinen bohrenden Fragen: Werden nur Coca-Ernten oder auch Anbauflächen für Bohnen, Bananen, Mais, Maniok vernichtet? Nein, stimmt nicht? Aber was ich hier sehe, sieht mir eher aus wie Mais. Ist das nicht ein Grundnahrungsmittel in dieser Gegend? Wovon ernähren sich die Leute, wenn ihre Felder vernichtet werden?
Hier ist nicht Sinaloa, sagt sich Keller. Hier gibt es keine Drogenbarone, denen Tausende Hektar Land gehören. Das meiste Kokain wird von den kleinen Campesinos angebaut, auf höchstens mal einem Hektar. Wo die FARC regiert, werden sie von der FARC besteuert, wo die AUC regiert, werden sie von der AUC besteuert. Am schlimmsten aber sind die Campesinos dran, die zwischen den Fronten leben - die werden von beiden Seiten besteuert.
Als er die Sprühflugzeuge fliegen sieht, fragt er: Wie hoch fliegen die? Sind das dreißig Meter? Die Richtlinien von Monsanto besagen, dass sie nicht höher als drei Meter fliegen sollen. Fliegen sie höher, steigt das Risiko, dass sich die Giftwolke großflächig ausbreitet.
»Das sehen Sie völlig falsch«, erklärt ihm Hobbs.
»Ach wirklich?«, erwidert Keller. »Ich verlange, dass die Trinkwasserqualität in mehreren Dörfern dieser Gegend chemisch überprüft wird.«
Er zwingt den Konvoi zum Besuch eines Flüchtlingslagers, wo sich Campesinos sammeln, deren Felder vernichtet wurden. Es ist kaum mehr als eine Lichtung im Dschungel, hastig errichtete Hütten aus Schlackesteinen mit Blechdächern. Er besteht auch auf einem Besuch der Krankenstation, wo ihnen ein Missionar die Kinder mit genau den Symptomen zeigt, die Keller befürchtet hat - chronischer Durchfall, Hautausschläge, Atemprobleme.
»1,7 Milliarden Dollar, um Kinder zu vergiften?«, sagt Keller zu Hobbs, als sie zum Jeep zurücklaufen.
»Wir befinden uns hier im Krieg«, sagt Hobbs. »Da dürfen wir nicht wanken. Und es ist auch Ihr Krieg, Arthur. Darf ich Sie daran erinnern, dass Leute wie Adán Barrera nur durch das Kokain so stark geworden sind? Dass die Morde von El Sauzal mit Drogengeldern finanziert wurden?«
Daran muss er mich nicht erinnern, denkt Keller.
Und wo Barrera steckt, weiß keiner. Sechs Monate nach dem Einsatz am Strandhaus und dem nachfolgenden Massaker von El Sauzal ist er noch immer auf der Flucht. Die US-Regierung hat zwei Millionen Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt, aber bis jetzt hat sich keiner gemeldet, der Anspruch darauf erhebt.
Wer will auch Geld, dessen Übergabe er nicht erlebt?
Nach einer Stunde Fahrt erreichen sie ein Dorf, das völlig verlassen ist. Keine Menschen, nicht mal Schweine, Hühner, Hunde. Nichts.
Alle Hütten sehen unversehrt aus, nur ein großes Gebäude - der Lebensmittelspeicher der Gemeinde, wie es scheint - ist völlig ausgebrannt.
Eine Geisterstadt.
»Wo sind die Bewohner?«, fragt Keller seinen Begleiter.
Javier zuckt die Schultern, worauf er sich an den zuständigen Offizier wendet.
»Verschwunden«, antwortet der. »Wahrscheinlich vor der FARC geflohen.«
»Und wohin?«
Jetzt zuckt der Offizier die Schultern.
Sie übernachten auf einem kleinen Armeestützpunkt nördlich des Orts. Nach den Steaks vom Benzingrill verabschiedet sich Keller von der Gruppe, um schlafen zu gehen, wie er sagt, doch er will sich noch ein wenig umsehen.
Kennst du einen, kennst du alle, denkt er, ob in Vietnam oder Kolumbien. Eine Urwaldlichtung, gerodet und planiert, mit Stacheldraht umzäunt, ringsherum ein Sicherheitsstreifen.
Dieser Stützpunkt ist zweigeteilt, wie Keller herausfindet. Der größere Teil gehört der 24. Brigade, der kleinere, durch einen Zaun abgetrennt, ist offenbar für AUC-Truppen reserviert.
Er läuft am hohen Stacheldrahtzaun entlang, um sich Einblick zu verschaffen.
Es ist ein Ausbildungscamp - am Schießstand sind Strohpuppen für das Nahkampftraining aufgehängt, und es wird gerade geübt - Söldner, mit Messern bewaffnet, schleichen sich an die Puppen an, als wollten sie feindliche Wachen überwältigen.
Keller schaut eine Weile zu, dann geht er in seine Unterkunft, ein kleines Zimmer am Ende eines Kasernentrakts, nahe dem Außenzaun. Ein Fenster mit Moskitogitter, eine Pritsche, eine Lampe und, welch Luxus, ein Ventilator.
Er setzt sich auf die Pritsche, stützt das Kinn auf die Hand und grübelt. Der Schweiß tropft von seiner Nase auf den Betonfußboden.
Verflucht noch mal, denkt er. Ich und die AUC, wir sind eine Firma.
Er legt sich hin, aber er findet keinen Schlaf.
Es muss Stunden später sein, da hört er leises Klopfen. Es kommt von draußen, jemand klopft an den Fensterrahmen. Als sich Javier zu erkennen gibt, steht Keller auf.
»Was ist?«
»Wollen Sie mit mir kommen?«
»Wohin?«
»Wollen Sie mit mir kommen?«, wiederholt er. »Sie haben gefragt, wo die Bewohner sind.«
»Und?«
»Red Cloud«, sagt Javier.
Keller schlüpft wieder in die Schuhe und klettert aus dem Fenster. Geduckt schleicht er dicht hinter Javier her, am Außenzaun entlang, immer reglos verharrend, wenn der Suchscheinwerfer vorbeistreicht. Sie kommen an ein kleines Tor. Der Wachmann erkennt Javier und lässt sie durch. Flach auf der Erde kriechend überqueren sie den Sicherheitsstreifen, dann tauchen sie in den Dschungel ein. Auf schmalen Pfaden geht es hinunter zum Fluss.
Ich begehe eine Dummheit, denkt Keller. Eine kapitale Dummheit. Dieser Javier lockt mich in die Falle, und morgen steht in allen Zeitungen: DEA-Boss von FARC-Rebellen verschleppt. Aber er kann nicht anders, er muss mit. Er will es wissen.
Am Fluss wartet ein Kanu.
Javier steigt ein und winkt Keller heran.
»Ans andere Ufer?«, fragt Keller.
Javier nickt und drängt ihn zur Eile.
Keller steigt zu ihm ins Kanu.
Nach ein paar Minuten Paddeln legen sie an und ziehen das Kanu an Land. Als sich Keller umdreht, stehen vier bewaffnete und maskierte Männer vor ihm.
»Nehmt ihn mit«, sagt Javier.
»Du kleiner Drecksack«, flucht Keller, aber die Männer tun ihm nichts, sie geben ihm nur das Zeichen, ihnen zu folgen, westwärts das Flussufer entlang. Ein endloses Stolpern über Wurzeln und Ranken - aber schließlich kommen sie zu einer kleinen Lichtung, und dort, im Mondlicht, sieht er, wo die Dorfbewohner geblieben sind.
Enthauptete Leichen treiben im flachen Wasser, dicht an dicht, aufgefangen vom Ufergestrüpp, und am Ufer sind säuberlich die abgetrennten Köpfe aufgereiht. Jemand hat ihnen die Augen zugedrückt.
»Waren das die Guerillas?«, fragt Keller.
Einer der Maskierten schüttelt den Kopf und erzählt ihm, was vorgefallen ist. AUC-Truppen haben gestern das Dorf überfallen, junge Männer wurden erschossen, Frauen vergewaltigt. Die meisten Überlebenden wurden in die Dorfscheune gesperrt, die anderen mussten zusehen, wie die Scheune in Brand gesetzt wurde. Dann wurden sie zu einer Brücke über den Putumayo getrieben, mit Kettensägen enthauptet und in den Fluss geworfen - zur Abschreckung und Warnung für die Dörfer flussabwärts.
»Wir sind zu Ihnen gekommen«, sagt Javier, »weil wir dachten, wenn Sie die Wahrheit sehen, werden Sie zu Hause davon berichten. Die Menschen in Amerika - wenn die das wussten, würden sie nicht ihr Geld und ihre Soldaten schicken.«
»Welche Soldaten?«
»Die AUC-Truppen«, sagt der Maskierte, »werden von Ihren Special Forces ausgebildet.«
Der Mann zeigt auf die Leichen und sagt auf Englisch: »Ihre Steuerdollars - hier kommen sie zum Einsatz.«
Auf dem Rückweg bleibt Keller stumm.
Es gibt nichts zu sagen.
Zurück im Stützpunkt, geht er sofort zum Zimmer von Hobbs und hämmert gegen die Tür. Der alte Mann ist verwirrt und schlaftrunken. Er hat sich in einen dünnen weißen Bademantel gehüllt und sieht aus wie ein Kurpatient.
»Arthur, wie spät ist es? Mein Gott, wo haben Sie gesteckt?«
»Red Cloud«, sagt Keller.
»Wovon reden Sie? Haben Sie getrunken?«, fragt Hobbs.
Aber Keller sieht ihm an, dass er weiß, wovon die Rede ist. »Läuft hier in Kolumbien eine Operation mit dem Namen >Red Cloud<?«
»Nein.«
»Lassen Sie Ihre verdammten Lügen! Dasselbe wie Operation Phoenix, oder? Diesmal in Lateinamerika.«
»Da sind Sie auf dem falschen Dampfer, Arthur.«
»Bilden wir AUC-Söldner aus?«, fragt Keller. »Das braucht niemand zu wissen.«
»Aber ich will es wissen!«
Er erzählt Hobbs von seinem Erlebnis am Fluss. Hobbs schraubt eine Plastikflasche auf, die auf einem Hocker am Bett steht, gießt sich ein Glas Wasser ein und trinkt. Keller sieht, wie seine Hand zittert.
»Sie sind sehr leichtsinnig und erschreckend naiv für einen Mann mit Ihrer Erfahrung«, sagt Hobbs. »Es ist doch offensichtlich, dass die FARC diese Massaker verübt und den AUC-Truppen in die Schuhe schiebt. Um die Bevölkerung aufzuhetzen und um weltweite Anteilnahme zu erregen. Das war die übliche Masche des Vietcong, damals in den -«
»Red Cloud, was steckt dahinter, John?«
»Das müssten Sie am besten wissen!«, fährt ihn Hobbs an. »Sie haben sich doch dieser Leute erst neulich bedient. Bei Ihrem kleinen Privatfeldzug in Mexiko. In den Augen des Gesetzes sind Sie ein Massenmörder. Sie stecken genauso mit drinnen wie wir alle!«
Keller setzt sich auf das Bett und senkt den Kopf. Er hat recht, denkt er. Ich stecke mit drinnen, seit ich meine Seele an euch verkauft habe, um mich zu rächen. Ich habe gelogen und getäuscht, um mich bei meiner Jagd auf Adán Barrera eurer Mittel zu bedienen.
Er spürt, dass sich Hobbs neben ihn setzt. Der Mann wiegt so gut wie gar nichts - wie ein totes, welkes Blatt. »Gehen Sie mir nicht von der Fahne«, sagt Hobbs.
Keller nickt.
»Ich erwarte Ihre volle Unterstützung bei der Operation Colombia.«
»Die haben Sie, John.«
Keller geht in sein Zimmer zurück.
Er zieht sich aus. bis auf die Unterwäsche, macht sich einen Scotch, setzt sich auf die Pritsche und schwitzt. Der Ventilator kämpft vergebens gegen die Hitze an. Aber er gibt sein Bestes, denkt Keller. Kämpft für die gute Sache.
Ich bin nur das Feigenblatt in diesem verdeckten Krieg.
Der Krieg gegen die Drogen. Mein ganzes beschissenes Leben lang habe ich gekämpft. Und wofür?
Milliarden werden dafür ausgegeben, die Drogen von der durchlässigsten Grenze der Welt fernzuhalten. Vergeblich. Ein Zehntel des Budgets wird für Aufklärung und Therapien verwendet, neun Zehntel gehen in die polizeilichen Maßnahmen. Aber keiner hat das Geld, das Drogenproblem bei der Wurzel zu packen. Dann kommen noch die Milliarden, die es kostet, die Drogenkriminellen hinter Gittern zu halten, in Gefängnissen, die inzwischen so überfüllt sind, dass wir Mörder amnestieren müssen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass zwei Drittel aller »nicht drogenbezogenen« Straftaten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss begangen werden. Unsere Antwort lautet: Noch mehr Gefängnisse, noch mehr Polizei, noch mehr Milliarden, die nicht einmal die Symptome überdecken können, während wir die Krankheit ignorieren. Eine Therapie kann sich meist nur leisten, wer eine gute Krankenversicherung hat. Aber wer hat die schon? Auf einen öffentlich geförderten Therapieplatz wartet man bis zu zwei Jahren. Wir geben fast zwei Milliarden Dollar aus, um die Kokainfelder und die Menschen in Südamerika zu vergiften, aber das Geld für Therapien fehlt. Es ist der reine Irrsinn.
Eine Tragödie, eine blutige Farce, mit der Betonung auf blutig.
So viel Blut. So viele Leichen. So viele nächtliche Besucher. Zu den alten Bekannten und den Toten von El Sauzal kommen nun auch die Gespenster vom Rio Putumayo. Langsam wird es voll im Zimmer.
Er steht auf und geht ans Fenster, um Luft zu bekommen. Im Mondlicht sieht er einen Gewehrlauf glänzen. Blitzschnell lässt er sich fallen.
Eine Salve zerfetzt das Moskitogitter, den Fensterrahmen', durchlöchert die Wand über der Pritsche. Er drückt sich an den Boden, hört das Jaulen der Sirene, Trappeln von Stiefeln, Klappern von Gewehren, Geschrei, Durcheinander.
Seine Tür geht auf, herein kommt der Diensthabende mit gezückter Pistole.
»Sind Sie verletzt, Señor Keller?«
»Ich glaube nicht.«
»Keine Sorge, die kriegen wir.«
Zwanzig Minuten später sitzt Keller mit Hobbs im Messzelt beim Kaffee und versucht, seine Nerven zu beruhigen.
»Sind Sie immer noch so begeistert von den menschenfreundlichen Landreformern bei der FARC?«, fragt Hobbs trocken.
Wenig später kommt ein Offizier mit drei Soldaten herein - sie stoßen einen Halbwüchsigen vor sich her, der ängstlich, zitternd und offensichtlich misshandelt vor Keller zu Boden fällt. Keller blickt auf ihn hinab - der könnte Javiers Zwillingsbruder sein, denkt er. Nein, Scheiße. Mein eigener Sohn.
»Das ist einer von den Kerlen«, sagt der Offizier und tritt dem am Boden Liegenden ins Gesicht. »Die anderen sind entkommen.«
»Lassen Sie das«, sagt Keller.
»Wiederhol, was du gesagt hast«, befiehlt der Offizier, den Stiefel auf dem Kopf des Jungen. »Spuck's aus!« Der Junge fängt an zu reden.
Er ist kein Guerilla. Er kommt nicht von der FARC. Die würde es nicht wagen, einen Armeestützpunkt zu überfallen.
»Wir wollten uns nur die Prämie verdienert«, sagt der Junge. »Welche Prämie?«, fragt Keller. Der Junge erklärt es ihm.
Adán Barrera zahlt demjenigen, der Arthur Keller zur Strecke bringt, mehr als zwei Millionen Dollar.
»FARC und Barrera«, sagt Hobbs. »Ein und dasselbe.« Keller ist sich da nicht so sicher.
Er weiß nur, dass er Barrera töten muss - sonst tötet Barrera ihn.
Sinaloa, Mexiko
San Diego, Kalifornien
Auch Adán lebt mit Gespenstern.
Das Gespenst seines Bruders zum Beispiel beschützt ihn. In Mexiko glaubt man, dass Raúl das Massaker von El Sauzal verübt hat, dass die Gerüchte von seinem Tod nur ausgestreut werden, um ihn vor den Nachstellungen der Polizei zu schützen. Folglich wagt man nicht, gegen den anderen Barrera vorzugehen.
Aber Adán Barrera muss auch mit der Trauer über den Tod seines Bruders leben - und mit der Wut auf Keller, der ihn auf dem Gewissen hat. Sein Bruder muss gerächt werden; seine Seele findet keine Ruhe, bis Adán mit Keller abgerechnet hat.
Doch es verfolgt ihn noch ein weiteres Gespenst - das von Nora.
Er konnte es nicht glauben, als die Nachricht von ihrem Tod kam. Wollte es nicht glauben. Dann zeigten sie ihm den Zeitungsartikel, in dem die Amerikaner behaupteten, sie sei bei einem Autounfall auf der Rückreise von Ensenada ums Leben gekommen und in Kalifornien beerdigt worden - in einem geschlossenen Sarg, um zu vertuschen, dass sie ermordet worden war.
Ermordet von Keller.
Adán gab ihr ein würdiges Begräbnis in Badiraguato. Ein Kreuz mit ihrem Foto wurde durch die Stadt getragen, Musikanten besangen ihren Mut und ihre Schönheit. Er ließ ihr ein Grabmal aus feinstem Marmor errichten. Mit der Inschrift Tienes mi alma en tus manos.
Meine Seele liegt in deinen Händen.
Jeden Tag lässt er eine Messe für sie lesen, jeden Tag liegt Geld am Schrein von Santo Jesús Malverde, und jeden Tag liegen frische Blumen auf ihrem Grab in La Jolla, dafür sorgt ein mexikanischer Florist, der weiß, dass er nur beste Qualität liefern darf und dass die Rechnung pünktlich bezahlt wird. Auf diese Weise tröstet sich Adán ein wenig über seinen Verlust hinweg, aber er wird nicht ruhen, bis sie gerächt ist.
Er hat 2,1 Millionen Dollar demjenigen in Aussicht gestellt, der Keller tötet - hunderttausend mehr als die Summe, die die US-Regierung auf seinen Kopf ausgesetzt hat. Das ist eine Laune, sicher, aber auch eine Frage des Stolzes.
Und Geld spielt keine Rolle. Geld ist reichlich vorhanden.
Die vergangenen sechs Monate hat er damit verbracht, das ganze Kartell von Grund auf zu reorganisieren. Und das Verrückte nach all den Katastrophen des vergangenen Jahres: Er ist reicher und mächtiger als je zuvor.
Sein ganzes Netzwerk läuft jetzt über das Internet, so gut verschlüsselt, dass nicht einmal die Amerikaner es knacken können. Er gibt seine Anweisungen übers Internet, verwaltet seine Konten übers Internet, verkauft seine Ware übers Internet und kassiert übers Internet. In Sekundenbruchteilen wäscht er riesige Geldmengen, ohne auch nur einen Dollarschein oder Peso anzufassen.
Auch töten kann er per Internet. Und er tut es. Er muss nur eine E-Mail verschicken, schon verlässt das Opfer die reale Welt. Er muss sich nicht am Tatort blicken lassen. Das wäre leichtsinnig und albern.
Ich bin selbst zum Gespenst geworden, denkt er, ich existiere nur noch im Cyberspace.
Für seine leibliche Existenz benötigt er nur ein bescheidenes Haus bei Badiraguato. Es ist schön, wieder in Sinaloa zu leben, auf dem Lande, mitten unter den Campesinos. Der Boden hat sich inzwischen erholt, der Mohn blüht wieder in den herrlichsten Farben: rot, orange und gelb.
Und das ist gut, denn Heroin ist wieder angesagt.
Zum Teufel mit den Kolumbianern, der FARC, den Chinesen und all dem Ärger. Der Kokainmarkt schwächelt ohnehin, das gute alte mexikanische Rohopium ist wieder gefragt, die Mohnkapseln weinen wieder, diesmal vor Freude. Die Gomeros sind wieder an der Arbeit, und ich bin der patrón.
Sein Leben verläuft in ruhigen Bahnen. Er steht früh auf und trinkt einen café con leche, den ihm die alte Haushälterin bringt, dann setzt er sich an den Computer, um seine Finanzen zu verwalten, das Geschäft zu beaufsichtigen, Anweisungen zu geben. Zu Mittag bekommt er eine kalte Fleischplatte mit Obst, und nach einer kurzen Siesta macht er einen Spaziergang auf dem alten Feldweg, der an seinem Haus vorbeiführt.
Manuel geht mit ihm, stets auf der Hut, als wäre Adán noch immer in Gefahr. Natürlich ist er froh, wieder in Sinaloa zu leben, bei seiner Familie und seinen Freunden, trotzdem besteht er darauf, in seiner kleinen casita hinter dem Haupthaus zu wohnen.
Nach dem Spaziergang kehrt Adán an den Computer zurück und arbeitet bis zum Abendessen. Er genehmigt sich ein oder zwei Bier und schaut Fußball oder Boxen im Fernsehen. An manchen Abenden sitzt er auch draußen auf dem Rasen und lauscht den Gitarrenklängen, die von der Ortschaft zu ihm herüberwehen. Wenn es sehr still ist, versteht er sogar die Gesänge - sie handeln vom Verrat von el Tiburón, von Rauls Heldentaten und vom listigen Adán Barrera, der den Federales und den Yankees ein Schnippchen geschlagen hat, den sie niemals fangen werden.
Er geht früh zu Bett.
Es ist ein ruhiges Leben, ein gutes Leben, und es könnte ein glückliches Leben sein, wenn die Gespenster nicht wären.
Das Gespenst von Raúl.
Das Gespenst von Nora.
Das Gespenst seiner weit entfernten Familie.
Mit Gloria verständigt er sich per Internet. Das ist die einzige sichere Methode, aber es schmerzt, dass sich seine Tochter für ihn zu ein paar Pixeln auf dem Bildschirm reduziert. Sie chatten fast jeden Abend, und sie schickt ihm ihre Fotos. Aber er kann sie nicht sehen, kann sie nicht hören - auch daran ist Keller schuld.
Und wenn er ehrlich ist, verfolgen ihn noch mehr Gespenster.
Sie kommen, wenn er sich hinlegt und die Augen schließt.
Er sieht die Gesichter von Gúeros Kindern, sieht ihre Körper auf den Felsen aufschlagen. Hört ihre Stimmen im Wind. Und keiner, denkt er, singt darüber Lieder. Keiner fasst dieses Geschehen in Musik.
Auch über El Sauzal gibt es keine Lieder, aber die Gespenster kommen trotzdem.
Und Padre Juan.
Er kommt am häufigsten.
Mit sanftem, mahnendem Blick. Ich kann nichts dagegen tun, sagt sich Adán. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich tun kann.
Was ich tun muss.
Art Keller erledigen.
Er ist mitten im Planen und Organisieren, als seine Welt zusammenbricht. Er will nur nachschauen, ob eine E-Mail von Gloria gekommen ist. Aber die E-Mail kommt von seiner Frau, und wenn eine E-Mail schreien kann, dann diese.
Adán - Gloria hatte einen Schlaganfall. Sie liegt im Sripps Mercy Hospital.
Mein Gott, was ist passiert?
Ungewöhnlich, aber keineswegs ausgeschlossen bei ihrem Zustand. Der Druck auf die Halsschlagader war einfach zu groß geworden. Als Lucia in ihr Zimmer kam, fand sie Gloria bewusstlos. Die Sanitäter konnten nichts ausrichten, und jetzt liegt sie auf der Intensivstation, sie wird untersucht, aber die Prognose ist niederschmetternd.
Wenn kein Wunder geschieht, muss Lucia bald eine schwierige Entscheidung treffen. Nein, das lasse ich nicht zu.
Adán -
Tu's nicht.
Es gibt keine Hoffnung. Selbst wenn sie es schafft, wäre sie –
Sag's nicht.
Du bist ja nicht hier. Ich habe mit meinem Pfarrer geredet. Er sagt, es ist moralisch vertretbar. Was dein Pfarrer sagt, ist mir egal. Adán -
Ich komme heute. Abend. Spätestens morgen früh. Sie wird dich nicht erkennen, Adán. Sie merkt nicht, ob du da bist oder nicht. Aber ich.
Na gut. Ich warte auf dich. Wir entscheiden gemeinsam.
Zwölf Stunden später sitzt Adán in seinem Penthouse am Grenzübergang von San Ysidro. Er verfolgt das Geschehen mit dem Nachtsichtgerät und wartet darauf, dass der bestochene mexikanische Grenzbeamte zeitgleich mit seinem bestochenen amerikanischen Kollegen den Dienst antritt.
Gegen zweiundzwanzig Uhr müsste das passieren, und wenn nicht, wird er den Übergang trotzdem wagen.
Er hofft einfach, dass es klappt.
Trotzdem geht er kein unnötiges Risiko ein; er muss zu Gloria ins Krankenhaus, also wartet er auf den Schichtwechsel am Grenzübergang, bis das Handy klingelt. Eine Zahl erscheint auf dem Display.
Die Sieben. Es kann losgehen.
Zwei Minuten später steht er unten im Parkhaus vor einem Lincoln Navigator, der am Vormittag in Rosarita gestohlen und mit neuen Nummernschildern versehen wurde. Der nervöse Fahrer hält ihm die hintere Tür auf. Der kann nicht älter als dreiundzwanzig sein, denkt Adán. Er sieht seinen Angstschweiß und seine zitternden Hände und fragt sich, ob der Mann nur nervös ist oder ob er etwas im Schilde führt. Vorsichtshalber sagt er: »Du weißt, wenn du mich reinlegst, stirbt deine ganze Familie.«
»Ja.«
Adán steigt ein, während ein anderer Mann, wahrscheinlich der Bruder des Fahrers, das Rücksitzpolster hochklappt und einen Hohlraum freilegt. Adán kriecht hinein, stülpt das Atemgerät über Nase und Mund und testet seine Atmung, während das Polster wieder befestigt wird. Er liegt im Dunkeln und hört das Jaulen des elektrischen Schraubenziehers.
Jetzt ist er eingesperrt.
Das Ganze erinnert zu sehr an einen Sarg.
Er unterdrückt eine Aufwallung von Panik und zwingt sich, langsam und gleichmäßig zu atmen. Du darfst nicht hyperventilieren, schärft er sich ein, sonst reicht die Luft nicht. Laut Radioansage beträgt die Wartezeit an der Grenze gegenwärtig fünfundvierzig Minuten, aber die Wartezeit kann sich auch hinziehen, und dann müssen sie noch ein paar Minuten fahren, bis zu einer einsamen Gegend, wo sie ihn befreien.
Wenn alles gutgeht.
Wenn das keine Falle ist.
Um sich eine riesige Belohnung zu holen, sagt er sich, müssen sie nur zum nächsten Polizeirevier fahren. Guckt mal, wen wir hier haben. Oder schlimmer noch, sie handeln im Auftrag eines seiner vielen Feinde, dann müssen sie nur in einen einsamen Canyon fahren und das Auto einfach stehen lassen. Bis du erstickst oder in der Hitze gegart wirst wie ein Backhühnchen. Oder sie schieben einen Lappen in die Tanköffnung, zünden ihn an und...
Hör auf mit diesen Phantasien, ermahnt er sich.
Beruhige dich lieber damit, dass die Vorbereitungszeit für einen Anschlag viel zu kurz war, dass dich die Grenzer einfach durchwinken werden, dass du in drei Stunden bei Gloria bist und ihre Hand hältst.
Und vielleicht macht sie dann die Augen auf. Vielleicht geschieht ein Wunder.
Also atmet er ganz ruhig und gleichmäßig und fasst sich in Geduld.
In einem Sarg dauert jede Minute eine Ewigkeit.
Er hat genug Zeit zum Nachdenken.
Über seine sterbende Tochter.
Über Kinder, die von der Brücke stürzen.
Über die Hölle.
Jede Menge Zeit.
Dann hört er Gesprächsfetzen - der Grenzbeamte stellt Fragen. Wie lange waren Sie in Mexiko? Was war Ihr Reisegrund? Haben Sie etwas dabei? Darf ich mal hinten hineinschauen?
Adán hört die Wagentür klappen.
Das Auto fährt wieder.
Er merkt es am leichten Rütteln. Vielleicht ist es Einbildung, aber die Luft in diesem engen Sarg kommt ihm kühler vor, während das Auto an Fahrt gewinnt.
Dann bremst es ab, und es folgt ein kräftiges Holpern, bevor es zum Stillstand kommt. Adán umklammert den Pistolengriff und wartet. Wenn das eine Falle ist, kommt jetzt der entscheidende Moment: Der Deckel geht auf, und die Gewehrläufe richten sich auf ihn.
Oder, denkt er schaudernd, sie lassen ihn einfach liegen.
Oder zünden ein Streichholz an.
Dann hört er wieder den Schraubenzieher, der Sitz wird hochgeklappt, seine Fahrer strahlen ihn an. Adán reißt sich die Atemmaske herunter und streckt ihnen die Hand entgegen, um sich heraushelfen zu lassen.
Mit steifen Gliedern steht er am Rand des staubigen Weges und sieht den weißen Lexus, der ein paar Schritte weiter wartet. Wieder so ein grinsender Typ voller Tattoos, der ihm ein Schlüsselbund überreichen will.
»Du startest den Wagen«, sagt Adán.
Du fliegst in die Luft, wenn die Bombe hochgeht.
Der Kerl wird bleich, aber er nickt, steigt ein und startet den Motor.
Als der leise vor sich hin schnurrt, steigt der Tätowierte aus - kichernd vor Erleichterung.
Adán setzt sich ans Steuer. »Wo sind wir hier?«, fragt er.
Sie erklären ihm, wie er zum Freeway kommt, und fünfzig Minuten später fährt er auf den Parkplatz des Krankenhauses.
Adán überquert den Parkplatz und stellt sich vor, dass er aus Dutzenden Augen beobachtet wird.
Aber keiner steigt aus, keine Männer mit blauen DEA-Anoraks rennen auf ihn zu. Das ist ein ganz gewöhnlicher, eher ein wenig zu ruhiger Krankenhausparkplatz. Er geht zum Empfang und erfährt, dass seine Tochter in der achten Etage liegt.
Die Fahrstuhltür öffnet sich.
Lucia sitzt auf einer Bank im Flur, gebeugt, in Tränen aufgelöst. Er legt den Arm um sie. »Komme ich zu spät?« Unfähig zu sprechen schüttelt sie den Kopf. »Ich will sie sehen«, sagt Adán. Er öffnet die Tür zu ihrem Zimmer und geht hinein. Art Keller schiebt ihm die Pistole unter die Nase. »Hallo, Adán.«
»Meine Tochter -«
»Ihr geht's gut.«
Adán spürt einen Stich im Rücken, dann wird es dunkel um ihn.
Zusammen mit Shag Wallace legt er den bewusstlosen Adán auf eine Bahre. Sie bringen ihn in die Pathologie, legen ihn in einen Leichensack, schnallen ihn gut fest und rollen ihn hinaus zu dem Van mit der Aufschrift Hidalgo Bestattungen. Fünfundvierzig Minuten später befindet sich Adán an einem sicheren Ort.
Es war relativ leicht, Lucia zum Verrat an ihrem Mann zu zwingen, und vielleicht das Widerwärtigste, was Keller je in seinem Leben getan hat.
Sie haben sie monatelang beschattet, ihr Haus überwacht, das Telefon angezapft, das Handy abgehört, haben versucht, die Passwörter zu knacken, mit denen Adán seine E-Mails verschlüsselt.
Doch am Ende reichte ein einfaches Rechenmanöver, um Lucia in die Enge zu treiben.
Sie nahmen sich ihre Konten vor.
Lucia konnte ihre Einkünfte nicht belegen. Ende der Geschichte. Sie ging nicht arbeiten, aber sie lebte im Luxus.
Keller passte sie ab, als sie aus einem Gourmetgeschäft im teuersten Viertel von Rancho Bernardo kam. Sie sieht immer noch gut aus, dachte er, als er sie mit dem Einkaufswagen herauskommen sah. Ihr Körper Pilates-gestählt, ihr Haar in abgestuften Bernsteintönen gestylt.
»Mrs. Barrera?« .
Sie reagierte erschrocken, dann fast müde.
»Ich benutze meinen Mädchennamen«, sagte sie, als er ihr die DEA-Marke zeigte. »Über die Tätigkeit und den Aufenthalt meines Mannes kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Wenn Sie mich entschuldigen wollen? Ich muss meine Tochter abholen.«
»Sie ist sehr gut in der Schule, nicht wahr?«, fragte Keller und kam sich vor wie ein Stück Dreck. »Chor, Leistungskurs Mathe und Englisch. Darf ich fragen, wie Ihre Tochter zurechtkommen wird, wenn Sie im Gefängnis sitzen?«
Er ließ sie ins offene Messer laufen, mitten auf dem Parkplatz des Gourmetgeschäfts, und eröffnete ihr die Alternativen: Im günstigen Fall eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung, im ungünstigsten eine Haftstrafe zwischen dreißig Jahren und lebenslänglich wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenkriminalität - für die Beweise werde er sorgen.
»Ich nehme Ihnen das Haus weg, Ihre Autos, Ihre Konten«, sagte Keller. »Sie sitzen im Bundesgefängnis, und Gloria lebt von der Sozialhilfe. Glauben Sie, dass die Notfallversorgung für sie ausreicht? Medizinisch versorgt wird sie in der Notfallambulanz, wo sie sich morgens in die Schlange stellen muss und wo sich nur die besten Ärzte um sie kümmern ...«
Tolle Leistung, sagte er sich. Ein schwerkrankes Kind als Brechstange zu benutzen. Doch er zwang sich, an das tote Baby in El Sauzal zu denken, an das tote Baby in den Armen seiner toten Mutter.
Sie suchte in ihrer Handtasche nach dem Handy. »Ich rufe meinen Anwalt an.«
»Bestellen Sie ihn gleich ins Bundesgefängnis San Diego, denn dort fahren wir jetzt hin. Ich schicke jemanden los, der Gloria von der Schule abholt und ihr erklärt, dass ihre Mutter verhaftet worden ist. Sie kommt ins Heim, dort wird sie viele neue Freunde finden.«
»Sie sind die schäbigste Kreatur unter der Sonne.«
»Nein«, sagte Keller, »die zweitschäbigste. Mit der schäbigsten sind Sie verheiratet. Sie nehmen sein Geld, aber Sie fragen nicht, wo es herkommt. Möchten Sie ein paar Fotos sehen, damit Sie wissen, wie er Ihren Haushalt finanziert? Ich hab welche im Auto.«
Lucia fing an zu weinen. »Meine Tochter ist sehr krank. Sie hat viele Gesundheitsprobleme, die ... sie würde das nicht überleben ...«
»Ohne ihre Mutter«, ergänzte Keller. »Ich verstehe.« Er ließ ihr eine Weile Bedenkzeit.
Sie trocknete ihre Augen, gab sich einen Ruck. »Sagen Sie mir, was ich tun soll.«
Jetzt tippt Keller gerade etwas in seinen Laptop und blickt zu Adán hinüber, der mit Handschellen ans Bett gekettet ist. Adán öffnet die Augen, er kommt zu sich und begreift, das ist kein Alptraum, das ist Wirklichkeit.
Als er Keller erkennt, sagt er: »Ich staune, dass ich noch lebe.«
»Ich auch.«
»Warum hast du mich nicht erschossen, Cousin?«
Weil ich es satt habe, sagt sich Keller. Es widert mich an, dieses sinnlose Blutvergießen. Doch er antwortet: »Ich habe Besseres mit dir vor. Kennst du das Bundesgefängnis von Marion, Illinois? Dreiundzwanzig Stunden an Tag bist du allein in deiner Fünfquadratmeterzelle, aus der du nicht mal rausgucken kannst. Eine Stunde Hofausgang, allein zwischen engen Mauern, mit Stacheldraht und einem schmalen Streifen Himmel über dir. Zweimal die Woche zehn Minuten duschen. Deinen Häftlingsfraß kriegst du durch die Luke geschoben, du schläfst auf einer Metallpritsche, mit dünner Decke, das Licht brennt rund um die Uhr. Du hockst wie ein Tier auf deiner Kloschüssel, im Gestank deiner Scheiße, und ich werde nicht für die Todesstrafe plädieren, sondern für lebenslänglich ohne Recht auf Begnadigung. Wie alt bist du jetzt? Mitte vierzig? Ich wünsche dir ein langes Leben.«
Adán fängt an zu lachen. »Jetzt kommst du mir mit dem Gesetz? Du willst mich vor Gericht stellen? Viel Glück, viejo. Du hast nicht mal Zeugen.«
Er lacht und lacht und lacht und ist nur ein bisschen verdutzt, als auch Keller zu lachen anfängt. Keller dreht den Monitor zu ihm um und tippt auf ein paar Tasten.
»Überraschung, du Arschloch«, sagt Keller.
Adán schaut auf den Monitor und sieht ein Gespenst.
Nora im Sessel sitzend, in der Hand eine Illustrierte. Sie schaut ungeduldig auf die Uhr und wendet sich wieder der Lektüre zu.
»Das ist live«, sagt Keller und schaltet den Monitor ab. »Glaubst du etwa, sie hält dicht? Weil sie dich so sehr liebt? Glaubst du, sie verbringt den Rest ihres Lebens hinter Gittern, damit du ungeschoren davonkommst?«
»Ich würde mein Leben für sie opfern.«
»Klar würdest du das. Du bist der wahre Edelmensch!«
Keller sieht, wie es in ihm arbeitet, wie er eine neue Strategie entwickelt.
»Wir könnten einen Deal auskochen«, sagt Adán.
»Womit willst du dealen?«, fragt Keller. »Du selbst bist die Trumpfkarte, Adán. Das ist das Problem. Du hast keine Trümpfe zu bieten.«
»Red Cloud.«
»Was?«
»Red Cloud«, wiederholt Adán. »Kennst du nicht? Nein, woher auch. Du bist ja Amerikaner. Nicht nur an den Drogen, die ihr kauft, klebt Blut, Auch an eurem Öl, eurem Kaffee, eurer Politik. Es gibt nur einen einzigen Unterschied zwischen dir und mir: Ich weiß, was ich tue.«
Adán hat natürlich Kopien von den Papieren in Paradas Aktenkoffer gemacht, nur ein Idiot hätte darauf verzichtet. Die Kopien lagern in einem Schließfach auf den Caymans, und was sie enthalten, kann zwei Regierungen zu Fall bringen. Einzelheiten über Operation Kerberos, über die Mitwirkung der Federación bei der Finanzierung der Contras mit Drogengeldern, über Operation Red Cloud, die gezielte Ermordung linker Politiker in Lateinamerika, finanziert mit Geldern aus Washington, aus Mexico City, mit Geldern der Drogenkartelle. Es gibt Beweise für die Ermordung zweier mexikanischer Regierungsbeamter im Zusammenhang mit der Fälschung der Präsidentschaftswahlen und Beweise für die aktive Zusammenarbeit der mexikanischen Regierung mit der Federación.
Das alles steckte im Aktenkoffer. Aber Adán weiß noch mehr. Er weiß Bescheid über die Ermordung Colosios und über Kellers Meineid vorm Kongress, als er zu Operation Kerberos aussagen sollte. Möglich also, dass ihn Keller zeitlebens hinter Gitter bringen kann, doch sicher ist es nicht.
Adán erklärt ihm den Deal: Wenn sie nicht binnen sechsunddreißig Stunden zu einer einvernehmlichen Lösung kommen, lässt er dem Senatsunterausschuss ein Paket mit Tonbändern und Dokumenten übergeben.
»Möglich, dass ich im Bundesgefängnis lande«, sagt Adán. »Aber genauso möglich ist es, dass wir Zellennachbarn werden.«
Von wegen, ich hätte keine Trümpfe zu bieten. Ich kann die ganze US-Regierung zu Fall bringen. »Was willst du haben?«, fragt Keller. »Eine neue Identität.« Für mich. Und für Nora.
Keller mustert ihn stumm. Lange. Adán lächelt sein undurchdringliches Lächeln.
Dann sagt Keller: »Fahr zur Hölle.«
Er ist ja froh, dass Adán die Beweise besitzt. Er ist froh, wenn das alles hochkommt. Es ist Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt, auch wenn sie bitter schmecken wird.
Du denkst, ich hab Angst vorm Gefängnis, Adán?
Was glaubst du, wo ich mich befinde?
Nora legt die Illustrierte weg und läuft im Zimmer auf und ab. Das tut sie nun schon seit Monaten. Erst während der Schlafmittelentwöhnung, dann, als es ihr besser ging, aus schierer Langeweile.
Hundertmal hat sie verlangt, entlassen zu werden, hundertmal hat Braunauge abgelehnt, immer mit derselben Begründung.
»Zu gefährlich.«
»Wieso? Bin ich eine Gefangene?«
»Sie sind keine Gefangene.«
»Dann will ich gehen.«
»Das ist zu gefährlich.«
Seine Augen waren das Erste, was sie sah, als sie wieder zu sich kam, nach der schrecklichen Nacht an der Cortez-See. Sie lag in einem Motorboot, öffnete die Augen und sah direkt in seine braunen Augen, die sie neugierig musterten, nicht mit kalter Gier, wie sie es gewöhnt war, sondern mit Anteilnahme.
Zwei sanfte braune Augen.
Und sie kehrte ins Leben zurück.
Sie wollte etwas sagen, aber er legte den Finger auf den Mund, als müsste er ein Kind beruhigen. Sie wollte sich bewegen, doch es ging nicht, sie war fest eingepackt wie in einen zu engen Schlafsack. Dann strich er ihr behutsam mit der Hand über die Augen, und sie schlief wieder ein.
Selbst jetzt hat sie nur vage Erinnerungen an jene Nacht. Ein bisschen kommt sie sich vor wie die Leute in den Talkshows, die behaupten, sie seien von Aliens entführt worden. Nur die Körpersonden und die medizinischen Experimente fehlen. Doch an die Spritze kann sie sich erinnern und dass sie in diesen Sack gesteckt wurde, aber keine Angst hatte, als der Reißverschluss zugezogen wurde, bis ganz oben, bis sie nichts mehr sah, denn atmen konnte sie weiter.
Sie erinnert sich, dass sie auf ein größeres Boot gebracht wurde, dann in ein Flugzeug, wo sie wieder eine Spritze bekam, und aufgewacht ist sie dann in diesem Zimmer.
Unter seinen Augen.
»Ich sorge hier für Ihre Sicherheit.« Mehr war nicht aus ihm rauszuholen, nicht mal sein Name, also nannte sie ihn Braunauge. Später an diesem ersten Tag bekam sie einen Anruf von Art Keller.
»Es ist nur vorübergehend«, versprach er ihr. »Wo ist Adán?«, fragte sie.
»Er ist entkommen, aber Raúl haben wir erwischt. Wir sind ziemlich sicher, dass er tot ist.«
So wie du, fügte Keller an und erläuterte seinen Plan. Obwohl sie Fabián Martínez den Verrat angehängt hatten, war es sicherer für sie, wenn jeder - und vor allem Adán - glaubte, sie sei tot. Sonst würde er alles daransetzen, Kontakt zu ihr aufzunehmen - oder sie ermorden zu lassen. Wir werden bekanntgeben, dass du bei einem Autounfall ums Leben gekommen bist, sagte Keller. Adán wird natürlich vermuten, dass du beim Sturm auf das Strandhaus umgekommen bist, und die Geschichte vom Unfall als Schwindel auffassen.
Und genau das soll er.
Als Braunauge ihr die Todesanzeige brachte, war das ein seltsames Gefühl. Ein kurzer Nachruf, in dem sie als »Event-Managerin« bezeichnet wurde, dann Ort und Datum der Beerdigung. Sie fragte sich, wer wohl zur Trauerfeier erschienen war. Ihr Vater wahrscheinlich, wie immer bekifft, ihre Mutter bestimmt - und Haley.
Und das war es sicher auch schon.
Inzwischen ist aus ihrem vorübergehenden Verschwinden ein Dauerzustand geworden.
Keller ruft jede Woche an, erzählt ihr, dass er immer noch hinter Adán her ist, dass er gern auch persönlich vorbeikommen würde, es sei aber zu gefährlich für sie. Das ist sein Mantra, denkt Nora. Es ist zu gefährlich, spazieren zu gehen, zu gefährlich, zum Einkaufen oder ins Kino zu fahren. Oder irgendein normales Leben zu führen.
Jedes Mal, wenn sie Braunauge fragt, bekommt sie dieselbe Antwort. Er schaut sie mit seinen Hundeaugen an und sagt: »Es ist zu gefährlich. Sagen Sie mir, was Sie brauchen, ich besorge es.«
Damit sie nicht vor Langeweile stirbt, denkt sie sich immer kompliziertere Aufträge für ihn aus. Sie lässt ihn nach bestimmten, schwer erhältlichen und teuren Kosmetikartikeln suchen, beschreibt die Designersachen, die er in einer bestimmten Boutique besorgen soll, auf eine so verworrene und umständliche Manier, dass ein Mann unmöglich etwas damit anfangen kann.
Aber er bringt ihr alles, nur in ihre Lieblingsboutique nach La Jolla fährt er nicht. »Keller sagt, dort darf ich nicht hin«, entschuldigt er sich. Das ist zu -«
»- gefährlich«, beendet sie den Satz für ihn und lässt ihn zur Strafe Reizwäsche und Damenartikel kaufen. Sie hört, wie er sein Motorrad startet und davonbraust, und weidet sich an der Vorstellung, dass er schamrot und verlegen durch »Victoria's Secret« stolpert und die Verkäuferin um Hilfe bitten muss.
Aber sie ist nicht wirklich froh, wenn er weg ist, weil er sie dann mit den anderen Bodyguards allein lässt. Sie tut weiter so, als würde sie deren Namen nicht kennen, obwohl sie jedes Wort versteht, wenn sie sich unterhalten. Der Ältere, den sie Mickey nennen, ist ganz nett, er bringt ihr immer Tee. O-Bop, der Typ mit dem brandroten Haar, ist einfach nur seltsam. Er schaut sie immer an, als wollte er sie flachlegen, woran sie aber gewöhnt ist. Wer ihr wirklich Angst macht, ist der Dritte. Der Dicke, der ständig Pfirsiche aus der Büchse frisst.
Big Peaches.
Oder Jimmy Piccone.
Er tut, als würde er sie nicht kennen - und sie auch. Aber ich kenne ihn genau, sagt sie sich. Mein erster richtiger Kunde. Brutal und hässlich. Hat mich benutzt wie einen Scheuerlappen. Diesen Abend vergesse ich nie. Auch an Callan erinnert sie sich.
Dafür brauchte sie ein bisschen länger, weil sie anfangs viel zu erschöpft war. Aber es war Callan - Braunauge -, der sie von den Tabletten entwöhnt hat, der ihr Eiswürfel zu lutschen gab, wenn sie Durst hatte, aber nichts im Magen behielt, der ihr übers Haar strich, wenn sie sich übers Toilettenbecken krümmte, ihr allen möglichen Unsinn erzählte, wenn sie keinen Schlaf fand, manchmal die ganze Nacht mit ihr Karten spielte, sie zum Essen überredete, ihr Hühnerbrühe mit Toast brachte und extra losfuhr, Tapioka-Pudding besorgen, bloß weil sie den Namen lustig fand.
Erst als sie weitgehend entgiftet war und sich viel besser fühlte, wurde ihr klar, dass sie sich schon einmal begegnet waren.
Mein Debüt als Hure. Ihn wollte ich als meinen ersten Freier, weiß sie inzwischen. Weil er so sanft aussah und weil mir seine braunen Augen gefielen.
»Ich erinnere mich an Sie«, hatte sie gesagt, als er mit dem Essen hereinkam, einer Banane mit einer Scheibe Toast.
Er wirkte überrascht. Und sagte schüchtern: »Ich mich an Sie auch.«
»Das ist lange her.«
»Sehr lange.«
»Eine Menge ist seitdem passiert.«
»Tja.«
Obwohl sie sich furchtbar langweilt, ging es ihr also gar nicht so schlecht in der »Gefangenschaft«, wie sie es nannte. Sie konnte fernsehen und Radio hören, hatte einen Walkman, eine Sammlung CDs, eine Menge Bücher und Zeitschriften, und sie richteten ihr sogar einen kleinen Fitnessbereich hinter dem Haus ein, Callan und Mickey bauten einen Bretterzaun, obwohl kein anderes Haus in der Nähe war, sie fuhren los und kauften ein Laufband und einen Hometrainer. Sie konnte also trainieren, fernsehen, lesen, und es ging ihr gar nicht so schlecht, bis sie eines Abends im Bett saß und eine Sondersendung über den Drogenkrieg sah - mit Bildern des Massakers von El Sauzal.
Ihr stockte der Atem, als der Sprecher die Vermutung äußerte, die ganze Familie von Fabián Martínez sei abgeschlachtet worden, weil er als Informant der DEA aufgeflogen sei. Sie zitterte am ganzen Leibe, als sie die auf dem Hof verstreuten Leichen sah, und Callan musste sie sofort mit Keller verbinden.
»Warum hast du mir das nicht erzählt?«, schrie sie in den Hörer.
»Weil ich dir das lieber ersparen wollte.«
»Das hättest du mir sagen müssen ... das hättest du mir sagen müssen.«
Sie weinte, bekam einen Zusammenbruch und versank in Depressionen. Rollte sich im Bett zusammen und stand nicht mehr auf.
Neunzehn Tote, ging es ihr immer wieder durch den Kopf. Frauen, Kinder, ein Säugling sogar. Alles meinetwegen.
Ihre Bewacher waren ratlos. Callan kam zu ihr ins Zimmer und blieb an ihrem Fußende sitzen wie ein Hund, er sagte nichts, tat nichts, saß einfach nur da, als könnte er sie auf diese Weise davor schützen, dass sie sich innerlich in Stücke riss.
Aber das konnte niemand.
Sie lag einfach nur da.
Dann eines Tages brachte ihr Callan mit feierlicher Miene das Telefon. Es war Keller, und Keller sagte nur: »Wir haben ihn.«
Auch John Hobbs und Sal Scachi reagieren auf Adáns Festnahme.
»Es wäre besser gewesen, Arthur hätte ihn liquidiert«, sagt Hobbs.
»Jetzt haben wir ein Problem«, sagt Scachi.
»Das kann man wohl sagen. Wir sitzen ganz schön in der Patsche. Ich fürchte, wir müssen etwas unternehmen.«
Ein toter Adán Barrera ist eine Sache. Ein lebender Adán Barrera, der plaudert, gar noch vor Gericht, eine ganz andere. Und Arthur Keller ist völlig unberechenbar geworden. Nein, es ist an der Zeit, zu handeln.
John Hobbs geht ans Telefon und ruft in Venezuela an.
Sal Scachi macht sich an die Arbeit.
Der Teekessel pfeift. Laut und schrill.
»Schalte das verdammte Scheißteil ab!«, brüllt Peaches. »Du und dein beschissener Tee!«
Mickey nimmt den Kessel vom Herd.
»Lass ihn in Ruhe«, sagt Callan.
»Waas?«
»Ich sagte, du sollst ihn nicht anblöken.«
»Hey«, sagt O-Bop. »Hier herrscht ja eine Stimmung!« Kein Wunder, denkt Peaches. Seit Monaten hocken wir in dieser Bude mitten in der Einöde und bewachen Barreras verfickte Nutte. »Mickey, tut mir leid, dass ich dich angebrüllt habe, okay?« Peaches wendet sich an Callan. »Okay?« Callan sagt nichts.
»Ich bringe ihr den Tee«, sagt Mickey.
»Wer bist du denn, verdammt? Ihr Butler?«, fragt Peaches. Er will nicht, dass Mickey sich in diese Frau verguckt. Männer, die lange im Knast waren, vergucken sich in jede Frau, werden sentimental bei jedem Lebewesen, das ihnen nicht gerade übelwill - bei Mäusen, Vögeln und dergleichen. Peaches hat alte Knastbrüder erlebt, denen die Tränen kamen, wenn eine Schabe eines natürlichen Todes starb. »Lass doch O-Bop gehen. Der sieht aus wie ein Kellner. Nein, besser noch, Callan geht.«
Callan weiß, was Peaches denkt. »Warum bringst du den Tee nicht rein?«, sagt er.
»Ich hab dich gebeten«, sagt Peaches.
»Jetzt wird er langsam kalt«, meint Mickey.
»Nein, hast du nicht«, sagt Callan. »Du hast befohlen.«
»Mr. Callan«, sagt Peaches. »Dürfte ich Sie bitten, der jungen Dame den Tee zu servieren?«
Callan nimmt die Tasse und geht los.
»Gott, was für'n Scheiß, das Ganze hier!«, sagt Peaches.
»Erst anklopfen«, mahnt Mickey.
»Das ist eine Nutte«, sagt Peaches. »Die darf wohl keiner nackt sehen, oder was?«
Er geht raus auf die Veranda, schaut schon wieder zu den kahlen, vom Mondlicht beschienenen Hügeln hinüber und fragt sich, wie er so tief sinken konnte, dass er nun auf eine Nutte aufpassen muss.
Callan kommt zu ihm raus. »Was ist denn los, verdammt? Hast du schlechte Laune?«
»Barreras Nutte«, sagt Peaches. »Sollen wir die etwa zurückgeben? Der müsste man die Hände abhacken - und dann bei ihm abliefern.«
»Sie hat dir nichts getan.«
»Du willst sie doch bloß ficken«, sagt Peaches. »Weißt du was? Wir teilen sie uns.«
Callan nickt ganz langsam. »Hey, Jimmy? Wenn du sie anfasst, kriegst du zwei Schuss zwischen die Augen. Hätte ich eigentlich schon vor Jahren machen müssen, als ich deinen fetten Arsch zum ersten Mal sah.«
»Willst du Zoff? Kein Problem!«
Jetzt kommt auch Mickey raus und geht dazwischen. »Hört auf, ihr Idioten. Hier ist sowieso bald Schluss.« Nein, denkt Callan. Jetzt ist Schluss.
Er kennt Peaches, er weiß, was kommt. Was der sich in den Kopf setzt, macht er auch, egal wie. Und er weiß, wie Peaches tickt: Bringt Barrera einen von meinen Leuten um, bring ich einen von seinen Leuten um.
Callan geht wieder hinein, vorbei an O-Bop, klopft an Noras Tür und macht sie auf. »Komm«, sagt er.
»Wohin?«, fragt Nora.
»Komm schon. Zieh die Schuhe an. Wir hauen ab.«
Sein Ton macht sie stutzig. Er ist nicht mehr nett oder schüchtern. Er ist wütend, grob, kommandiert sie herum. Das mag sie nicht, also nimmt sie sich Zeit beim Schuhanziehen, nur um ihm zu zeigen, dass sie sich so was nicht bieten lässt.
»Mach schon, beeil dich.«
»Reg dich ab.«
»Ich bin die Ruhe selbst«, sagt Callan. »Setz deinen Arsch in Gang, verstanden?«
Sie steht auf, funkelt ihn an. »Welchen Gang hättest du denn gern?«
Als er sie beim Handgelenk packt und aus der Tür zieht, ist sie geschockt. Er benimmt sich wie ein richtiges Arschloch, und das kann sie nicht leiden.
»Hey!«
»Ich hab nicht die Zeit, hier rumzumachen«, sagt Callan. Ich will's hinter mich bringen.
Sie versucht, ihre Hand wegzuziehen, aber sein Griff ist zu fest, und ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich von ihm ins benachbarte Zimmer zerren zu lassen.
»Bleib dicht hinter mir«, sagt Callan.
Er zieht seine 22er und richtet sie nach vorn. »Was ist denn los?«, fragt sie.
Er antwortet nicht, zerrt sie einfach ins andere Zimmer. »Hey, wohin des Wegs?«, fragt Peaches. »Wir fahren.«
Peaches will in seine Jackentasche greifen. »Oi-oh!«, macht Callan. Peaches überlegt sich's.
»Callan, was soll das?«, fragt O-Bop. Ganz vorsichtig wandert seine Hand zu dem Gewehr, das auf der alten Couch liegt.
»Zwing mich nicht, dir was zu tun, Stevie«, sagt Callan. Das wäre auch zu blöd, wo doch alles - die ganze Scheiße - damit angefangen hat, dass er versucht hat, O-Bop das Leben zu retten. »Ich will dir nicht weh tun.«
O-Bop will das offenbar auch nicht, also bleibt seine Hand, wo sie ist.
»Hast du dir das gut überlegt?«, fragt Mickey.
Nein, denkt Callan, ich hab mir gar nichts überlegt. Ich lasse bloß nicht zu, dass sich einer an dieser Frau vergreift. Er hält sie hinter sich fest und geht rückwärts aus der Tür, die Pistole auf seine alte Crew gerichtet. »Wer mir nachfährt, kriegt 'ne Kugel.«
»Spring auf«, sagt er zu ihr. Er steigt auf sein Motorrad. »Halt dich gut fest.«
Zum Glück tut sie das wirklich, denn er macht einen Sprungstart, schießt davon wie eine Rakete und lässt eine dicke Staubwolke zurück. Sie packt ihn fester, als er auf einem Sandweg steil bergauf fährt, mit schleuderndem Hinterrad, das im losen Sand keinen Halt findet. Er hält an, als er oben ist, auf einem flachen Buckel, der vom Santa-Ana-Wind leergefegt ist, ringsum niedriges Gestrüpp.
Er sagt noch einmal: halt dich fest, dann geht's weiter, den Berg hinab im freien Fall. Gejagt von Gewehrschüssen.
Callan achtet nicht auf sie, konzentriert sich aufs Fahren.
An der Baracke vorbei, an den Männern, die sich hinter Autos ducken, nach Gewehren greifen und in Deckung gehen, als Geschosse in die Scheiben einschlagen, aber sie kriegt das kaum mit, es geht alles zu schnell, sie hört auch nicht die Kugeln, die ihr um die Ohren fliegen, die wütenden Schreie. Sie sieht nur seinen Helm, während sie, den Kopf an seine Schulter presst und sich noch fester an ihn klammert. Als wäre sie im Windkanal, und der Luftstrom will sie von ihm fortreißen, weil er so irrsinnig schnell fährt.
Auf dieser Sandstraße. Es ist stockdunkel, sie rasen wie durch einen schwarzen Tunnel. Und sie weiß jetzt, sie fahren um ihr Leben, sie muss sich diesem Verrückten ausliefern, an seinen Rücken gepresst, unter sich den Weg, der sie durchrüttelt, in die Höhe wirft, und jetzt fliegt sie wirklich, hochgeworfen von einer Bodenwelle. Sie fliegt, sie fliegt mit ihm, die Sterne sind so schön, der Aufprall wird tödlich, sie werden sterben, ihr Blut wird in den Sand fließen, sich mit seinem Blut vermischen, aber noch fliegt sie mit ihm durch den Nachthimmel, bis zur krachenden Landung, das Motorrad schleudert, sie klammert sich an ihn, sie will nicht allein sterben, sie will mit ihm zusammen sterben, auf dieser endlos langen Rutschpartie ins Nirvana. Sie hat immer gedacht, man fliegt in den Himmel, aber nein, man fällt, fällt, fällt, sie umklammert ihn, umarmt ihn, lass mich nicht allein sterben, ich will nicht allein sterben, doch dann fängt sich die Maschine, sie sind wieder obenauf, rasen weiter, der Fahrtwind kühlt ihre Ohren, sein Lederrücken fühlt sich warm an. Er atmet tief durch, und sie könnte schwören, dass ihr Lachen das Dröhnen des Motors übertönt - oder ist es ihr Herz, was so dröhnt? Aber sie hört sich lachen, und sie hört ihn lachen, und dann wird es plötzlich glatt unter den Rädern, glatt und schwarz, sie haben die Asphaltstraße erreicht, den wunderschön glatten amerikanischen Asphalt.
Die Lichter des Highway strahlen golden in die Nacht.
Jimmy Peaches geht auf die Veranda hinaus.
Hat eine neue Dose aufgemacht, sich einen Löffel geholt, der Mond bildet eine hübsche silberne Sichel - eine gute Gelegenheit, mal gründlich nachzudenken.
Vielleicht hatte Callan, dieser irische Trickser, das von Anfang an geplant. Oder er hat es mit dieser Schlampe zusammen ausgeheckt, immer wenn er ihr Tee brachte. Sähe ihm ähnlich, war ja schon immer der einsame Wolf.
Sal wird sich nicht freuen. Er hat angerufen, seine Weisungen erteilt - er kommt zur Lagebesprechung, hat drauf bestanden, dass alle da sind. Na ja, Scachi wird Callan schon aufspüren und ihm zeigen, was es heißt, seine Freunde zu linken. Er stößt den Löffel in die Büchse.
Ein Stückchen Pfirsich wirbelt in die Luft.
Saft spritzt ihm auf die Brust.
Er blickt nach unten, staunt, dass der Saft rot ist wie ein Sonnenuntergang. Dass die auch solche Pfirsiche herstellen, hat er nicht gewusst. Seine Brust fühlt sich warm und klebrig an, und er fragt sich, warum die Sonne an diesem Abend zweimal untergeht.
Der nächste Schuss trifft ihn mitten in die breite Stirn.
O-Bop sieht das, als er aus dem Fenster schaut, durch das kleine achteckige Drahtgeflecht. Sein Mund bildet ein kreisrundes O, während er verfolgt, wie das Gehirn von Peaches aus seinem Hinterkopf herausschießt und gegen die Wand klatscht. Und das ist auch schon alles, was er sieht, denn die nächste Kugel fliegt genau in seinen offenen Mund und sprengt ihm die Hirnschale.
Mickey sieht ihn lautlos zusammensacken und setzt den Teekessel auf. Das Wasser am Boden des Kessels fängt gerade an zu summen, als Scachi und zwei Scharfschützen zur Tür reinkommen, die Gewehre auf ihn gerichtet.
»Sal.«
»Mickey.«
»Ich mache gerade Tee«, sagt Mickey.
Sal nickt.
Der Kessel pfeift.
Mickey gießt Wasser in die angeschlagene Tasse und tunkt den Teebeutel ein paarmal ein. Die Zuckerdose klappert, als er Zucker und Milch nimmt, und seine Hand zittert beim Umrühren.
Er hebt die Tasse zum Mund und nimmt einen vorsichtigen Schluck.
Dann lächelt er - der Tee ist gut und heiß - und nickt Scachi zu.
Scachi erledigt ihn schnell und sauber, dann steigt er über ihn, um ins Schlafzimmer zu gelangen. Sie ist nicht da. Und wo ist Callan? Seine Harley ist weg. Verdammt.
Callan hat sich die Frau geschnappt und macht seine Solonummer, denkt Scachi. Und ich darf ihn mal wieder aufspüren.
Aber erst muss hier Ordnung gemacht werden.
Nach wenigen Stunden haben seine Leute ein Meth-Labor im Haus aufgebaut. Sie schleppen die Leiche von Peaches herein, verspritzen Jodwasserstoff, dann laufen sie bis zum nächsten Abhang und schießen eine Zündladung durchs Fenster ins Haus.
Die Feuerwehr hat Glück in dieser Nacht - es ist nicht sehr windig, und die Laborexplosion verbrennt nur drei, vier Hektar altes Gras und ein wenig Gestrüpp am Berghang. Kann nicht schaden, so ein Feuer ab und zu.
Beseitigt das alte Gras.
Macht Platz für das neue.
14 Pastorale
Außer der Liebe haben wir nichts, nur sie macht möglich, dass wir einander helfen.
Eurípides, Orestes
San Diego County
1998
In aller Frühe stehen sie auf und fahren weiter. »Sie werden uns suchen«, sagt Callan.
Er meint es ernst, denkt Nora. Als sie am Abend endlich irgendwo gehalten hatten, war sie ihm mit der Frage auf den Leib gerückt, was das Ganze überhaupt sollte.
»Sie wollten dich umbringen«, hatte Callan geantwortet.
Abseits der Straße hatten sie ein billiges Motel gesucht und ein paar Stunden geschlafen.
Um vier Uhr morgens rüttelt er sie wach und erklärt ihr, sie müssten weiterfahren. Aber im Bett ist es so schön warm. Sie zieht sich die Decke über den Kopf. Nur die paar Minuten, solange er duscht, denkt sie - durch die dünne Pappwand hört sie das Wasser rauschen.
Das Nächste, was sie bemerkt, ist seine Hand, die schon wieder an ihrer Schulter rüttelt.
»Wir müssen los.«
Sie steht auf, nimmt Jeans und Pullover vom Stuhl und zieht sie über. »Ich brauche neue Sachen.«
»Besorgen wir.«
Er sieht sie auf dem Bett sitzen und kann nicht glauben, dass sie tatsächlich bei ihm ist, kann nicht glauben; was er getan hat, weiß nicht, welche Folgen das hat, und es ist ihm egal. Sie ist so schön, selbst wenn sie müde und zerknautscht aussieht. Und wenn ihre Sachen riechen, dann riechen sie nach ihr.
Als sie ihre Schuhe zugeschnürt hat, blickt sie auf und sieht, dass er sie betrachtet.
Um vier Uhr morgens ist es immer kalt.
Auch mitten im Sommer, mitten im Amazonas-Dschungel - wenn man um vier Uhr morgens aufstehen muss, ist es kalt. Er sieht sie frösteln und gibt ihr seine Lederjacke.
»Und du?«, fragt sie.
»Mir ist warm.«
Sie nimmt die Jacke, und weil sie zu groß ist, wickelt sie die Ärmel um sich. Das fühlt sich schön warm an und ein bisschen so, als würde er die Arme um sie legen, wie in der Nacht. Männer haben ihr Brillanthalsbänder geschenkt, Kleider von Versace, Pelze. Aber nichts davon fühlte sich so gut an wie diese Jacke. Sie steigt hinter ihm auf und muss die Ärmel hochstreifen, damit sie sich an ihm festhalten kann.
Es geht ostwärts, auf der Interstate 8.
Auf der Straße sind fast nur Lastwagen unterwegs, ab und zu ein alter Pickup mit mexikanischen Landarbeitern, die auf den Farmen bei Brawley arbeiten wollen. Callan fährt immer geradeaus, bis er zu einem Abzweig kommt, der zum »Sunrise Highway« führt. Klingt passend, denkt er und biegt ab nach Norden. Die Straße windet sich in Serpentinen am steilen Südhang des Mount Laguna hoch, vorbei am Städtchen Descanso, dann verläuft sie weiter auf dem Bergkamm, links dichter Kiefernwald, rechts und über hundert Meter tiefer die Wüste.
Und der Sonnenaufgang ist spektakulär.
Sie halten an einem Rastplatz und sehen, wie die Sonne über der Wüste aufsteigt und dabei die Farben wechselt, von Rot zu Orange, dann das ganze Spektrum der Wüstenfarben durchläuft - bräunlich, beige, staubfarben, sandfarben. Danach fahren sie wieder ein Stück, immer die Höhenstraße entlang, während der Wald allmählich in niedriges Gestrüpp und dann in Grasland übergeht. Und kurz vor der Einmündung in den Highway 79 kommen sie zu einem kleinen See.
Callan biegt südwärts auf den Highway ein, und sie fahren am See entlang, bis sie ein kleines Restaurant sehen, das direkt am Ufer steht.
Er stellt die Maschine ab, und sie gehen hinein.
Es ist schön ruhig hier - zwei Fischer, ein paar Männer, die wie Rancher aussehen und kurz aufblicken, als Callan und Nora eintreten. Sie nehmen einen Tisch am Fenster mit Blick auf den See. Callan bestellt Eier mit Schinken und Bratkartoffeln, Nora Tee und trockenen Toast.
»Iss mal richtig«, rät ihr Callan.
»Ich habe keinen Hunger.«
»Musst du ja wissen.«
Sie rührt nichts an, weder Tee noch Toast. Als Callan sein Frühstück heruntergeschlungen hat, gehen sie hinaus und machen einen Spaziergang am Seeufer.
»Was machen wir jetzt?«, fragt Nora.
»Wir gehen spazieren.«
»Ich meine es ernst.«
»Ich auch.«
Am anderen Ufer stehen Kiefern, deren Nadeln im böigen Wind aufglänzen, auf dem See bilden sich hier und da weiße Schaumkronen.
»Sie werden mich suchen«, sagt Nora.
»Willst du, dass sie dich finden?«
»Nein«, sagt sie. »Vorerst nicht, jedenfalls.«
»Wenn du mich fragst, will ich einfach noch ein bisschen leben, verstehst du? Ich weiß nicht, was aus der ganzen Sache wird, aber ich will noch ein bisschen leben. Wärst du damit einverstanden?«
»Damit wäre ich sehr einverstanden.«
Aber ein paar Vorkehrungen sind notwendig. »Das Motorrad müssen wir loswerden«, sagt er. »Das ist zu auffällig.«
Ein paar Meilen weiter südlich besorgen sie sich ein Auto. Eine alte Farm liegt in einer Senke östlich der Straße. Ein klassisches Armeleute-Anwesen mit Autowracks und altem Gerumpel vor der Scheune und ein paar windschiefen Schuppen, die aussehen wie ehemalige Hühnerställe. Callan biegt auf den Feldweg ab und hält vor der Scheune, in der ein Mann mit der unvermeidlichen Basecap an einem 68er Mustang schraubt. Er ist groß und dürr, vielleicht fünfzig Jahre alt, obwohl sich das wegen der Kappe schwer abschätzen lässt.
Callan beäugt den Mustang. »Was wollen Sie für den?«, fragt er.
»Nichts«, sagt der Mann. »Weil ich ihn nicht verkaufe.«
»Irgendein anderes?«
Der Mann zeigt auf einen lindgrünen 85er Grand American, der draußen steht. »Die Beifahrertür geht aber nur von innen auf.«
Sie gehen hinüber zu dem Auto.
»Der Motor ist in Ordnung?«
»Klar, läuft wie 'ne Eins.«
Callan steigt ein und dreht den Zündschlüssel.
Der Motor springt an wie Schneewittchen nach dem Kuss.
»Wieviel?«, fragt Callan.
»Keine Ahnung. Elfhundert?«
»Papiere?«
»Zulassung, Nummernschilder, alles da.«
Callan geht ans Motorrad, holt zwanzig Hunderter aus der Seitentasche und überreicht sie dem Mann. »Ein Tausender für das Auto. Ein Tausender dafür, dass Sie uns nie gesehen haben.«
Der Mann nimmt das Geld. »Sie können wiederkommen, wenn Sie noch mal wollen, dass ich Sie nie gesehen habe.«
Callan überreicht Nora die Schlüssel. »Fahr mir nach.«
Sie folgt ihm nordwärts auf der 79 bis Julian, dort biegen sie ostwärts auf die 78 ein, die sich in zahllosen Kurven bis zur Wüste absenkt, sie überqueren eine lange, flache Senke, wo Callan einen Sandweg entdeckt, der zu einem Canyon führt. Ein paar hundert Meter vor dem Canyon bleibt er stehen.
»Das müsste reichen«, sagt er, als sie aus dem Auto steigt, und meint damit, dass sich hier im Sand das Feuer nicht ausbreitet und dass wahrscheinlich niemand die Rauchwolke bemerken wird. Er saugt Benzin aus dem Reservetank, schüttet es über der Harley aus.
»Nimm Abschied von ihr«, sagt er zu Nora.
»Mach's gut.«
Er zündet das Streichholz an, und sie schauen dem Feuer zu. »Ein Wikingerbegräbnis«, sagt sie.
»Nur dass wir nicht mit verbrennen.« Er setzt sich hinter das Steuer des Auto und öffnet ihr die Beifahrertür. »Wohin jetzt?«
»Wo es nett und ruhig ist.«
Er überlegt. Wer das Motorradskelett findet und mit uns in Verbindung bringt, wird vermuten, dass wir Richtung Osten weitergefahren sind, um ein Flugzeug in Tucson oder Phoenix oder Las Vegas zu erwischen. Also fährt Callan zurück nach Westen.
»Wohin willst du?«, fragt Nora, obwohl es ihr eigentlich egal ist, sie fragt nur aus Neugier.
Was ganz gut ist, denn er antwortet: »Keine Ahnung.«
Er weiß es wirklich nicht. Er hat keinen Plan, kein Ziel, er will nur fahren. Die Landschaft genießen, sich über Noras Gesellschaft freuen. Sie fahren dieselbe Straße hoch, die sie heruntergekommen sind, bis zum Städtchen Julian.
Das durchfahren sie einfach - an Menschen sind sie jetzt nicht interessiert -, dann senkt sich die Straße wieder ab, hin zur Küste, das Land weitet sich zu großen Feldern, Apfelplantagen, Pferdekoppeln, und während es immer weiter bergab geht, öffnet sich vor ihnen ein wunderschönes Tal.
In der Mitte des Tals teilt sich die Straße in nördlicher und in westlicher Richtung. An der Kreuzung gibt es ein paar vereinzelte Häuser - auf der Nordseite ein Postamt, einen Supermarkt, einen Imbiss, eine Bäckerei und (merkwürdigerweise) eine Kunstgalerie, auf der Südseite einen alten Kolonialwarenladen und ein paar kleine Wohnhäuser. Dahinter beginnt zu beiden Seiten das Nichts - Grasland mit weidenden Kühen. Und Nora sagt: »Hier ist es schön.«
Er hält vor dem Kolonialwarenladen, in dem es jetzt Bücher und Gartenbedarf gibt, geht hinein und kommt nach ein paar Minuten mit einem Schlüssel heraus. »Wir mieten für einen Monat ein Häuschen«, sagt er. »Wenn es dir nicht gefällt, kriegen wir das Geld zurück und fahren weiter.«
Das Haus hat ein kleines Wohnzimmer mit einem alten Sofa, Tisch und Stühlen, eine enge Küche mit Gasherd und altem Kühlschrank, eine Spüle mit einem Hängeschrank fürs Geschirr darüber. Die einzige weitere Tür führt in das winzige Schlafzimmer, mit einem noch winzigeren Bad, das hinten angebaut ist - ohne Wanne, nur Dusche.
In diesem Haus verlaufen wir uns nicht, denkt sie.
Er steht noch in der Haustür und zögert.
»Ich bin zufrieden«, sagt sie. »Und du?«
»Es ist gut, mir gefällt's.« Er zieht die Tür hinter sich zu. »Wir sind übrigens die Kellys. Ich heiße Tom, du heißt Jean.«
»Ich bin Gene Kelly? Singin' in the Rain?«
»Daran hab ich nicht gedacht.«
Nachdem sie geduscht hat, fahren sie die vier Meilen zurück nach Julian, um Sachen zu kaufen. Die Mainstreet ist voll von kleinen Restaurants, wo es Applepie gibt, die örtliche Spezialität, aber sie finden auch ein paar Boutiquen, in denen sie ein paar einfache Kleider und einen Pullover kauft. Das meiste kaufen sie im Eisenwarenladen, der auch Jeans, Arbeitshemden, Socken und Unterwäsche führt.
Ein Stück weiter findet Nora einen Buchladen mit gebrauchten Taschenbüchern. Sie kauft sich Anna Karenina, Middlemarch, The Eustace Diamonds und - diese kleine Sünde erlaubt sie sich - ein paar Nora-Roberts-Liebesromane.
Dann fahren sie zurück zu ihrer Kreuzung und kaufen Lebensmittel im Supermarkt - Brot, Milch, Kaffee, Tee, seine Lieblingscornflakes, ihre Lieblingscornflakes, Schinken, Eier, ein paar Steaks, etwas Huhn, Kartoffeln, Reis, Spargel, grüne Bohnen, Tomaten, Grapefruit, braunen Reis, Applepie, Rotwein, Bier - und allerlei Kleinkram: Papierrollen, Geschirrspülmittel, Toilettenpapier, Deodorants, Zahnpasta, Zahnbürsten, Seife, Shampoo, einen Rasierer mit Rasierklingen, Rasiercreme, ein Haarfärbemittel und eine Schere.
Sie haben sich auf ein paar Vorsichtsmaßregeln geeinigt - nicht übervorsichtig, aber auch nicht allzu leichtsinnig zu sein. Die Harley musste schon dran glauben und jetzt auch Noras schulterlanges Haar, denn Callan wirkt unauffällig, sie aber nicht. Und als Erstes werden sich die Verfolger überall nach einer schönen blonden Frau umsehen.
»So schön bin ich nicht mehr«, erklärt sie ihm.
»Doch, bist du.«
Zurück im Häuschen, schneidet sie ihr Haar. Ganz kurz. Schaut in den Spiegel, als sie fertig ist und sagt: »Die heilige Johanna.«
»Mir gefällt's.«
»Lügner!«
Aber nach einer Weile gefällt es ihr auch irgendwie. Und noch mehr, als sie die Haare rot färbt. Na gut, denkt sie, so sind sie leichter zu pflegen. Da stehe ich nun: Kurzes rotes Haar, Jeans und Arbeitshemd. Wer hätte das gedacht?
»Jetzt bist du dran«, sagt sie und klappert mit der Schere.
»Verzieh dich!«
»Du brauchst sowieso einen neuen Haarschnitt. Deine Siebzigerjahre-Mähne ist langsam passe. Komm, lass mich ran!«
»Nein.«
»Feigling!«
»Das ist eben mein Stil.«
»Es gibt Kerle, die zahlen eine Stange Geld, damit ich das bei ihnen mache.«
»Die Haare schneiden? Du spinnst!«
»Tja, die Welt ist bunter, als du glaubst, Tommy.«
»Deine Hände zittern ja!«
»Dann halt lieber still.«
Er lässt sie machen. Sitzt ganz still auf seinem Stuhl und verfolgt im Spiegel, wie sie an ihm herumschnippelt, wie die braunen Locken erst auf seine Schultern, dann auf den Fußboden fallen. Als sie fertig ist, begutachten sie sich gemeinsam im Spiegel.
»Wir sind nicht wiederzuerkennen«, sagt sie. »Was meinst du?«
Er kann es nur bestätigen.
Am Abend macht er Hühnerbrühe für sie, Steak mit Kartoffein für sich, sie setzen sich zum Essen an den Tisch und sehen fern, und als in den Nachrichten die Meldung vom explodierten Meth-Labor mit mehreren Todesopfern kommt, sagt er nichts, weil er merkt, dass sie nicht weiß, wovon die Rede ist.
Er versucht, ein bisschen um Peaches und O-Bop zu trauern, aber es geht nicht. Wer so viele Menschen ins Jenseits befördert wie sie, muss damit rechnen, auch einmal so zu enden.
Er hat kein Problem damit.
Mickey allerdings, der tut ihm leid.
Doch die Meldung bedeutet auch, dass Scachi hinter ihnen her ist.
Nora hat eine unruhige Nacht - kann nicht schlafen und will nicht sehen, was sie sieht, wenn sie die Augen zumacht. Er kriegt es mit, weil er diese Bilder auch kennt. Nur dass ich mich gegen sie abgehärtet habe, sagt er sich.
Er liegt hinter ihr, hat den Arm um sie gelegt und erzählt ihr irische Geschichten, die er aus seiner Kindheit kennt, in Bruchstücken jedenfalls. Was er vergessen hat, erfindet er neu. Das ist nicht allzu schwer, weil es ja nur um Feen und Kobolde und all das Zeug geht.
Gegen vier Uhr morgens nickt sie endlich ein, auch er schläft ein bisschen, die Hand an der 22er, die unter seinem Kopfkissen liegt.
Als sie aufwacht, hat sie Hunger.
Nicht zu fassen, denkt Callan. Sie gehen ins Restaurant über die Straße, wo sie ein Käseomelett mit Bratwürstchen bestellt und Roggentoast mit viel Butter.
Die Serviererin fragt: »Wollen Sie amerikanischen Käse, Cheddar oder Jack?«
»Alles«, sagt sie.
Und futtert, als wäre es ihre Henkersmahlzeit. Als würden sie schon draußen warten, um sie auf den letzten Gang zu begleiten. Callan muss ein bisschen grinsen, weil sie die Gabel führt wie einen Spieß - diese Würstchen haben keine Chance. Und er sagt ihr nicht, dass sie ein bisschen Butter im Mundwinkel hat.
»Und, hat's geschmeckt?«, fragt er, als sie fertig ist.
»Es war köstlich!«
»Bestell dir noch ein Omelett.«
»Niemals!«
»Zimtrollen.«
»Na gut.«
»Die sind heute Morgen frisch«, versichert die Serviererin, als sie den großen Teller und zwei Gabeln bringt. Nora geht raus, kommt mit der San Diego Union-Tribune zurück und nimmt sich die privaten Annoncen vor.
»Kim, wo bist du? Notfall in der Familie. Suchen dich überall. Bitte sofort melden. Deine Schwester.« Dazu eine Telefonnummer. Typisch Keller, denkt sie. Verstreut überall seine Botschaften, nur für den Fall - der ja nun auch eingetreten ist -, dass ich als freie Agentin aus freien Stücken davongelaufen bin. Arthur will also, dass ich mich melde.
Nein, Arthur, jetzt noch nicht.
Wenn du mich finden willst, musst du mich suchen.
Er ist schon dabei.
Kellers Leute sind in Truppenstärke unterwegs. Klappern Flughäfen, Bahnhöfe, Busstationen, Fährhäfen ab, prüfen Passagierlisten, Reservierungen, Passkontrollregister. Agenten von Hobbs kümmern sich um die Einreiseregister in Frankreich, England, Brasilien. Sie kommen sich vor wie in den April geschickt, aber am Ende der Woche ist klar, dass Nora Hayden nicht außer Landes ist, zumindest nicht mit eigenem Pass, dass sie weder ihre Kreditkarten noch ihr Handy benutzt hat, dass sie sich um keinen Job beworben, kein Verkehrsdelikt begangen und keine Wohnung unter Angabe ihrer Versicherungsnummer angemietet hat.
Keller setzt Haley Saxon unter Druck, lässt ihr jedes erdenkliche Vergehen vorwerfen, von Unzucht bis hin zu Frauenhandel und Beihilfe zum versuchten Mord. Deshalb glaubt er ihrem Schwur, sie habe nichts von Nora gehört und werde sich beim kleinsten Hinweis sofort bei ihm melden.
Die Abhördienste diesseits und jenseits der Grenze fangen keine Gespräche auf, weder von Nora noch von Leuten, die sie erwähnen.
Keller ruft einen Unfallexperten, der die Spuren von Callans Motorrad untersuchen soll. Der Mann betreibt allerlei Hokuspokus im Wüstensand und stellt anhand der Reifenspuren fest, dass mit Sicherheit zwei Personen auf dem Motorrad saßen und dass sich der Sozius hoffentlich gut festgehalten hat, denn diese Harley sei sehr schnell gefahren.
Sehr weit kann Callan nicht sein, überlegt Keller. Mit einer Geisel entkommt er weder per Flugzeug noch per Bahn oder Bus, und die Geisel findet zu viele Gelegenheiten, vom Motorrad zu steigen - beim Tanken, an der Ampel, bei jedem Halt.
Also engt er die Suche auf den Radius einer Tankfüllung ein, hält Ausschau nach einer Harley Davidson Electra Glide - und wird fündig.
Ein Hubschrauber der Grenzpatrouille, der auf der Suche nach mojados über der Anza-Borrego-Wüste kreist, entdeckt die Brandstelle und landet dort, um sie genauer zu betrachten. Der Bericht geht sofort an Keller - seine Leute sind in den Funkverkehr der Grenzer eingeschaltet -, also dauert es keine zwei Stunden, bis dort ein Fahnder eintrifft, in Begleitung eines Harley-Händlers, der ein Ecstasy-Verfahren am Hals hat. Der Händler beäugt die verkohlten Reste der Harley und bestätigt fast unter Tränen, dass es sich um das gesuchte Modell handle.
»Gibt es Menschen, die so etwas tun?«, fragt er fassungslos.
Man muss kein Sherlock Holmes sein - nicht mal ein Larry Holmes -, um zu sehen, dass der Harley ein Auto gefolgt ist, dass jemand aus dem Auto gestiegen ist, dass es ein wenig Hin und Her gab, dass das Auto dann zur Landstraße zurückgefahren ist.
Also muss der Spurenfachmann wieder her. Er vermisst die Tiefe der Reifenabdrücke und die Spurweite, macht Gipsabgüsse von den Profilen und stochert noch eine Weile im Dreck, um Keller dann zu erzählen, es handle sich um einen kleineren, zweitürigen Pkw mit Automatikgetriebe und Firestone-Reifen.
»Noch was«, wirft einer von den Grenzern ein. »Die Beifahrertür klemmt.«
»Woher wollen Sie das wissen?«, fragt Keller. Die Grenzer sind Spezialisten im Spurenlesen, besonders hier in der Wüste.
»Die Fußabdrücke auf der Beifahrerseite«, erklärt der Mann. »Sie ist ein Stück rückwärts gegangen, damit die Tür aufgemacht werden konnte.«
»Eine Sie?«
»Das sind Abdrücke von Damenschuhen«, sagt der Grenzer. »Dieselbe Frau hat auch das Auto gesteuert. Sie ist auf der Fahrerseite ausgestiegen, ist hinüber zu dem Motorradfahrer, hat dort eine Weile gestanden und zugesehen. Sehen Sie, wie tief sich hier der Absatz eingebohrt hat? Dann lief sie zur Beifahrerseite, und der Mann stieg auf der Fahrerseite ein und machte ihr die Tür auf.«
»Können Sie mir sagen, welche Sorte Schuhe die Frau trug?«
»Ich? Nein«, sagt der Mann. »Aber ich wette, Sie haben Leute, die das können.«
Keine halbe Stunde später ist der Spezialist mit dem Hubschrauber im Anflug. Er macht Abgüsse und nimmt sie mit ins Labor. Vier Stunden später ruft er Keller an.
Es sind Noras Spuren.
Sie ist mit Callan unterwegs.
Offenbar freiwillig - was Keller nicht begreifen kann. Was haben wir hier?, fragt er sich. Einen fortgeschrittenen Fall von Stockholm-Syndrom? Das Gute daran: Sie ist noch am Leben - oder war es noch vor wenigen Tagen. Das Schlechte: Callan hat den ursprünglichen Suchradius durchbrochen. Er ist mit einem unauffälligen Auto Richtung Osten - und mit einer Geisel, die sich zumindest kooperativ gezeigt hat. Er könnte also überall sein.
Und Nora mit ihm.
»Lass mich das übernehmen«, sagt Sal Scachi zu Keller. »Ich kenne den Kerl. Ich kriege ihn in den Griff, wenn ich ihn finde.«
»Er hat drei seiner alten Partner umgelegt und eine Frau entführt, und du kriegst ihn in den Griff?«
»Ich kenne ihn von früher«, sagt Scachi.
Zögernd stimmt Keller zu. Scachi hat recht, er kennt Callan viel besser, und Keller hat schon genug riskiert. Aber er braucht Nora. Alle brauchen Nora. Ohne Nora ist der Deal mit Adán Barrera nicht zu machen.
Sie leben schon fast wie ein altes Ehepaar.
Stehen zeitig auf und frühstücken, manchmal im Haus, manchmal gegenüber im Imbiss. Callan liebt es kalorienreich, sie begnügt sich meist mit Müsli und Toast, weil der Imbiss morgens kein Obst anbietet - außer zum Sonntagsbrunch. Beim Frühstück wird nicht viel geredet - beide sind sie morgens eher wortkarg und lesen lieber Zeitung, statt Konversation zu treiben.
Nach dem Frühstück machen sie gern einen kleinen Ausflug. Sie wissen, dass es nicht besonders klug ist - klug wäre es, das Auto hinter dem Haus abzustellen und dort zu lassen -, aber ein bisschen Risiko muss sein, und die Fahrten machen viel zu viel Spaß. Sieben Meilen nordwärts hat Callan einen See gefunden, ganz nahe am Highway 79 - eine schöne Fahrt durch eichenbestandenes Grasland und wellige Hügel, mit großen Ranches zur Linken und dem Kumeyaay-Reservat zur Rechten. Dann werden die Hügel von flachem Weideland abgelöst, die Berge (mit dem Observatorium von Palomar, das wie ein riesiger Golfball auf dem höchsten Gipfel thront) bleiben im Süden zurück, und inmitten des Graslands liegt der See.
Er bietet nicht unbedingt das, was man von einem See erwartet, ist nicht viel mehr als ein großes Oval aus Wasser, aber man kann an seinem südlichen Ende spazieren gehen, und das macht Nora großen Spaß. Meist weidet dort eine große Herde schwarzbunte Holsteiner, und die findet sie immer sehenswert.
Manchmal fahren sie also an den See und laufen ein bisschen herum, manchmal auch in die Hochwüste zwischen Ranchita und Culp Valley, wo gewaltige runde Felsblöcke verstreut liegen, als hätte ein Riese Murmeln gespielt und vergessen, sie einzusammeln. Oder sie fahren einfach zum Inaja Peak hinauf und klettern das letzte Stück vom Parkplatz bis zum Aussichtspunkt, von dem man einen grandiosen Blick über die Berge hat und bis nach Mexiko sehen kann.
Dann, wieder zu Hause, essen sie Mittag - er ein Truthahn- oder Schinkensandwich, sie ein wenig Obst, das sie vorher im Supermarkt besorgt hat -, dann folgt eine lange Siesta. Sie hat vorher nie bemerkt, wie müde sie war und wie sehr ihr Körper den Schlaf braucht, weil er einfach danach verlangt, und sie schläft jetzt sofort ein, wenn sie sich hinlegt.
Nach der Siesta sitzen sie entweder im Wohnzimmer oder, wenn es warm ist, auf der kleinen Veranda. Sie liest ihre Bücher, er hört Radio und blättert in Illustrierten. Am späten Nachmittag gehen sie hinüber zum Supermarkt und besorgen etwas zum Abendessen. Sie kauft gern für jede Mahlzeit extra ein, weil sie das an Paris erinnert, und löchert den Mann an der Fleischtheke so lange, bis sie weiß, was an diesem Tag besonders zu empfehlen ist.
»Kochen bedeutet zu neunzig Prozent einkaufen«, erklärt sie Callan. »Okay?«
Er glaubt, dass ihr das Einkaufen und Kochen mehr Spaß macht als das Essen, weil sie zwanzig Minuten damit verbringt, die besten Steaks auszusuchen, und am Ende isst sie nur zwei Happen davon. Oder drei, wenn es sich um Fisch oder Hühnchen handelt. Und sie treibt einen Riesenaufwand mit dem Gemüse, das sie in großen Mengen verputzt. Für ihn kauft sie Kartoffeln (»Ich weiß, du bist Ire«), während sie sich braunen Reis kocht.
Aber sie kochen gemeinsam. Das ist zu einem richtigen Ritual geworden, und er genießt es, wenn sie in der winzigen Küche umeinanderschlurfen, Gemüse schnippeln, Kartoffeln schälen, Öl erhitzen, das Fleisch sautieren oder die Nudeln kochen und dabei plaudern - über alles mögliche, über Filme, über New York, über Sport. Sie erzählt ein bisschen aus ihrer Kindheit, er ein bisschen aus seiner, aber die harten Sachen lassen sie weg. Sie erzählt ihm von Paris - über das Essen, die Märkte, die Cafés, die Seine, dieses besondere Licht.
Über ihre Zukunft reden sie nicht.
Nicht mal über die Gegenwart. Nicht darüber, was sie hier machen, wer sie überhaupt sind, was sie füreinander bedeuten.
Sie haben nicht miteinander geschlafen, sich nicht einmal geküsst, sie wissen beide nicht, ob es ein Noch-nicht ist oder was sonst. Sie weiß nur, dass er der zweite Mann in ihrem Leben ist, der sie nicht einfach nur ficken will, und vielleicht der erste, der ihr als Mann gefallen könnte. Er weiß nur, dass sie bei ihm ist, und das genügt ihm, Damit kann er leben.
Scachi fährt den Sunrise Highway entlang, als ihm etwas ins Auge sticht - eine verlotterte Farm, die aussieht wie ein Autofriedhof. Interessant, denkt Scachi und biegt ein.
Der typische Autofreak kommt angetrottet. »Kann ich helfen?«
»Vielleicht«, sagt Scachi. »Verkaufen Sie diese Schrotthaufen?«
»Ich bastle nur so dran rum.«
Aber Scachi sieht schon das Flackern in seinen Augen und klopft ein bisschen auf den Busch. »Haben Sie vor kurzem eins verkauft, bei dem die Beifahrertür klemmt?«
Jetzt starrt ihn der Typ an wie ein Gespenst. Woher weiß der das?
»Wer sind Sie?«, fragt er.
»Wie viel hat er gezahlt, damit Sie die Klappe halten?«, fragt Scachi. »Ich bin der Mann, der Ihnen noch mehr zahlt, damit Sie die Klappe wieder aufmachen. Andernfalls beschlagnahme ich Ihr Haus, Ihr Land, alle Autos und sogar das Bild von Richard Petty samt Autogramm und stecke Sie in den Knast, bis die Chargers den Super Bowl gewinnen, mit anderen Worten: für immer.«
Er zieht sein Geldbündel aus der Tasche und fängt an, die Scheine herunterzublättern. »Sagen Sie halt.«
»Sind Sie von der Polizei?«
»Und noch ein paar«, sagt Scachi und blättert weiter. »Sind wir schon da?«
Fünfzehnhundert Kröten. »Fast.«
»Sie sind wohl 'n ganz Schlauer, was? Sechzehnhundert, und dann ist Schluss, mein Freund. Sie wollen doch keinen Ärger, oder?«
»Ein 85er Grand American«, sagt der Mann und schiebt sich die Scheine in die Tasche. »Lindgrün.«
»Kennzeichen?«
»4ADM045.«
Scachi nickt. »Ich sag Ihnen mal, was der Mann in etwa gesagt hat: Wenn jemand fragt, war ich nie hier, haben Sie mich nie gesehen. Und jetzt kommt der Unterschied: Wenn Sie mich auch an den Meistbietenden verpetzen ...« Er zieht einen 38er Revolver. »... dann komme ich zurück, schiebe Ihnen das Ding in den Arsch und schieße das Magazin leer. Haben wir uns verstanden?«
»Ja.«
»Gut«, sagt Scachi und steckt den Revolver weg. Geht zu seinem Auto und gibt Gas.
Callan und Nora besuchen eine Kirche.
Auf einer ihrer Nachmittagstouren biegen sie am Kueyaay-Reservat vom Highway 79 ab und fahren zur alten Missionsstation Santa Ysabel. Eine kleine Kirche, eher eine Kapelle, gebaut im klassischen kalifornischen Missionsstil.
»Willst du rein?«, fragt Callan.
»Ja, gern.«
Vor einer kleinen abstrakten Statue neben dem Eingang bleiben sie stehen. Sie heißt Der Engel der verlorenen Glocken, und ein Schild erklärt, dass die Missionsglocken in den zwanziger Jahren gestohlen wurden und die Gemeindemitglieder seitdem für ihre Rückkehr beten, damit ihre Kirche wieder eine Stimme bekommt.
Jemand hat die verdammten Glocken geklaut?, denkt Callan. Typisch. Die schrecken vor nichts zurück. Dann gehen sie hinein.
Die weißgekalkten Lehmmauern bilden einen starken Kontrast zu dem dunklen, handbehauenen Dachgebälk. Eine nicht ganz stilgerechte Täfelung aus billigem Kiefernholz säumt die Wände bis zu den bunten Glasfenstern mit Heiligendarstellungen und Kreuzwegstationen. Die Eichenbänke sehen neu aus, der Altar ist im mexikanischen Stil dekoriert, mit bunt bemalten Madonnen und Heiligen. Nora wird von bittersüßen Erinnerungen erfüllt - seit der Trauerfeier für Juan hat sie keine Kirche mehr betreten.
Zusammen bleiben sie vor dem Altar stehen.
»Ich möchte eine Kerze anzünden«, sagt sie.
Er kommt mit, und sie knien gemeinsam nieder. Nora stellt ihre Kerze zu den anderen, senkt den Kopf und betet still.
Callan wartet solange, studiert das Wandbild hinter dem Altar - der gekreuzigte Christus, flankiert von den zwei Missetätern.
Es dauert lange, bis Nora aufsteht.
Als sie draußen sind, sagt sie: »Jetzt ist mir wohler.«
»Du hast ja auch lange gebetet.«
Sie erzählt ihm von Juan Parada. Über ihre Freundschaft und Liebe zu ihm. Dass der Mord an Juan sie dazu gebracht hat, Adán Barrera der Polizei auszuliefern.
»Ich hasse ihn«, sagt sie. »Er soll in der Hölle schmoren.«
Callan sagt nichts.
Nachdem sie zehn Minuten gefahren sind, sagt Nora: »Sean, ich muss hier weg.«
»Warum?«
»Ich muss gegen Adán aussagen. Er hat Juan ermordet.«
Callan versteht. Es gefällt ihm gar nicht, aber was soll er machen? Trotzdem will er es ihr auszureden. »Scachi und diese Leute. Ich glaube nicht, dass die deine Aussage wollen. Ich glaube, die wollen dich beseitigen.«
»Sean, ich muss es tun.«
Er nickt. »Ich bringe dich zu Keller.«
»Morgen.«
»Gut. Morgen.«
In der Nacht liegen sie nebeneinander im Dunkeln, lauschen auf das Zirpen der Grillen und auf ihren eigenen Atem. In der Ferne heulen und kläffen die Kojoten, dann ist es wieder still.
»Ich war dabei«, sagt Callan in die Stille.
»Wo?«
»Als sie Parada umbrachten. Ich gehörte zu dem Kommando.«
Er spürt, wie ihr Körper neben ihm erstarrt. Wie ihr Atem stockt. Dann sagt sie: »Um Gottes willen, warum?«
Er braucht zehn, fünfzehn Minuten, bis er das erste Wort herausbringt. Er erzählt ihr, wie es anfing, im Liffey Pub, als er siebzehn war und Eddie Friel erschoss. Und erzählt noch Stunden weiter, leise murmelnd spricht er in die Wärme ihres Nackens und erzählt ihr von all den Morden - in New York, Kolumbien, Peru, Honduras, El Salvador, Mexiko. »Ich wusste nicht, dass er ermordet werden sollte«, sagt er, als er zu dem Tag am Flughafen von Guadalajara kommt. »Ich hab versucht, es zu verhindern, aber ich kam zu spät. Er ist in meinen Armen gestorben, Nora. Er hat gesagt, er vergibt mir.«
»Aber du vergibst dir nicht.«
Er schüttelt den Kopf. »Ich kann mir nichts vergeben. Ich bin schuldig an seinem Tod. An allen Morden.«
Und ist überrascht, als sie den Arm um ihn legt und ihn fest an sich zieht. Seine Tränen machen ihren Nacken feucht.
Nach einem kurzen Zögern beginnt sie: »Als ich vierzehn war...«
Sie erzählt ihm von all den Männern. Von den Freiern, von den Partys. All den Männern, die sie mit dem Mund befriedigt hat, anal, mit ihrem ganzen Körper. Sie wartet auf Zeichen seines Abscheus, aber da ist nichts. Dann erzählt sie ihm von ihrer Freundschaft mit Juan Parada, von ihrem Verlangen nach Vergeltung, von ihrem Verhältnis mit Adán Barrera, das so vielen Menschen den Tod brachte.
Ihre Gesichter sind sich so nahe, dass sich ihre Lippen fast berühren.
Sie nimmt seine Hand, schiebt sie unter ihr Hemd, auf ihre Brust. Er sperrt überrascht die Augen auf, aber sie nickt, und er streichelt ihre Brustwarze, bis sie ganz hart wird. Das fühlt sich so gut an, dass er ihre Brust in den Mund nimmt, leckt und lutscht und saugt, bis Nora schwach wird und feucht zwischen den Beinen.
Bei ihm ist es längst so weit. Sie greift nach unten, öffnet seine Jeans und fasst hinein, sein Stöhnen vibriert in ihrer Brust. Sie holt seinen Schwanz heraus und streichelt ihn, er öffnet zaghaft den Reißverschluss ihrer Hose, greift hinein, schiebt den Finger dahin, wo es feucht ist, das ist gut, sagt sie, und er geht weiter, badet den Finger in ihrem Saft, massiert sanft ihre Knospe, fühlt sie anschwellen und hart werden, und nach einer Weile drückt sie den Rücken durch, stöhnt und schreit, und er küsst sich nach unten, saugt und schleckt, wie um eine Wunde zu heilen, während sich ihr Körper durchbiegt und sie seine Hand presst, als sie kommt, er ihren Nacken streichelt und ihr Haar und sagt ist gut, ist gut, bis sie aufhört zu schreien, seinen Schwanz in den Mund nimmt, er aber sagt, ich will richtig in dir sein, ist das okay?, und sie sagt ja, und er fragt noch einmal, ist das okay?, und sie sagt, ich will dich in mir.
Sie legt sich auf den Rücken, führt seinen Schwanz ein, er hilft mit sanften Stößen nach, sie umklammert ihn mit den Beinen, nimmt ihn immer tiefer in sich auf, und dann ist er ganz in ihr, er blickt verzaubert hinab auf ihr Gesicht, ihre Augen, und sie lächelt und sagt Gott, ist das schön, sie streckt ihm das Becken entgegen, damit er noch tiefer hineinstößt, er spürt diese wunderbare Stelle in ihr, zieht zurück und stößt wieder hinein, sie ist nur noch eine heiße, feuchte, silbrig schimmernde Eruption, sie streichelt seinen Rücken, seinen Po, seine Beine, stöhnt so gut, so gut, und er dringt vor zu dieser Stelle und berührt sie, er sieht die Schweißtröpfchen auf ihrer Oberlippe und leckt sie ab, den Schweiß von ihrem Hals und leckt ihn auf, er spürt den Schweiß ihrer Brüste an seiner Brust, den Schweiß ihrer Schenkel an seinen Schenkeln, die klebrige Nässe zwischen ihren Schenkeln, die ihn so fest umfängt, und er sagt, ich glaube, ich komme, und sie sagt, ja, komm, komm in mir, und er stößt so tief, wie er kann, und hält dort inne, und dann spürt er, wie ihr Bauch ihn dort festhält, mit pulsierendem Sog, und er kommt mit Gebrüll, und brüllt wieder und wieder, bis er auf ihrer warmen Schulter zusammensackt.
Sie schlafen ein, wie sie daliegen, er auf ihr.
Am Morgen, während sie noch schläft, steht er auf, fährt zum Einkaufen in die Stadt, um sie mit dem Duft von Eierkuchen, Kaffee und Schinken zu wecken.
Als er zurückkommt, ist sie weg.
15 Die Kreuzung
This train carries saints and sinners.
This train carries losers and winners.
This train carries whores and gamblers.
This train carries lost souls ...
Traditional
San Diego
1999
Keller trifft Hobbs im Amphitheater des Balboa Parks. Die Sitzreihen aus weißen Metallstühlen senken sich im Halbkreis zum Organ Pavilion ab. Hobbs sitzt in der vorletzten Reihe und liest. In der letzten Reihe, schräg hinter ihm, sitzt Sal Scachi.
Es ist warm geworden. Der Frühling ist im Kommen.
Keller setzt sich neben Hobbs.
»Neuigkeiten zu Nora Hayden?«, fragt er.
»Wir kennen uns so lange, Arthur«, sagt Hobbs. »Eine Menge Wasser ist den Bach runtergeflossen.«
»Was wollen Sie mir sagen, John?«
O Gott, ist sie tot?
»Tut mir leid, Arthur«, sagt Hobbs. »Ich kann nicht zulassen, dass Sie Barrera den Prozess machen. Sie werden ihn uns sofort übergeben.«
Die alte Geschichte, denkt Keller. Immer das Gleiche. Erst Tío, jetzt Adán.
»Er ist ein Terrorist, John! Das haben Sie selbst gesagt! Er steckt mit der FARC unter einer Decke, und -«
»Ich habe Garantien bekommen«, sagt Hobbs. »Das Barrera-Kartell wird nicht mehr mit der FARC zusammenarbeiten.«
»Garantien?!«, ruft Keller. »Von Adán Barrera?«
»Nein«, sagt Hobbs seelenruhig. »Von Miguel Angel Barrera.«
Keller verschlägt es die Sprache.
»Das lief alles aus dem Ruder, Arthur. Ein paar vernünftige Leute mussten einschreiten, um das Schlimmste zu verhüten.«
»Vernünftige Leute! Sprechen Sie von sich oder von Miguel Barrera?«
»Er war entsetzt, als er hörte, dass sich sein Neffe mit den Terroristen eingelassen hat«, sagt Hobbs. »Er hätte dem sofort einen Riegel vorgeschoben, wenn er es gewusst hätte. Jetzt weiß er es. Das ist eine gute Lösung, Arthur. Adán Barrera ist eine unschätzbare Geheimdienstquelle für uns, wenn er Anlass zur Kooperation hat.«
Das ist Blödsinn, wie Keller weiß. Sie haben Angst, dass Adán Barrera auspackt, wenn es zum Prozess kommt. Aus gutem Grund. Ich wollte keinen Deal mit ihm, sie schon. Sie haben schon alles arrangiert. Sie verpassen ihm ein neues Gesicht, eine neue Identität.
Kommt nicht in Frage.
»Sie kriegen ihn nicht.«
Hobbs klingt wütend, als er sagt: »Darf ich Sie daran erinnern, dass wir einen Krieg gegen den Terror führen?«
Keller hält das Gesicht in die Sonne und genießt die Wärme. »Ein Krieg gegen den Terror, ein Krieg gegen den Kommunismus, ein Krieg gegen die Drogen. Irgendein Krieg ist immer.«
»Das ist der Lauf der Welt, fürchte ich.«
»Ohne mich«, sagt Keller. »Ich mach das nicht mehr mit.«
Er steht auf.
»Einmal muss es doch aufhören«, sagt Keller. »An irgendeinem Punkt.«
»Darf ich Sie des weiteren daran erinnern, dass ich auch für Sie die Kastanien aus dem Feuer hole? Ihr pfäffischer Ton der moralischen Überlegenheit ist schlechthin unerträglich. Und untragbar, könnte ich hinzufügen. Sie waren selbst beteiligt an -«
Keller hebt die Hand. »Er hat mir den Deal schon angeboten. Ich habe abgelehnt. Ich übergebe Barrera dem Staatsanwalt und überlasse alles Weitere der Justiz. Und ich werde aussagen. Über Operation Condor, Operation Kerberos, Red Cloud.«
Hobbs wird bleich.
»Das werden Sie nicht, Arthur.«
»Warten Sie ab.«
War Hobbs vorher bleich, sieht er jetzt aus wie ein Gespenst. »Arthur, Sie sind doch ein Patriot!«
»Allerdings.«
Keller steht auf und geht davon.
Es ist wirklich Frühling - die Gärten im Park explodieren in frischen Farben, die Luft ist warm - mit einem winzigen Restbestand an Winterkälte, so dass sie noch erfrischt. Er blickt hinab zum Pavillon, wo sich Schüler in Grüppchen um Lehrer scharen, Pärchen ihren Imbiss verzehren, Touristen mit umgehängten Fotoapparaten den Wegeplan des Parks studieren, alte Leute mit gemächlichen Schritten spazieren gehen und die milde Frühlingsluft genießen.
Eben gerade fliegt eine Passagiermaschine tief über den Park hinweg, um auf der kurzen Rollbahn von San Diego Airport niederzugehen, der Lärm ist ohrenbetäubend, und er hört es kaum, als Hobbs »Nora Hayden« sagt.
»Wie bitte?«
»Wir haben sie«, sagt Hobbs. »Wir tauschen sie gegen Barrera.«
Keller dreht wieder um.
»Ernie Hidalgo konnten Sie nicht retten«, sagt Hobbs. »Aber Nora Hayden können Sie retten. Ganz einfach. Bringen Sie mir Barrera. Andernfalls ...«
Er muss seinen Satz nicht beenden.
»An der Cabrillo Bridge«, sagt Hobbs. »Mitternacht wäre zu melodramatisch. Sagen wir, drei Uhr nachts. Nachdem die Schwulen weg sind und bevor die Jogger kommen. Sie bringen Barrera von der westlichen Seite, wir bringen Ms. Hayden von der östlichen. Und, Arthur, wenn Sie immer noch den pathetischen Drang verspüren, alles offenzulegen, schlage ich Ihnen vor, zur Beichte zu gehen. Aber denken Sie nur nicht, dass Ihnen irgendjemand glaubt oder sich für Ihre sogenannte Wahrheit interessiert.«
Hobbs versenkt sich wieder in sein Buch, mit aller Seelenruhe.
Keller geht wortlos davon.
»Soll ich die Sache vorbereiten?«, fragt Scachi.
Hobbs nickt, wenn auch nicht ohne eine gewisse Trauer. Art Keller ist ein guter Mann, aber er bestätigt mal wieder eine uralte Wahrheit: Ein guter Mann stirbt in der Schlacht.
Keller fährt zu dem Ort, wo er Adán Barrera festhält.
»Du kriegst deinen Deal«, sagt Keller.
Dein letzter Job, verspricht Sal Scachi.
Klar, denkt Callan. Es ist jedes Mal der letzte.
Aber ich hab keine Wahl, ich muss ihm glauben, denkt er, während er durch den Baiboa Park läuft.
Wenn du's nicht machst, stirbt sie.
Am Old Globe Theater kauft er sich eine Eintrittskarte für Betrogen von Harold Pinter und geht hinein. In der Pause kommt er auf eine Zigarette heraus und läuft hinter das Theater, zu dem Fahrweg, der das Theater von der Zoo-Klinik trennt. Er läuft bis zu dem Drahtzaun unter den Eukalyptusbäumen am Rand des Abhangs, von dem man den Highway überblickt und links die Cabrillo Bridge sieht. Von hinten und von der Seite ist er durch das Theater und die Klinik vor Blicken geschützt, von der Straße her durch ein paar geparkte Sattelschlepper. Er holt einen Entfernungsmesser aus der Tasche und richtet ihn auf Scachi aus, der auf der Brücke steht und eine Zigarre raucht. Der Abstand beträgt gut dreihundert Meter.
Das wird ein leichter Schuss, selbst bei Nacht.
Er kehrt ins Theater zurück und sieht das Stück zu Ende.
Art Keller steht auf der Treppe und klingelt. Althea sieht blendend aus. Überrascht, ihn zu sehen, aber blendend. ' »Arthur...«
»Darf ich reinkommen?«
»Klar doch.«
Sie führt ihn zum Sofa und setzt sich neben ihn. Das könnte mein Zuhause sein, denkt er. Hätte es sein können, wenn er es nicht weggeworfen hätte - für etwas, das es nicht wert war.
Dich hab ich auch weggeworfen, denkt er und mustert Althea.
Manche Frauen werden schöner mit dem Alter. Ihre Lachfalten zieren sie, und selbst die Sorgenfalten sind liebenswert. Er stellt fest, dass sie gefärbte Strähnchen hat. Sie trägt eine schwarze Bluse über den Jeans und eine Goldkette um den Hals. Irgendwann hat er ihr die Kette geschenkt, aber er weiß nicht, ob zum Geburtstag oder zum Valentinstag. Oder war es Weihnachten?
»Michael ist nicht zu Hause«, sagt sie. »Er ist mit seinen Freunden ins Kino.«
»Dann erwisch ich ihn das nächste Mal.«
»Art, ist was mit dir los?«, fragt sie und sieht plötzlich besorgt aus. »Du bist doch nicht krank, oder?«
»Alles bestens.«
»Du wirkst mir so -«
»Weißt du noch? Vor langer Zeit wolltest du, dass ich dir die volle Wahrheit sage.« Sie nickt.
»Ich wünschte, ich hätte es getan«, sagt er. »Und dich nicht weggeworfen.«
»Vielleicht ist es nicht zu spät.« Doch, denkt er. Leider ist es zu spät. Er steht auf. »Dann werd ich mal gehen.«
»War schön, dich zu sehen.«
»Dich auch.«
An der Tür umarmt sie ihn, küsst ihn auf die Wange.
»Pass auf dich auf, Art. Versprochen?«
»Klar.«
Er geht die Treppe hinunter. »Art?«
Er dreht sich um. »Es tut mir leid.«
Schon gut, denkt er. Ich bin wirklich nur gekommen, um auf Wiedersehen zu sagen.
Er weiß, dass er in einen Hinterhalt läuft. Sie wollen ihn und Nora auf der Cabrillo Bridge erschießen. Sie haben keine andere Wahl.
Nora steigt zu Hobbs in den Wagen.
Er benimmt sich sehr gentlemanlike - ein alter Herr mit Anzug, Fliege, Überzieher, obwohl es eine warme Nacht ist.
Sie sieht großartig aus, und sie weiß es. Ihr Haar ist auf Blond zurückgefärbt, sie haben ihr ein schwarzes Kleid gekauft, das passt wie angegossen, sie trägt Brillantohrringe, ein Brillanthalsband und hohe Schuhe. Ihr Make-up ist perfekt, ihre Augen leuchten wie Scheinwerfer, ihre Lippen glänzen feucht.
Sie kommt sich vor wie eine Hure.
Für jeden Auftritt, sagt sie sich, das passende Outfit.
Hobbs geht noch einmal alles mit ihr durch, aber sie hat schon verstanden. Sal Scachi hat es ihr geduldig erklärt. Sie muss auf der Mitte der Brücke mit Adán zusammentreffen und ihn zu seinem Auto begleiten. Weiter nichts.
Dann ist sie frei. Sie und Callan.
Beide bekommen sie eine neue Identität, können ganz neu anfangen.
Er erwartet sie an einem geheimen Ort, und sie darf erst zu ihm, wenn sie ihre Rolle gespielt hat wie besprochen. Die Mühe hätten sie sich sparen können, denkt sie. Bis jetzt hab ich alles mitgemacht. Was bedeuten schon ein paar Sekunden geheuchelte Liebe?
Nur dass Adán ungeschoren davonkommen soll, ärgert sie maßlos. Die CIA-Leute, um die es sich zweifellos handelt, werden die Hand über ihn halten, und er wird nicht für den Mord an Juan bestraft.
Das ist schlimm, das ist unerträglich, aber sie tut es für Sean. Und Juan wird es verstehen.
Oder nicht?, fragt sie sich mit einem Blick gen Himmel. Sag mir, dass du's verstehst, sag mir, dass ich's tun soll. Sag mir, dass du meine Sünden vergibst, auch die Sünde, die ich jetzt begehe.
Sal Scachi taxiert sie im Rückspiegel. Kein Wunder, dass die Kerle verrückt nach ihr sind. Sogar Callan hat sich in sie verknallt, und Callan ist ein eiskalter Hund.
Na, hoffen wir, dass sie dir heute Nacht die Sinne benebelt. Es kann nicht schaden, wenn du ein bisschen abgelenkt bist, weil ich derjenige bin, der dir die Kugel verpassen muss. Es ist zu traurig, mein Sonnyboy, aber du musst verschwinden. Das Risiko, dass du den Mund nicht hältst, ist einfach zu groß.
Es ist alles vorbereitet. Eine kleine Schießerei mit Drogengangstern auf der Brücke, dann morgen in den Medien die öffentliche Trauer um den heldenhaften Arthur Keller und einen Tag später die Enthüllung, dass er bestochen war, dass er auf der Gehaltsliste der Barreras stand, seine Gier nicht zügeln konnte und die Rechung serviert bekam. Erschossen von Barreras Leuten.
Von dem berüchtigten Sean Callan.
Auch du kriegst heute Nacht eine neue Identität, mein guter Sean.
Diesmal stirbst du wirklich.
John Hobbs inhaliert Noras Parfüm.
Alte Männer, denkt er, müssen sich ihre schalen Genüsse eben auf diese Weise besorgen. In früheren Zeiten, lang ist's her, hätte er vielleicht versucht, sie zu verführen. Wenn man denn eine Prostituierte überhaupt »verführen« kann. Jetzt will er von ihr nichts weiter, als dass sie ihre Rolle spielt.
Dass sie ihnen Adán Barrera zuführt - reibungslos und ohne Ärger.
Hobbs spürt ihretwegen keine Gewissensbisse, nichts von dem Bedauern, das er Arthur Keller gegenüber empfindet - wegen der unerfreulichen, aber leider notwendigen Maßnahme gegen ihn.
Klar, die nächste Welt wird perfekt. Diese hat leider ihre Macken.
Lüstern saugt er Noras Parfüm ein.
Keller fährt mit dem eigenen Wagen zum Treffen.
Adán Barrera sitzt neben ihm, die Hände mit Handschellen gefesselt. Um diese Nachtzeit ist kein Verkehr auf den Straßen. Keller fährt über den Harbor Drive, weil er den Ausblick liebt - die Boote im Jachthafen, das glitzernde Mondlicht auf dem Wasser, die Skyline von San Diego.
Barrera sitzt schweigend neben ihm, mit einem selbstgefälligen Grinsen.
»Weißt du was, Adán?«, sagt Keller. »Wegen deinesgleichen hoffe ich, dass es eine Hölle gibt.«
»Glaub nicht, dass du so davonkommst«, sagt Barrera. »Wir haben noch eine Rechnung offen - wegen Raul.«
Keller fährt an den Rand, steigt aus, zerrt ihn vom Sitz und zwingt ihn in die Knie. Dann zieht er seine 38er und weidet sich kurz an Adáns Erschrecken. Er holt aus und rammt ihm die Pistole ins Gesicht. Der erste Schlag zerfetzt seine Wange unter dem linken Auge, hinterlässt eine hässliche blutende Wunde. Der zweite Schlag bricht ihm die Nase. Der dritte spaltet ihm die Oberlippe und kostet ihn zwei Zähne.
Adán kippt vornüber, röchelnd, und spuckt Blut.
»Nur damit du weißt, dass ich keinen Spaß verstehe«, sagt Keller. »Wenn du mir dumm kommst, schlag ich dich tot. Das schwöre ich bei Gott. Hast du mich verstanden?«
Adán nickt.
»Wer hat den Mord an Parada in Auftrag gegeben?«
»Niemand, das war Zufall -«
Klar, es war Zufall, denkt Keller. Es war Zufall, dass Tío aus dem Gefängnis freikam, es war Zufall, das Antonucci dir Absolution erteilt hat, alles nur Zufall. Keller reißt seinen Kopf an den Haaren hoch und schlägt ihm die Pistole ans Ohr.
»Wer hat dich mit dem Mord an Parada beauftragt?«
Was soll's, denkt Adán. Jetzt ist es schon egal.
»Das war Scachi«, sagt er.
Keller nickt. Genau, wie ich dachte.
»Warum?«
»Er wusste über alles Bescheid«, sagt Adán. »So wie ich.«
»Er wusste von Kerberos?«
»Ja.«
»Red Cloud?«
»Auch.«
Keller zieht ihn hoch, schiebt ihn zum Auto und drückt ihn auf den Sitz.
Es wird Zeit, zur Brücke zu fahren.
Callan geht in Stellung.
Er nimmt das schwere Scharfschützengewehr aus dem Futteral, befestigt das Stativ und das Infrarot-Zielfernrohr und schraubt den Schalldämpfer vor. Dann legt er sich ins tote Gras und richtet das Gewehr auf die Brücke aus.
Es wird eine leichte Übung. Sobald Keller mit Barrera erscheint und ihn übergeben hat, wird Scachi sich umdrehen und nicken.
Callan erschießt Keller, packt ein und geht.
Scachi hält hinterher am Park Boulevard, lädt ihn ein und bringt ihn zu Nora. Gibt ihnen neue Pässe, und auf geht's nach L. A., zum Flug nach Paris.
Ein neuer Anfang.
Er bringt sich in Position und hält sich bereit. Operation Red Cloud kommt nach Hause.
Die Cabrillo Bridge überspannt den Highway 163 dort, wo er den Baiboa Park durchschneidet.
Keller parkt das Auto an der westlichen Auffahrt, direkt am Bowlingplatz, wo tagsüber die alten Leute, ganz in Weiß gekleidet, ihrem Zeitvertreib nachgehen. Er öffnet die Beifahrertür, zieht Adán am Ellbogen heraus, zeigt ihm die 38er im Hüftfutteral und sagt: »Versuch doch einfach zu fliehen.«
Er stößt ihn vor sich her, die westliche Zufahrt zur Brücke hinauf. Das bernsteinfarbene Licht der Straßenlampen verleiht den Steinbalustraden eine sanftgoldene Färbung. Zur Rechten sieht Keller die Skyline von San Diego mit ihren Bürotürmen und der riesigen roten Leuchtreklame des Hotel Cortez.
Dahinter den Hafen, den Ozean und die Coronado Bridge, die sich wie ein Traumgebilde durch die Nacht spannt, vom Chicano Park bis zum Barrio Logan, in dem er aufgewachsen ist. Zu seiner Linken liegt der Einschnitt des Palm Canyon mit seinen Araukarien und Mammutbäumen und nordöstlich, jenseits des Highway, der Zoo von San Diego.
Vor ihnen, am anderen Ende der Brücke, überragt der California Tower die Palmen des Baiboa Park wie die Dekoration einer riesigen Hochzeitstorte. Die Brücke selbst mündet in den Prado, den langen, breiten Spazierweg zwischen Museen und Gärten, und am Ende des Prado schießt die Fontäne der Baiboa Plaza in den Nachthimmel.
Viele Male schon ist er diesen Weg gegangen.
Der Mord an Padre Juan war nicht nur geplant, er war Teil von Operation Red Cloud, sagt sich Keller.
Und Hobbs hat ihn bestellt.
Zum ersten Mal seit langem sieht Keller wieder klar.
Callan nimmt Kellers Stirn ins Fadenkreuz, dann seine Brust, dann wieder die Stirn. Verpass ihm einen Kopfschuss, hat Scachi gesagt. Die Narcos arbeiten mit Kopfschüssen.
Keller sieht schweifende Scheinwerfer, ein Auto durchfährt den Kreisverkehr der Plaza Baiboa und schwenkt auf den Prado ein, ein schwarzer Lincoln. Am Anfang der Brücke bleibt er stehen.
Scachi steigt aus und öffnet die hintere Tür. Jetzt müht sich Hobbs heraus, langsam und schwerfällig, gehalten von Scachi, und stützt sich auf seinen Stock. Scachi geht herum zur anderen Seite und hält Nora die Tür auf. Sie steigt mit Grazie aus, wie eine Frau, die es gewohnt ist, dass ihr die Türen geöffnet werden.
Keller spürt ein Zucken in Adáns Arm.
Dann steigt noch jemand aus, und damit hat er nicht gerechnet.
Der Mann ist alt geworden. Silbernes Haar, silberner Schnurrbart. Er ist abgemagert, aber noch immer der Gentleman alter Schule. Tío.
Galant nimmt er Nora beim Arm.
Adán hat nur Augen für sie.
Sie sieht so verführerisch aus im sanften Licht. Er will loslaufen, zu ihr, und Keller hält ihn zurück. Aber das ist nicht nötig, denn sie geht auf ihn zu.
Geh bloß nicht so nahe an Keller heran, denkt Callan, als er Nora auf Barrera zugehen sieht. Nimm dir Barrera und geh zurück zum Auto. Sie ahnt nicht, was gleich passiert. Das soll sie auch nicht. Am besten, sie sitzt wieder im Auto, wenn er abdrückt. Sie ist schon genug mit Blut bespritzt worden.
Kurz vor der Mitte der Brücke treffen sie zusammen.
Scachi läuft den anderen voraus, geht auf Keller zu. »Nichts für ungut, Arthur. Ich brauche deine Waffe.«
Keller hält das Jackett auf, Scachi nimmt die 38er aus dem Hüftfutteral und steckt sie hinter seinen Gürtel. Dann nimmt er Keller von hinten bei den Schultern, schiebt ihn zur Balustrade und tastet ihn ab. Findet nichts und winkt die anderen heran.
Keller sieht Tío kommen, mit Nora am Arm. Als würde er sie zum Tanz führen, denkt Keller.
Hobbs ist ein wenig zurückgeblieben.
Tío blickt Adán ins zerschlagene, blutende Gesicht und sagt: »Du hast dich kein bisschen verändert, mi sobrino.«
»Warum hab ich dir keinen Kopfschuss verpasst?«, nuschelt Adán.
»Hättest du können«, sagt Tío. »Hast du aber nicht.«
»Was willst du hier?«
»Ich bin hier, damit mein Neffe weiß, dass er in gute Hände kommt«, sagt Tío. »Und nicht ermordet wird. Wie es scheint, komme ich gerade rechtzeitig.«
Er begrüßt Adán, indem er seinen Hinterkopf mit beiden Händen umfasst, aber sichtlich darauf bedacht, dass sein Anzug nicht mit Blut beschmiert wird. »Mi sobrino, was haben sie mit dir gemacht?«
»Schön, dich zu sehen, Tio.«
»Nehmt ihm die Handschellen ab«, sagt Tío.
Keller nimmt Adán die Handschellen ab und schiebt ihn vorwärts.
Inzwischen ist Hobbs herangekommen. »Sie haben Wort gehalten, Art, Sie sind ein Ehrenmann«, sagt er.
Keller schüttelt den Kopf. »Nein, nicht wirklich.«
Er packt Hobbs und hält ihn wie ein Schild vor sich, die linke Hand an seiner Kehle, die rechte hinter seinem Kopf. Ein Ruck, und er ist erledigt.
Scachi zieht seine Pistole, aber wagt nicht zu schießen.
»Leg das Ding weg, Scachi, oder ich breche ihm das Genick.«
»Dann bist du ein toter Mann.«
»Okay.«
Scachi legt die Pistole auf die Balustrade. »Meine auch«, sagt Keller.
Scachi legt Kellers 38er daneben. Dann blickt er hinüber zum Berghang und nickt.
Callans Signal.
Er nimmt Kellers Hinterkopf ins Fadenkreuz und atmet durch.
Ein neuer Anfang.
Keller sagt zu Nora: »Nora, wirf die eine Pistole runter, und gib die andere mir.«
Da muss Adán Barrera lachen.
Er lacht, bis Nora an die Balustrade geht und die eine Pistole ins Dunkel wirft.
»Was machst du da!«, brüllt Adán.
Sie schaut ihm geradewegs in die Augen.
»Ich war die Quelle, Adán. Es war immer ich.«
Adán wirft den Kopf zurück. »Ich habe dich geliebt!«
»Du hast den Mann ermordet, den ich geliebt habe. Dich habe ich nie geliebt.«
Sie gibt Keller die Pistole.
Scachi schaut über die Schulter zum Berghang und schreit: »Schießen!«
Keller dreht sich um, zu dem verborgenen Schützen.
Scachi zieht eine zweite Pistole und richtet sie auf Kellers Rücken.
Callan platziert den Schuss in der Mitte von Scachis Stirn. Scachi verschwindet aus dem Fadenkreuz. Tío duckt sich blitzschnell und greift nach Scachis Pistole. Keller dreht sich zu ihm um. Tío hebt die Pistole.
Keller schießt ihm zweimal in die Brust. Tíos Schuss durchschlägt die Hüfte von Hobbs und landet in Kellers Bein.
Beide gehen zu Boden.
Hobbs rappelt sich hoch, greift nach seinem Stock und humpelt los, zurück zu seinem Auto, mit grotesken Verrenkungen wie ein schlechter Schauspieler.
Callan richtet das Zielfernrohr auf die hinkende Gestalt.
Ein Blutfleck erscheint auf seinem Rücken.
Der Stock fällt klappernd zu Boden.
Adán kriecht auf Tío zu.
Er greift nach der Pistole seines Onkels.
Callan nimmt ihn ins Visier, aber Nora steht im Weg.
Keller richtet sich auf, sieht Adán neben Tío knien.
Adán schießt, zweimal, beide Schüsse sirren an Kellers Kopf vorbei.
Keller, taumelnd, drückt ab und trifft Tíos Leiche. Adán schießt erneut.
Kellers Kopf zuckt zurück, eine Blutfontäne spritzt hoch, er stürzt gegen die Balustrade, seine Pistole fällt auf den Highway unter der Brücke.
Adán richtet die Pistole auf Nora.
»Hinlegen!«, brüllt Callan von weitem.
Nora lässt sich fallen.
Auch Adán.
Er wirft sich auf den Bauch, kriecht an der Balustrade entlang und schießt zurück.
Callan kann ihn so nicht treffen, er kann ihn nicht mal sehen. Er lässt das Gewehr liegen und rennt auf die Brücke zu.
Adán steht auf und rennt los.
Der Schmerz ist ungeheuer. Keller schwankt, das Blut strömt ihm über die Stirn, nimmt ihm die Sicht. Sein Blickfeld schrumpft zum Tunnelblick, die Bewusstlosigkeit naht. Nur schemenhaft erkennt er den flüchtenden Adán auf der schwankenden, kippenden Brücke.
Keller sucht Halt, fällt um und steht wieder auf. Dann läuft er los.
Adán hört Schritte hinter sich.
Renn schneller, sagt er sich. Er muss es nicht über die Grenze schaffen, nur bis ins Barrio, dort an die richtige Tür klopfen, an eine Tür, die sich für Adán öffnet und für Art Keller schließt.
Er rennt den Prado entlang, der um diese Zeit menschenleer ist, zwischen den Museen hindurch, die dunkel aufragen wie Mauern einer Geisterstadt. Wenn er es bis zum Park Boulevard schafft, ist er so gut wie in Sicherheit. Dort gibt es tausend Ecken und Winkel, er kann sich verstecken und sich dann bis zum Barrio durchschlagen.
Er sieht den Springbrunnen im Kreisverkehr, bis dahin sind es noch fünfzig Meter, dann ist der Prado zu Ende. Die Fontäne glitzert silbern im Lampenlicht.
Auch Keller sieht den Brunnen und weiß, was das bedeutet.
Wenn Adán es bis dorthin schafft, kann er ohne weiteres entkommen. Die Jungs von der 28th Street werden ihn verstecken, über die Grenze schmuggeln. Er zwingt seine Beine zu mehr Tempo, obwohl jeder Schritt schmerzt wie tausend Nadelstiche.
Er hört Sirenen in der Ferne und fragt sich, ob sie echt sind oder Einbildung.
Auch Adán hört die Sirenen, er rennt weiter. Noch ein paar Meter, und er ist gerettet. Er dreht sich nach Keller um.
Keller springt, wirft sich auf ihn, packt ihn bei den Schultern und schiebt ihn über den Brunnenrand ins Wasser.
Adán bäumt sich auf und krallt seine Hand in Kellers Gesicht, in Kellers Augen fest.
Keller brüllt vor Schmerz, aber er hat Adán fest am Hemd und lässt nicht los. Einfach festhalten, einfach festhalten, schärft er sich ein. Bis das Hemd in Fetzen hängt und Adán sich losreißt.
Keller wirft sich blind auf ihn, mit der Kraft der Verzweiflung, hört das Platschen und Blubbern, als er Adáns Kopf unter Wasser drückt. Das Wasser im Springbrunnen färbt sich rot.
Keller packt ihn bei den Haaren, reißt ihn hoch, hört ihn keuchen, drückt ihn wieder unter Wasser und brüllt: »Das ist für Ernie, Dreckskerl! Das ist für Pilar Méndez und ihre Kinder! Das ist für Ramos!«
Er lässt ihn Wasser saufen, weidet sich an seinem ohnmächtigen Strampeln, am krampfhaften Zucken seines Körpers, an seinem Todeskampf.
»Das ist für El Sauzal!«
Keller stößt ihn noch tiefer unter Wasser. Adán bäumt sich unter ihm auf, sein Rücken spannt sich bis zum Zerreißen. Aber Keller sieht das nicht, er sieht ein totes Baby in den Armen seiner toten Mutter. Was sich da unter ihm aufbäumt, ist die Kraft des Bluthunds.
»Das ist für Padre Juan!«, brüllt er.
Er reißt Adáns Kopf aus dem Wasser.
Zwei Männer, ineinander verkeilt, nach Luft schnappend, überschüttet von der Fontäne, knien im Springbrunnen, das Wasser ist rot von ihrem Blut.
Keller sieht Rotlicht blinken, Polizisten mit gezückten Pistolen. Mit einer Hand hält er Adán am Nacken gepackt, die andere hebt er in die Höhe.
»Nicht schießen, nicht schießen!«, brüllt er. »Ich bin Polizist. Das ist mein Gefangener! Das ist mein Gefangener!«
Wie durch einen Tunnel sieht er Nora und Callan.
Und sinkt zurück ins Wasser.
Es fühlt sich wunderbar kühl an.
Epilog
An unbekanntem Ort
Mai 2004
Der Mohn steht in voller Blüte. Knallorange. Knallrot. Keller gießt die Pflanzen mit aller Vorsicht. Und muss ein wenig lächeln.
Sie haben ihn nicht ins Gefängnis gesteckt, weil der Richter irgendwann zur Einsicht kam, dass der einstmalige Herr der Grenze in einem Bundesgefängnis keinen Tag lang überleben würde. Also wartet er in wechselnden Verstecken, bis er wieder vor Gericht oder dem Untersuchungsausschuss aussagen muss. Ab und zu bringt man ihn in ein neues Versteck, wo er sich relativ sicher fühlen kann.
Seit drei Monaten ist er schon hier, und es wird mal wieder Zeit zum Umziehen, aber er sieht das nicht so dramatisch, heute ist es warm und sonnig, und er genießt die Einsamkeit und Ruhe in diesem ummauerten Garten.
YOYO, denkt er, als er die Gießkanne absetzt. You are on your own. Er setzt sich auf die Bank und lehnt sich an die Mauer aus Lehmziegeln.
Nein, du bist nicht allein, sagt er sich.
Du hast deine Schutzengel.
Nora ist jetzt weg. Sie hat ihre Aussage gemacht und ein neues Leben angefangen. Keller fragt sich, ob sie mit Callan zusammenlebt, der auch verschwunden ist. Ein netter Gedanke, jedenfalls.
Adán sitzt in einem Bundesknast, zwölfmal lebenslänglich, auch das ein netter Gedanke. Keller war im Gerichtssaal, als er in Handschellen und Fußfesseln abgeführt wurde. Und als Adán ihm zurief, das Kopfgeld auf ihn sei noch in Kraft.
Wer weiß, denkt Keller, vielleicht löst es jemand ein.
Etwa fünfzehn Minuten lang stockte der Drogenfluss, als Adán gefasst war. Dann war der Nachwuchs zur Stelle, und die Drogen flossen reichlicher als je zuvor.
Gestützt auf Kellers Aussagen zu Operation Kerberos und Red Cloud, setzte der Kongress einen Untersuchungsausschuss ein und kündigte Konsequenzen an. Doch es blieb bei der Ankündigung. Die Regierung bewilligt jährlich Milliardenhilfen für Kolumbien, zur Bekämpfung der Drogenkartelle. Einen Großteil der Gelder verschlingen die Hubschrauber, mit denen die Rebellen bekämpft werden. Und der Krieg geht weiter.
Kardinal Parada gilt offiziell noch immer als Opfer einer zufälligen Verwechslung.
Eigentlich müsste Keller enttäuscht und verbittert sein.
Manchmal versucht er es - und fühlt sich sofort zurückversetzt in die Jahre seines Rachefeldzugs, also lässt er es lieber sein. Althie und die Kinder, die längst keine Kinder mehr sind, kommen heute auf einen kurzen Besuch, und er möchte sich die Stimmung nicht verderben.
Er weiß noch nicht, wie es weitergeht mit ihm, wie lange er noch in dieser Zwischenwelt leben muss, ob er jemals ein freier Mann sein wird, und er betrachtet diesen Zustand als eine Form der Sühne. Noch immer weiß er nicht, ob er an Gott glaubt, aber er hofft, dass es einen gibt.
Und vielleicht ist es das Beste, was wir auf dieser Welt tun können, sagt er sich, als er aufsteht und die Gießkanne nachfüllt: Bestell deinen Garten und bewahre die Hoffnung auf einen Gott.
Gegen jede Wahrscheinlichkeit.
Er freut sich an den winzigen Wasserperlen auf den Blütenblättern.
Und murmelt einen alten Psalmvers, den er irgendwann gehört, aber nie verstanden hat, der sich trotzdem in seinem Kopf festgesetzt hat -
Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden!